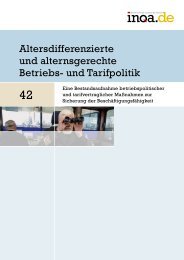download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Constanze Kurz / Harald Wolf 34<br />
nend für das breite Mittelfeld der BiowissenschaftlerInnen gelten darf. 29 Diese Gruppe der<br />
zwischen Ende 20 und 40 Jahren alten promovierten Nachwuchskräfte – der „Postdocs“ im<br />
Jargon des Feldes – , die sich <strong>als</strong> Anwärter auf universitäre Dauerstellungen auf dem mühsamen<br />
Pfad eines akademischen Aufstiegs befinden, eint in der Tat eines: die bereits gemachte<br />
Erfahrung und vor allem die sichere Erwartung einer großen Unsicherheit ihrer beruflichen<br />
Perspektive. Ohne feste Anstellung, nur mit einem befristeten Vertrag – sei es <strong>als</strong> wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter auf einer Qualifizierungsstelle oder in einem Drittmittelprojekt, <strong>als</strong><br />
Hochschulassistent oder <strong>als</strong> Juniorprofessorin – müssen sie alle Energien darauf verwenden,<br />
mit den feldspezifisch erlaubten Mitteln – wissenschaftlichen, finanziellen, „politischen“ – die<br />
Voraussetzungen für ihre nächste „Entfristung“ zu schaffen, sei es in der Form einer<br />
nochm<strong>als</strong> befristeten Projekt- oder Gruppenleiterstelle, sei es in der Form der angestrebten<br />
Dauerstellung <strong>als</strong> ProfessorIn.<br />
Alle 14 befragten Aspiranten (8 Männer, 6 Frauen) leben in Partnerschaften, eine ganze Reihe<br />
von ihnen ist verheiratet und/oder hat Kinder. Die prekäre Berufssituation prägt auch der<br />
Familie bzw. der Situation in der Partnerschaft ihren Stempel auf. Man ist auf eine mit den<br />
Partnern eng abgestimmte Berufsplanung angewiesen, Kinderwünsche werden zum Teil<br />
bewusst zurückgestellt, um die beruflich <strong>als</strong> notwendig erachtete Mobilität nicht<br />
einzuschränken. Besonders für die Biowissenschaftlerinnen, die schon ein Kind haben, wird<br />
die gesamte Lebens- und Arbeitskonstellation zur Belastung: „Manchmal ist es eine reine<br />
Katastrophe“. Wenn sie Glück haben, wechselt der Partner, um die Kinderbetreuung sicher zu<br />
stellen, auf eine Halbtagsstelle und hält ihnen für ihre beruflichen Ambitionen den Rücken<br />
frei: „Wir wollen, dass ich Hochschullehrerin werde.“. Im Vordergrund steht für fast alle der hohe<br />
Einsatz für die wissenschaftliche Karriere. Nur wenige – und zwar Frauen mit dem ersten<br />
kleinen Kind – stellen diese klare Prioritätensetzung in Frage: „Vorher war der Beruf alles, und<br />
jetzt kommt erstmal die Familie.“<br />
Das Einschlagen der akademischen Laufbahn haben die Aspiranten im Laufe ihres Studiums<br />
oder auch erst während der Promotion meist gründlich gegen Alternativoptionen – in der<br />
Regel die, <strong>als</strong> Biowissenschaftler in die Industrieforschung zu gehen – abgewogen und dann<br />
bewusst und entschieden präferiert. Die akademische Forschung erscheint fast allen im<br />
Prinzip <strong>als</strong> „Traumjob“, für den auch gewisse Nachteile – die im Vergleich zur Alternative<br />
Industrieforschung nicht gerade üppige Bezahlung und vor allem die hohe Ungewissheit über<br />
den weiteren Karriereverlauf – in Kauf genommen werden:<br />
„Die wirtschaftliche Unsicherheit: finde ich schon, dass das ein Tribut ist, den ich da zolle für die<br />
spannende Tätigkeit, <strong>als</strong>o wenn das nicht mit so viel Leidenschaft auch verbunden wäre und auch<br />
Freude mit den jungen Leuten und so, … dann würde ich das sicher nicht machen …“<br />
Die Laufbahn orientiert sich in aller Regel an dem üblichen, von den potenziellen „Arbeitgebern“<br />
im biowissenschaftlichen Feld erwarteten Laufbahnmuster: Es schließt nach der Promotion<br />
insbesondere eine längere Postdoc-Phase im Ausland ein, bevorzugt in den USA, dem<br />
Mekka der Biowissenschaften. Hier finden wichtige Prägungen statt, werden wichtige wissenschaftliche<br />
und – sehr vereinzelt – auch schon erste industrielle Kontakte geknüpft. Man<br />
kommt in mehr oder weniger enge Berührung mit der internationalisierten Welt der arrivierten<br />
BiowissenschaftlerInnen. Mehrfach wählen die Befragten den vor diesem Hintergrund et-<br />
29<br />
„Die großen Institute medizinischer oder naturwissenschaftlicher Art sind ‚staatskapitalistische’ Unternehmungen.<br />
Sie können nicht verwaltet werden ohne Betriebsmittel größten Umfangs. Und es tritt da der gleiche<br />
Umstand ein wie überall, wo der kapitalistische Betrieb einsetzt: die ‚Trennung des Arbeiters von den<br />
Produktionsmitteln’. Der Arbeiter, der Assistent <strong>als</strong>o, ist angewiesen auf die Arbeitsmittel, die vom Staat zur<br />
Verfügung gestellt werden; er ist infolgedessen vom Institutsdirektor ebenso abhängig wie ein Angestellter in<br />
einer Fabrik: - denn der Institutsdirektor stellt sich ganz gutgläubig vor, dass dies Institut ‚sein’ Institut sei, und<br />
schaltet darin -, und er steht häufig ähnlich prekär wie jede ‚proletaroide’ Existenz und wie der assistant der<br />
amerikanischen Universität.“ (Weber 1919: 584)