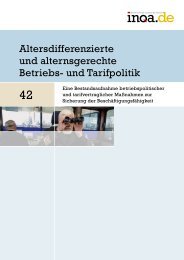download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Constanze Kurz / Harald Wolf 8<br />
der Zelle.“ (Rheinberger 2006: 13) Damit hat die Gentechnologie zu gravierenden Veränderungen<br />
der gesamten biowissenschaftlichen Forschungslandschaft geführt.<br />
Und diese Veränderungen betreffen nicht zuletzt auch den Anwendungsbezug biowissenschaftlichen<br />
Wissens. Bis dahin konnte – jedenfalls nach Ansicht des Molekularbiologen und<br />
Nobelpreisträgers François Jacob – „[d]ie Geschichte der Molekularbiologie […] <strong>als</strong> Modell<br />
dafür dienen, wie eine originelle Forschung unabhängig von möglichen Anwendungen in<br />
Gang kommt.“ (Jacob 1998: 26) Die neue Biologie war nach seiner Darstellung in ihrer ersten<br />
Etappe hauptsächlich „aus individuellen Entscheidungen einiger weniger Wissenschaftler“<br />
heraus entstanden: „Niemand drängte sie in diese Richtung“ (ebd.). Die Anwendungsperspektiven<br />
seien „erst nachträglich mit der […] Gentechnologie aufgetaucht, <strong>als</strong>o mit der Möglichkeit,<br />
in die Gene der Organismen einzugreifen.“ (ebd.) Auch die Gentechnologie selbst entstand<br />
auf völlig unvorhersehbare Weise. Sie ergab sich <strong>als</strong> überraschende Konsequenz lange<br />
Zeit weitgehend unbeachtet gebliebener Arbeiten in einem – insbesondere von den Förderinstitutionen<br />
<strong>als</strong> uninteressant eingestuften – Zweig der Virologie (vgl. ebd.: 27).<br />
Die zentrale Bedeutung „emergenter“ epistemologischer Entwicklungen für die Frage der<br />
Anwendungsrelevanz der neuen Biologie – deren „Nachträglichkeit“ – wird am Beispiel der<br />
Krebsforschung besonders deutlich. Auch hier eröffneten sich halbwegs erfolgversprechende<br />
Anwendungsbezüge biowissenschaftlicher Forschung nicht durch forschungspolitische<br />
Weichenstellungen und gezielte Förderung, sondern erst durch neue Arten der gentechnologischen<br />
Erforschung und Betrachtung der Zelle und die damit einhergehende „Veränderung in<br />
der Vorstellung vom Lebewesen“ (ebd.: 99). 5 Dieses Muster ist für die modernen Biowissenschaften<br />
verallgemeinerbar. Einerseits sind die Anwendungspotenziale der neuen molekularen<br />
Biologie – wie in anderen Wissenschaftsbereichen – in hohem Maße „kontingent“: von<br />
unvorhersehbaren, von außen oft kaum erkennbaren und noch schwerer gezielt stimulierbaren<br />
innerwissenschaftlichen Entscheidungen und „Fundsachen“ abhängig. Andererseits ergibt<br />
sich umgekehrt im Bereich der Biowissenschaften oftm<strong>als</strong> gerade eine hohe unmittelbare<br />
Anwendungsrelevanz neuer grundlegender Erkenntnisse und Befunde – wenn sie denn<br />
gewonnen worden sind. Die probate Unterscheidung in Grundlagenforschung und angewandte<br />
Forschung greift deshalb hier kaum. Was in der Pharmazie und in der Medizin<br />
ohnehin gilt, gilt inzwischen auch für weite Teile der neuen Biologie: dass fast jegliche Suche<br />
nach neuem Grundlagenwissen potenziell direkte Anwendungsperspektiven „generiert“.<br />
Dieser Sachverhalt ist wichtig für das Verständnis des besonderen Verhältnisses von<br />
universitärer biowissenschaftlicher Forschung zum industriellen Anwendungskontext in der<br />
Pharma- oder Biotechnologie-Branche und auch der entsprechenden Transferorientierungen<br />
der Biowissenschaftler. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, hat Donald Stokes in<br />
kritischer Auseinandersetzung mit dem immer noch gängigen „Kaskadenmodell“ – eines<br />
klaren Kontinuums von Grundlagen- und Anwendungsforschung, das in der Entwicklung<br />
fortgeführt und in die Markteinführung neuer Produkte und Prozesse mündet – ein<br />
„Quadrantenmodell“ vorgeschlagen, das der angedeuteten Konstellation besser entspricht.<br />
5<br />
In den USA war bereits in den siebziger Jahren unter Nixon – und um Kennedys Mondflugprogramm zu<br />
überbieten – die Parole „Krieg dem Krebs“ ausgegeben worden, der dam<strong>als</strong> innerhalb von fünf Jahren (!) durch<br />
Bereitstellung entsprechend hoher öffentlicher Fördermittel gewonnen werden sollte. Da aber zu dieser Zeit noch<br />
kein einziger der relevanten grundlegenden Mechanismen der Koordination von Zellteilung und<br />
Zelldifferenzierung bekannt war, konnte dies nur grandios fehlschlagen. Erst Anfang der achtziger Jahre änderte<br />
sich dies, aber nicht aufgrund administrativer Anweisungen oder verfügbarer Fördermittel, sondern durch<br />
überraschende Entwicklungen in der Grundlagenforschung, genauer: eben der Anwendung der Gentechnologie<br />
auf die Grundlagenforschung. Ein Gen konnte nun aus einem beliebigen Organismus isoliert und in einen anderen<br />
wieder eingesetzt werden, und damit waren z.B. auch Gene aus Krebszellen zu gewinnen, die wiederum in<br />
normale Zellen injiziert werden konnten, um diese zu Krebszellen zu machen usf. Mit einem Mal wurde damit<br />
die Krebsforschung „zu einem der aufregendsten und vielversprechendsten Aspekte der Biologie“ (Jacob 1998:<br />
98), und die talentiertesten Köpfe begannen sich hier zu tummeln.