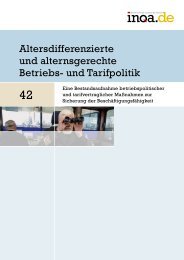download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Constanze Kurz / Harald Wolf 38<br />
nach der Vorstellung, welche Projekte müssen dann gemacht werden, mit welchen Methoden, mit<br />
welcher Spezialisierung. Dann sammeln sich die Gruppen, die das machen können, und schon allein<br />
dadurch entsteht ein großes Team von mehreren Labors.“<br />
Ohne solche virtuellen „großen Teams“ funktioniert biowissenschaftliche Forschung nicht.<br />
Immer gibt es bestimmte Testreihen oder chemische Analysen, die sich nicht oder nur mit<br />
großem Mehraufwand mit dem Equipment vor Ort durchführen lassen; immer bedarf es der<br />
Substanzen oder Organismen – zentrale Informationsträger der biowissenschaftlichen Forschung<br />
–, die nur im Austausch leihweise wechselseitig zur Verfügung gestellt werden. Wichtig<br />
sind deshalb entsprechende (Hochschul-)Standortvorteile, durch die das regionale Umfeld<br />
mit einem möglichst passenden Spezialisierungsprofil der eigenen und der Nachbardisziplinen<br />
die Forschungsprozesse beschleunigen und durch die vielbeschworene „kritische<br />
Masse“ den Informations- und Anregungsaustausch befördern helfen. Andererseits dürfen –<br />
aus der Karrieresicht der Aspiranten – solche Kooperationen nur wohl dosiert und stets nur<br />
mit großer Vorsicht eingegangen werden: Weil „ich in der ersten Phase … meiner universitären<br />
Karriere darauf schauen muss, dass ich mich selbst befördere und nicht irgendwelche anderen Leute<br />
befördere.“<br />
Als zentrale ForschungsarbeiterInnen im Labor bilden die Aspiranten das Rückgrat der<br />
„Nachtwissenschaft“ (siehe Abschnitt 3.1). Am Experimentiertisch, der „Bench“, sind sie es,<br />
die am unmittelbarsten den Unwägbarkeiten und der Unkontrollierbarkeit des „Stofflichen“<br />
ausgesetzt sind. Sie berichten fasziniert und sarkastisch zugleich davon, wie dicht der Nebel<br />
des Nicht-Wissens hier oft ist:<br />
„Die Bakterien wollen nicht so, wie ich will, die Substanzen wollen nicht so, wie ich will, das Wetter<br />
spielt mir manchmal einen Strich durch die Rechnung und alles Mögliche. Die sind so widerborstig die<br />
Systeme, mit denen wir umzugehen haben… Wir machen exakte Naturwissenschaft…“<br />
„Wir drehen da an Schaltern herum, von denen wir keine Ahnung haben, und ich sehe das tagtäglich<br />
im Labor. Ich arbeite mit Einzellern, und gelinde gesagt machen die, was sie wollen. Und sie machen<br />
selten das, was wir wollen.“<br />
Diese besondere Sperrigkeit der lebendigen Experimentierobjekte erfordert eine Haltung der<br />
Experimentatoren, die Präzision, „Frustrationstoleranz“, Geduld und doch gegebenenfalls Entschlossenheit,<br />
eingeschlagene Wege denn doch auch einmal abzubrechen, vereint.<br />
„Man muss genau sein. Man muss hartnäckig sein, trotzdem flexibel, nicht alles geht so einfach. Man<br />
muss Sachen beenden können und trotzdem lange genug an verschiedenen Sachen probieren. Also<br />
nicht sofort beenden, die Biologie ist von vornherein variabel. Da muss man schon eine gute<br />
Mischung finden zwischen Flexibilität und Hartnäckigkeit.“<br />
Das Experimentieren selbst ist oft eine individuelle Tätigkeit, der unmittelbare Experimentieraufbau,<br />
die Testreihen etc. bleiben in dem Bereich biowissenschaftlicher Laborforschung, in<br />
dem wir uns bewegten, für den Einzelnen in der Regel überschaubar. Dadurch aber, dass die<br />
Modellorganismen genmanipuliert werden müssen, damit sie die für das Experiment gewünschten<br />
Eigenschaften besitzen und chemische Analysen oder Messreihen mit speziellen<br />
Geräten durchzuführen sind, ergeben sich unmittelbare Kooperationsbezüge zu anderen in der<br />
Gruppe und vor allem zu entsprechenden Spezialisten in anderen Bereichen. Die<br />
Gruppenleiter wachsen dabei bereits stärker aus dem Experimentieralltag heraus und übernehmen<br />
stärker andere Funktionen. Ihnen unterstehen Gruppen von drei bis zehn Personen,<br />
zusammengesetzt aus Doktoranden, Diplomanden und technischem Personal. Ab einer bestimmten<br />
Gruppengröße ziehen sich die Leiter von der Arbeit an der „Bench“ zurück:<br />
„Seit gut einem Jahr mache ich selber keine Experimente mehr. Ich helfe noch mal bei Experimenten,<br />
aber ich stehe praktisch jetzt nicht mehr an der Laborbank, weil dafür einfach der Betreuungsaufwand<br />
für die ganzen Mitarbeiter so groß geworden ist, dass dafür keine Zeit mehr bleibt… Im Wesentlichen