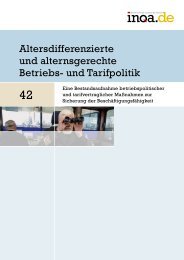download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Constanze Kurz / Harald Wolf 12<br />
men hat. Große Markterfolge und Renditen lassen immer noch auf sich warten, und auch die<br />
Beschäftigungsbilanz bleibt mager. 11 In dem hoch kompetitiven, globalen Markt – in dem vor<br />
allem US-amerikanische Biotechunternehmen von der neuen Arbeitsteilung und den<br />
Kollaborationen mit „Big Pharma“ profitieren – lassen sich nur ausgereiftes Wissen und<br />
Dienstleistungen verkaufen, die sowohl mit den Produkt- und Technologielinien <strong>als</strong> auch mit<br />
den Rentabilitätskriterien der großen Pharmaindustrie kompatibel sind. Für schwach<br />
kapitalisierte, einseitig spezialisierte und mit geringen Ressourcen ausgestattete Newcomer<br />
sind die Hürden des Markteintritts oftm<strong>als</strong> unüberwindlich. Vor diesem Hintergrund wundert<br />
es nicht, dass in den letzten Jahren ein faktischer Stopp von Ausgründungsaktivitäten aus der<br />
Hochschule festzustellen ist. Es scheint überaus fraglich, ob das Gründungsgeschehen und<br />
eine darüber vermittelte Verwischung oder Verschiebung der Grenzen zwischen Wissenschaft<br />
und Wirtschaft noch einmal eine nennenswerte Dynamik entfalten werden.<br />
Dass für die Pharmaindustrie die Bedeutung eines direkteren Zugriffs auf akademisches<br />
Wissen zugenommen hat, zeigt sich auch daran, dass sie die Suche nach Wirkstoff- und<br />
Methodenansätzen immer systematischer betreibt: Alle großen Pharmaunternehmen beschäftigen<br />
sog. Technologiescouts, welche die akademische Forschung nach interessanten, verwertbaren<br />
Novitäten (Testverfahren, Modellorganismen, Targets, Transportsysteme für Wirkstoffe,<br />
Substanzen) absuchen. Seitdem die Forschungs- und Entwicklungslabore der Pharmaindustrie<br />
zu wenig Nachschub liefern, ist weltweit der Handel mit Wirkstoffen und Vermarktungsrechten<br />
aufgeblüht. Gekaufte Patente und Lizenzen sind heute vielfach der Stoff, aus<br />
dem die neuen Produktkandidaten sind. Mehr <strong>als</strong> die Hälfte der zwanzig meistverkauften<br />
Arzneimittel sind bereits aus Entwicklungskollaborationen, Marketingkooperationen oder<br />
Lizenzeinkäufen entstanden. Der Hunger der Pharmaindustrie nach neuen Produktkandidaten<br />
führt zu einer verstärkten Rezeption und Nutzung der universitären Forschungsergebnisse, sei<br />
es auf dem Weg des Erwerbs von Patenten, sei es auf dem Weg verschiedener Formen der<br />
direkten Kooperation mit akademischen Forschern (vgl. Abschnitt 3.4 sowie Gaisser u.a.<br />
2005).<br />
3.3 Die neue Governance der universitären Forschung und des<br />
Wissenstransfers<br />
Mit dem wachsenden Interesse der Pharmaindustrie hat die Einordnung von Forschungsergebnissen<br />
in Prozesse ökonomischer Verwertung <strong>als</strong>o erheblich an Dynamik gewonnen. Diese<br />
Entwicklung korrespondiert mit einer veränderten Wissenschaftspolitik, die eine stärkere<br />
Nutzenorientierung der akademischen Forschung sowie die Öffnung der Hochschulen<br />
gegenüber der Wirtschaft und ökonomischen Orientierungen – auf Basis eines Umbaus des<br />
institutionellen settings – zu erreichen sucht (vgl. Weingart/Taubert 2006; Krücken 2001). In<br />
der wissenschafts- und forschungspolitischen Perspektive stehen hierbei die Biowissenschaften<br />
geradezu paradigmatisch für engere Formen der Kopplung von Hochschule und<br />
Wirtschaft (vgl. Weingart 2001): Hier erkennt man ein „boomendes“ Forschungsgebiet, dem<br />
auf Grund rasanter Erkenntnisfortschritte basisinnovatorische Qualität und hohes Transferpotenzial<br />
in einem nicht nur aus industrieller, sondern auch aus Sicht der Hochschulen lukrativen<br />
Verwertungsfeld zu attestieren sind.<br />
Überraschend ist nicht, dass den Biowissenschaften ein solches Potenzial zugeschrieben wird,<br />
sondern eher, dass die oben erörterten Spezifika der akademischen Wissens- wie der<br />
industriellen Innovationsproduktion im anvisierten Feld – ihr langfristiger Zeitrahmen, ihr<br />
11<br />
Die Beschäftigtenzahlen sind seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2001, <strong>als</strong> 14.408 Beschäftigte in 365 Unternehmen<br />
arbeiteten, zwischenzeitlich deutlich zurückgegangen und lagen 2004 bei 10.089 Beschäftigten und 346<br />
Unternehmen. Zugleich ist die Gründungsdynamik beträchtlich erlahmt. Wurden im Jahr 2000 noch 59 Unternehmen<br />
gegründet, sind für das Jahr 2004 nur noch 26 Neugründungen zu verzeichnen.