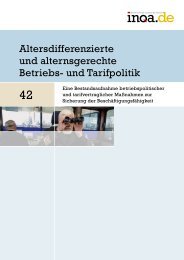download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Constanze Kurz / Harald Wolf 32<br />
Vor allem ist die Forschungsarbeit auf die Ziele des Unternehmens hin orientiert, und ihr<br />
Erfolg bemisst sich nicht nach dem wissenschaftlichen Reputations- und Währungssystem,<br />
sondern nach wirtschaftlichen Rentabilitätsvorstellungen: „Aber die Währung in Pharma ist ganz<br />
klar, ist Cash. Was zum Schluss zählt, ist Cash.“ Eindeutig restriktiver <strong>als</strong> im Hochschulkontext<br />
sind die zeitlichen Bedingungen unter denen ein potenzieller Wirkstoff zu produzieren ist:<br />
„Forschung in Pharma hat eine Zeitachse, entweder du kannst etwas in einer gewissen Zeitspanne<br />
aussagen oder nicht.“ Unverrückbar ist zudem, dass nicht der arrivierte Biowissenschaftler,<br />
sondern das Pharmaunternehmen entscheidet, wann die Kooperation – möglicherweise früher<br />
<strong>als</strong> ursprünglich vereinbart – beendet ist, sei es aufgrund einer unberechenbaren Unternehmensentscheidung,<br />
sei es, weil die wissenschaftliche Problemlösungskompetenz nicht ausreicht.<br />
Und schließlich stellt sich die nicht eben einfach zu lösende Aufgabe, den Wissenstransfer<br />
in einer Weise zu regeln, die einerseits den Bedürfnissen der Industrie auf Geheimhaltung<br />
und Sicherung intellektueller Eigentumsrechte, anderseits die Befriedigung von<br />
Publikationsinteressen des Arrivierten zulässt:<br />
„Diesen Teil habe ich auch publizieren können, hochrangig. Was ich nicht publizieren konnte, ist<br />
dieses kleine Molekül, der potenzielle nächste Wirkstoff. (…). Das heißt, es gab gewisse Sachen, die<br />
durfte ich nicht erzählen. Die waren aber für mich auch gar nicht wichtig. Weil ich mache die X, ich<br />
mache nicht die Moleküle, das machen meine Kollegen in der Industrie. Ich gucke mir deren Moleküle<br />
mit meinen Methoden an, und diese Methoden mussten entwickelt werden, erstmal, damit man sie<br />
sich überhaupt anschauen kann. Und dazu brauchte es meine Mitarbeiter und mich.“<br />
Die direkte Zusammenarbeit mit der Industrie verlangt vom Arrivierten Verhandlungsgeschick,<br />
professionelles Auftreten, Frustrationstoleranz und ein tieferes Verständnis für die<br />
Sichtweisen und Entscheidungskriterien, die in der Industrieforschung gelten. Hinzu kommt<br />
das Erfordernis, die Arbeits- und Entscheidungsabläufe, die im Hochschullabor üblich sind,<br />
mit denen des Kooperationspartners zu synchronisieren und effizient zu organisieren. Auch ist<br />
im Auge zu behalten, dass unberechenbare Abbruchentscheidungen des Unternehmens<br />
nachteilige Folgen für die MitarbeiterInnen haben können; mit der Folge, dass in Industrieprojekten<br />
in der Regel Postdocs eingesetzt werden, da sie im Unterschied zu Diplomanden<br />
und Doktoranden in Bezug auf ihre wissenschaftlichen Qualifizierungsinteressen nicht<br />
zwingend auf die Weiterführung einer Kooperation angewiesen sind. Kurzum: die<br />
BiowissenschaftlerInnen sind sowohl mit erheblichen manageriellen Herausforderungen <strong>als</strong><br />
auch mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich den im Anwendungskontext gelten Normen<br />
anzupassen. Davon betroffen ist nicht nur der Organisationsmodus universitärer Forschung,<br />
sondern auch die (stoffliche) Art des erzeugten Wissens bzw. der erzeugten Forschungsergebnisse,<br />
die direkt in den Innovationsprozess zu überführen sind. Mithin sind die<br />
Leitplanken für eine vergleichsweise kurzfristig orientierte Produkt- und Verfahrensentwicklung<br />
vorgeben, die freilich kaum gezielt stimuliert werden kann und ausgesprochen<br />
riskant ist (vgl. Abschnitt 3.2). Diese Risiken sind für die BiowissenschaftlerInnen zwar nicht<br />
Existenz bedrohend, können sich allerdings negativ auf ihr Forschungsbudget sowie die<br />
langfristige Weiterentwicklung ihres Forschungsansatzes auswirken. Nicht zuletzt geben die<br />
BiowissenschaftlerInnen die Eigentumsrechte an ihren Forschungsergebnissen zumindest in<br />
Teilen an die Industrie ab, was negative Folgen für das wissenschaftliche Reputationsinteresse<br />
und die Reputationsmöglichkeiten mit sich bringen kann.<br />
Die Konflikte, die sich aus den jeweils spezifischen normativen Leitvorstellungen der<br />
industriellen und wissenschaftlichen Wissensproduktion ergeben, scheinen regulierbar zu<br />
sein. Dabei zeichnen sich freilich nicht unerhebliche Verschiebungen des wissenschaftlichen<br />
Normengefüges ab, insbesondere in Bezug auf die Norm des Kommunalismus, die relativiert<br />
wird. Evident ist auch, dass administrative und kalkulatorische Anforderungen durch direkte<br />
Kooperationen mit der Industrie weiter an Gewicht gewinnen. Beides ändert (bislang) wenig<br />
daran, dass die in direkten Kooperationen engagierten BiowissenschaftlerInnen der<br />
Behandlung von wissenschaftlichen Grundlagenproblemen weiterhin einen ausgesprochen