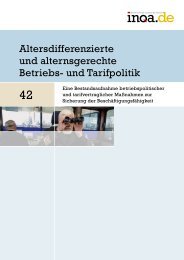download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Constanze Kurz / Harald Wolf 44<br />
heiten des jeweiligen Forschungsgebiets verschärfen oder abschwächen können. Die<br />
ungleiche Verteilung von Transferchancen spiegelt – gebrochen durch die stofflichen Eigenheiten<br />
und Kontingenzen – die sozialen Hierarchien und die Kapitalverteilung im biowissenschaftlichen<br />
Feld wider; für die Aspiranten sind sie am geringsten.<br />
Die Arrivierten sind die treibende, erhebliche Mittel akquirierende und dirigierende Kraft an<br />
der Spitze kleiner Forschungsbetriebe, die mit ihren spezialisierten Arbeitsgruppen in einer<br />
ausdifferenzierten Organisation und mit komplexen Technologien ausgestattet neues biowissenschaftliches<br />
Wissen produzieren. Der betriebsförmige, kleinindustrielle Charakter<br />
dieser wissenschaftlichen Produktionsgemeinschaft ist offenkundig (vgl. auch Gläser 2006).<br />
Diesen Forschungsbetrieb (und darin integriert den Ausbildungsbetrieb) müssen die<br />
Arrivierten in vielem wie industrielle Manager organisieren und leiten – und das verlangt<br />
ihnen Fähigkeiten ab, die landläufig gerade nicht mit einem im Humboldt’schen Geist<br />
sozialisierten Wissenschaftler assoziiert wurden. Dass die Aufgaben und Tätigkeiten<br />
arrivierter Wissenschaftler, zumal in den experimentellen Naturwissenschaften, vor allem<br />
auch die von Forschungs- oder Wissenschaftsmanagern sind, ist dabei zunächst natürlich<br />
noch kein so überraschender Befund. Ähnliches hat Hans-Paul Bahrdt etwa am Beispiel von<br />
Institutsdirektoren bereits in den sechziger Jahren diagnostiziert (Bahrdt 1971).<br />
Im Unterschied zu früher zeichnen sich ihre Funktionen heute allerdings durch einen noch<br />
höheren Anteil an manageriellen Elementen aus, und zwar unter anderem, aber nicht nur, weil<br />
die Anforderungen an das „Grenzmanagement“ im Austausch mit der Wirtschaft gewachsen<br />
sind. Der beschriebene kleine Grenzverkehr zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hat seine<br />
eigenen Regeln und Routinen und stellt wachsende Anforderungen an eine entsprechende<br />
"Boundary Work" (Gieryn 1983) der WissenschaftlerInnen. Und diese manageriellen<br />
Elemente – wie Abstimmen, Durchsetzen, Verhandeln, Organisieren, Kontrollieren,<br />
Motivieren, Abwehren, Überzeugen – sind auch nicht mehr so sehr auf die Spitzen<br />
konzentriert: auch die Arbeit der Aspiranten ist stark von ihnen geprägt. Für sie stehen solche<br />
Prägungen aber gänzlich im Zeichen der überaus prekären Laufbahnperspektive, des<br />
Wettlaufs um Reputation und Stellen im biowissenschaftlichen Feld, der nach Maßgabe der<br />
Akkumulation von sozialen (Netwerke) und kulturellem Kapital (Publikationen) entschieden<br />
wird. Vor diesem Hintergrund ist die eindeutige „Binnenorientierung“ des Wissenstransfers<br />
der Aspiranten nicht verwunderlich. Publikationen sind für sie mit Abstand das wichtigste<br />
Kommunikations- und Transfermedium. Die Schranken einer Ausrichtung am<br />
erwerbsorientierten, „unternehmerischen“ Transfer des von ihr erzeugten Wissens sind damit<br />
für diese Gruppe überdeutlich.<br />
Das eigentlich Neue scheint damit einerseits heute zu sein, dass diese Elemente <strong>als</strong> Anforderungen<br />
auf breiter Front und wie selbstverständlich sowohl in den Erwartungshaltungen<br />
und Handlungsorientierungen der BiowissenschaftlerInnen verankert sind <strong>als</strong> auch durch das<br />
Anreiz-, Bewertungs- und Reputationssystem der Wissenschaft begünstigt und reproduziert<br />
werden. Es kann ihnen keine(r) und es darf ihnen keine(r) mehr entgehen, der oder die es im<br />
biowissenschaftlichen Feld zu etwas bringen bzw. dort bestehen will. Wissenschaftliche<br />
Neugier, die uneigennützige Mühe um originelle Forschungsergebnisse, ein hohes Publikationsaufkommen<br />
und Engagement in der Lehre, all dies, so andererseits zugleich der Befund,<br />
sind auf dem klassischen wissenschaftlichen Ethos beruhende Verhaltensnormen, die ebenfalls<br />
weiterhin eine zentrale Orientierungsfunktion für das Arbeitshandeln und das berufliche<br />
Selbstverständnis der Biowissenschaftler haben. Sie verbinden sich in neuer Weise mit<br />
Kompetenzstandards, die für die Führung eines quasi-selbständigen Forschungsgeschäfts, das<br />
immer mehr im Grenzbereich von Wissenschaft und Wirtschaft agieren muss, von essentieller<br />
Bedeutung sind. Auch bei ausgesprochen transferaktiven BiowissenschaftlerInnen dominieren<br />
die wissenschaftlichen Interessen und Orientierungen. Ihr übergreifendes Bezugssystem bleibt<br />
dezidiert akademisch, nicht wirtschaftlich, ihr berufliches Selbstverständnis trägt