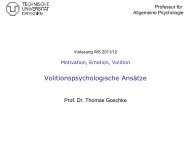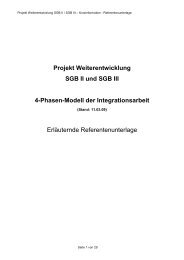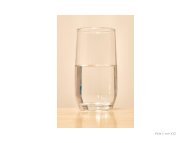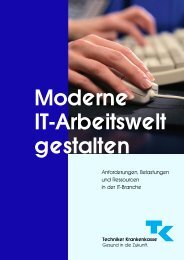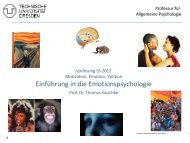Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bei der Untersuchung einfacher, d.h. überschaubarer<br />
und relativ „stabiler", nicht-industrieller Gesellschaften<br />
der Vergangenheit wird dieser lebenslange<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess möglicherweise weniger<br />
offenkundig als in den hoch differenzierten und<br />
dynamischen Industriegesellschaften der Gegenwart,<br />
deren ökonomische, politische, soziale und kulturelle<br />
Strukturen raschen Wandlungen und rapiden<br />
Umbrüchen unterworfen sind. Gerade in unserer<br />
Gegenwart gewinnt daher dieser Prozess - und damit<br />
verbunden die Notwendigkeit lebenslangen Lernens -<br />
sowohl individuell als auch sozial zunehmend an<br />
existentieller und funktionaler Bedeutung.<br />
Schließlich soll nochmals ausdrücklich auf dir<br />
Eigenaktivität des Individuums im<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess verwiesen werden. Zwar Ist das<br />
zu sozialisierende Kind in seinen ersten Lebensjahren<br />
in seinem physischen Überleben völlig abhängig von<br />
seiner sozialen Umwelt, was es damit „bezahlt", dass es<br />
sich dieser Umwelt anpasst. Aber diese „Anpassung"<br />
erfolgt ja nicht so,, dass das Kind einfach alles<br />
aufnimmt, sondern es trifft schon unbewusst eine<br />
Auswahl .aus der angebotenen Fülle. Was ihm nicht<br />
passt, das sieht und hört es nicht; es lernt also durchaus<br />
nicht alles, und was es lernt, lernt es verschieden gut.<br />
So setzt sich also das Individuum - mit zunehmendem<br />
Alter immer deutlicher -auch bewusst und unbewusst<br />
mit seiner materiellen und gesellschaftlichen Umwelt<br />
auseinander, wirkt auf dieselbe zurück und macht sie<br />
sich auf seine eigene Art und Weise zu eigen.<br />
<strong>Sozialisation</strong>svorgänge sind deshalb keineswegs<br />
einseitig, sondern müssen notwendigerweise als soziale<br />
Interaktionsprozesse begriffen werden, - ein Aspekt,<br />
den beispielsweise Goslin (1969) betont, wenn er die<br />
<strong>Sozialisation</strong> als einen „two- way" - Prozess<br />
charakterisiert.<br />
In einem sozialen Interaktionssystem wie z.B. der<br />
Familie wird jedes Mitglied das Verhalten eines jeden<br />
anderen Familienmitglieds beeinflussen, regulieren und<br />
somit wechselseitig sozialisieren. Solche Effekte kann<br />
man ja immer wieder beobachten, wenn ein Ehepaar<br />
bei der alltäglichen physischen und psychischen<br />
Versorgung seines ersten Kindes allmählich jene<br />
Handlungsfähigkeiten lernt, die seine Elternrolle<br />
schließlich konstituieren, oder wenn der junge, eben<br />
von der Hochschule entlassene Lehrer erst „mit Hilfe"<br />
seiner Schüler in seine Lehrerrolle hineinwächst.<br />
Zwar könnte hierzu angemerkt werden, dass in dem<br />
angeführten Beispiel der Eltern-Kind-Beziehung die<br />
Eltern ja ihren Säugling in seiner prägsamsten Zeit<br />
(primäre <strong>Sozialisation</strong>) beeinflussen, während<br />
umgekehrt die beispielsweise durch das Lächeln des<br />
Kindes hervorgerufenen <strong>Sozialisation</strong>seffekte die<br />
Eltern zu einem Zeitpunkt treffen, in dem ihre<br />
Persönlichkeitsentwicklung im allgemeinen bereits eine<br />
bestimmte Strukturierung, Ausprägung und Reife<br />
erreicht hat (sekundäre <strong>Sozialisation</strong>), also solche<br />
wechselseitigen <strong>Sozialisation</strong>sprozesse auf zwei<br />
verschiedenen qualitativen Ebenen ablaufen. Doch<br />
lassen sich solche gegenseitigen<br />
<strong>Sozialisation</strong>swirkungen natürlich auch in<br />
„horizontalen" Interaktionsbeziehungen altersgleicher<br />
Partner nachweisen, - etwa zwischen Geschwistern,<br />
den Spielgefährten in 'der Kindergartengruppe,<br />
zwischen den Schülern einer Klasse und<br />
selbstverständlich auch zwischen Erwachsenen.<br />
So lässt sich also sagen, dass im <strong>Sozialisation</strong>sprozess<br />
das Individuum psychisch und sozial zu einem<br />
potentiell handlungsfähigen menschlichen Subjekt<br />
wird, das nicht nur in der Lage ist, sich seiner<br />
gesellschaftlichen Umwelt anzupassen und sich ihren<br />
Erwartungen entsprechend zu verhalten, sondern das<br />
zugleich auch kommunikativ und interaktiv auf deren<br />
Gestaltung Einfluss zu nehmen vermag.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Michael Argyle, Soziale Interaktion. (Darin<br />
insbesondere Kapitel 2: „Biologische und kulturelle<br />
Ursprünge der Interaktion", S. 26 - 89). Kiepenheuer<br />
&. Witsch: Köln 1969.<br />
George McCall & J.L. Simmons, Identität und<br />
Interaktion. Untersuchungen über<br />
zwischenmenschliche Beziehungen im Alltagsleben.<br />
(Darin Kapitel 8: „Der interaktive Werdegang des<br />
Individuums", S. 213 - 237). Schwann: Düsseldorf<br />
1974.<br />
Karl Reinhold Mühlbauer, <strong>Sozialisation</strong>. Eine<br />
Einführung in Theorien und Modelle. (Darin „Zum<br />
wissenschaftlichen Stand der<br />
<strong>Sozialisation</strong>sforschung", S. 13 - 26). Fink: München<br />
1980.<br />
Im Prinzip wird damit der <strong>Sozialisation</strong>svorgang nicht<br />
nur als Integrations-, sondern auch als Durchdringungs-<br />
(Interpenetrations-) Prozess von Kultur, Gesellschaft<br />
und Person gedeutet. <strong>Sozialisation</strong> selbst erscheint<br />
bereits inhaltlich mit den gegebenen<br />
allgemeingesellschaftlichen bzw.<br />
subkulturell-spezifischen Normen, Werten und<br />
sozial-strukturell verankerten Institutionalisierungen<br />
festgelegt. Der <strong>Sozialisation</strong>sprozess ist um so<br />
erfolgreicher, je mehr das Individuum seine Rolle auch<br />
„ist".<br />
Das dieser Denkfigur unterliegende „elementare<br />
Modell" einer <strong>Sozialisation</strong>ssequenz lässt sich graphisch<br />
wie folgt veranschaulichen:<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 11