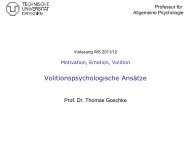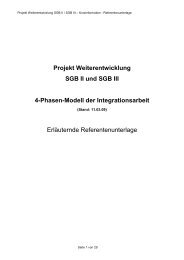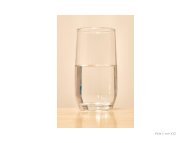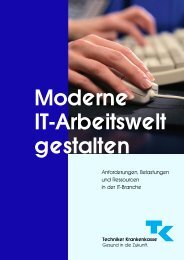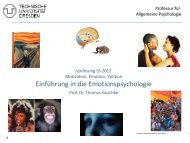Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rollenmodells eher um idealtypische Annahmen<br />
handelt. Explizit deutlich wird das bei Dahrendorf, der<br />
ja seine Rollentheorie nicht auf wirkliche Menschen<br />
bezog, sondern eben auf die Konstruktion von „homo-<br />
sociologicus" (analog den wirtschafts- und<br />
politikwissenschaftlichen Konstrukten des „homo<br />
oeconomicus" und des „homo politicus"), - auf ein<br />
Modell vom „soziologischen Menschen" also, an dem<br />
man das „ideale" Rollenverhalten ableiten kann.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Hans-Peter Frey, Theorie der <strong>Sozialisation</strong>. Integration<br />
von system- und rollentheoretischen Aussagen in<br />
einem mikrosoziologischen Ansatz. (Darin<br />
insbesondere Teil I/3: „Die Funktion von<br />
<strong>Sozialisation</strong>smechanismen Im gesell- Systemmodell<br />
vom Parsons", S. 4 - 18). Enke: Stuttgart 1914.<br />
Rainer Geissler, Die <strong>Sozialisation</strong>stheorie von Talcott<br />
Parsons. Anmerkungen zur Parsons-Rezeption in der<br />
deutschen Soziologie. In: Kölner Zeitschrift für<br />
Soziologie und Sozialpsychologie, 31. Jahrgang, H. 2,<br />
1979, S. 267 - 281.<br />
2.4.5 Sind wir wirklich alle Schauspieler? -<br />
Zur Kritik und Erweiterung des<br />
Rollenmodells<br />
Kritische Einwände gegen die analytische<br />
Fassungskraft und theoretische Reichweite des<br />
strukturell-funktionalen <strong>Sozialisation</strong>s- und<br />
Rollenkonzepts kamen vor allem von jenen, die weniger<br />
an einer (idealtypischen) Rekonstruktion sozialer<br />
Systeme als an Aussagen über das tatsächliche soziale<br />
Alltagshandeln interessiert waren. Bedenken gegen die<br />
übermäßige Betonung des gesellschaftlich Normativen<br />
und damit auch gegen die, die sozialisierende Seite des<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesses akzentuierenden Rollentheorie<br />
(= sog. „normatives Paradigma") wurden insbesondere<br />
von jenen Soziologen und Sozialpsychologen<br />
formuliert, die sich eher der Schule des so genannten<br />
„Symbolischen Interaktionismus" verpflichtet fühlen<br />
(z.B. Gouldner 1960, Turner 1962, Goffmann 1973,<br />
Wilson 1973 u. a.).<br />
Dieser von George Herbert Mead (1862 - 1931)<br />
begründete - allerdings erst nach dessen Tod zur<br />
breiteren wissenschaftlichen Anerkennung und Geltung<br />
gelangende - soziologisch-sozialpsychologische<br />
Theorieansatz (vgl. Mead 1973, zuerst 1934 postum)<br />
berücksichtigt zur Erfassung des alltäglichen<br />
Normalfalles von sozialem Handeln nämlich stärker die<br />
individuierenden Aspekte des <strong>Sozialisation</strong>sgeschehens,<br />
indem es ihm. darauf ankommt, im Spannungsfeld<br />
zwischen den rollenmäßigen Begrenzungen und<br />
Zwängen der Gesellschaft und den primären<br />
Bedürfnissen und Voraussetzungen des Individuums<br />
jene individuellen Freiheitsräume sozialen Handelns<br />
auszumachen und jene menschlichen<br />
Grundqualifikationen zu erkennen, die eine relative<br />
Autonomie bzw. subjektive Interpretation des<br />
Individuums beim Rollenspiel ermöglichen (= sog.<br />
„interpretatives Paradigma").<br />
Der symbolische Interaktionismus deutet die<br />
Entwicklung des zwischenmenschlichen Handelns und<br />
Verhaltens nicht nach dem Lernmodell von „Reiz"<br />
(Stimulus) und „Reaktion" (Response), sondern betont<br />
nachhaltig die kommunikativen und symbolischen<br />
Aspekte vom <strong>Sozialisation</strong>. Menschliches Verhalten<br />
entsteht zwar aus der Teilnahme an sozialen Prozessen<br />
innerhalb sozialer Strukturen und Ordnungen, beruht<br />
jedoch grundlegend auf Interaktion und Kommunikation<br />
und bedient sich überwiegend symbolischer- Zeichen,<br />
insbesondere der Sprache. Durch gemeinsame<br />
Interpretationen erhalten alle Gegenstände, Strukturen,<br />
Personen und Verhaltensweisen der jeweiligen Kultur<br />
soziale Bedeutungen („meanings"), die es dem<br />
Individuum ermöglichen, soziales Handeln - wie<br />
beispielsweise Rollenhandeln - stets intentional, d.h. mit<br />
einem bestimmten Sinngehalt, zu verwirklichen (vgl.<br />
Krappmann 1975: 20 f., Lindesmith & Strauss 1974: 27<br />
ff.) D.h., die soziologische Grundfrage nach den<br />
Entwicklungsgesetzen menschlichen Zusammenlebens<br />
beantwortet der symbolische Interaktionismus mit dem.<br />
Prinzip einer einvernehmlichen Interpretation über<br />
Gegenstandsbedeutungen im Rahmen sozialer<br />
Beziehungen, in die sich die Persönlichkeitsentwicklung<br />
als Zusammenhang von „Interaktion" und „Selbst"-<br />
Entwicklung eingliedern lässt („Modell einer<br />
vereinbarten Ordnung", Strauss 1969: 19J.<br />
Diese nicht ganz einfachen Ableitungen versucht Mead<br />
im amerikanischen Original seiner Schriften mit den<br />
Termini ,J" und "me" zu erhellen. Beide Begriffe wären<br />
im Deutschen mit „ich" wiederzugeben, was jedoch die<br />
von Mead beabsichtigte Differenzierung verwischen<br />
würde. Mit der grammatikalischen Unterscheidung von<br />
„1" als Subjektfall und "me" als Objektfall der ersten<br />
Person Singular möchte Mead vielmehr bewusst auf<br />
zwei verschiedene Seiten des sozialen Handelns<br />
aufmerksam machen. Auf die uns bereits geläufige<br />
Theatermetapher bezogen, stellt das "me" die objektive<br />
Seite des Rollenspiels dar, das von anderen auf die<br />
Aufführungsrichtigkeit und „Werktreue" des „sozialen<br />
Textes" hin beobachtet und kontrolliert wird, während<br />
das „I" den subjektiven Aspekt, nämlich den<br />
Schauspieler in seiner persönlichen Originalität und<br />
individuellen Unverwechselbarkeit sowie der<br />
schöpferischen Interpretation seiner Rolle zum<br />
Ausdruck bringt. Oder allgemeiner formuliert: Das<br />
"me" besteht aus einer Reihe von gesellschaftlich<br />
vorbestimmten und normierten Rollen (z.B. Lehrer oder<br />
Schüler, Sohn oder Tochter, Katholik oder Protestant)<br />
und stellt meine soziale Identität dar, während das nach<br />
Verwirklichung meiner genuin eigenen Bedürfnisse<br />
drängende „1" das Freiheitspotential meines „Selbst",<br />
d.h. meine personale Identität bezeichnet. Das „I" denkt<br />
über die zugemuteten oder vorgeschriebenen Rollen<br />
nach, sucht sie individuell zu gestalten oder kennt auch<br />
Wege, sich unter bestimmten Voraussetzungen dem<br />
Zwang tradierter Kulturmuster zu entziehen.<br />
Aus dieser Konstruktion von „I" und "Me" ergibt sich<br />
für die Binnenstruktur des Selbst ein labiles<br />
Gleichgewicht. Begreift man bildhaft die analytische<br />
Trennung zwischen „I" und "me" gewissermaßen als<br />
eine flexible Membrane, so lassen sich die<br />
Austauschprozesse zwischen „I" und "me" etwa<br />
folgendermaßen erläutern:<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 13