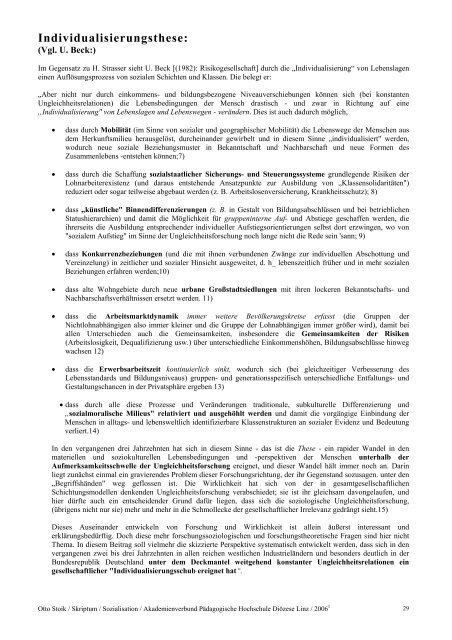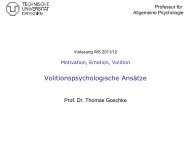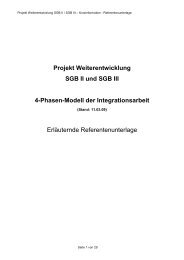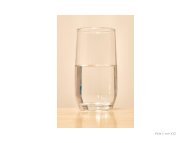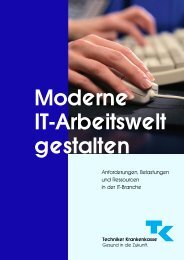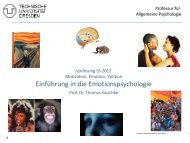Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Individualisierungsthese:<br />
(Vgl. U. Beck:)<br />
Im Gegensatz zu H. Strasser sieht U. Beck [(1982): Risikogesellschaft] durch die „Individualisierung“ von Lebenslagen<br />
einen Auflösungsprozess von sozialen Schichten und Klassen. Die belegt er:<br />
„Aber nicht nur durch einkommens- und bildungsbezogene Niveauverschiebungen können sich (bei konstanten<br />
Ungleichheitsrelationen) die Lebensbedingungen der Mensch drastisch - und zwar in Richtung auf eine<br />
„Individualisierung" von Lebenslagen und Lebenswegen - verändern. Dies ist auch dadurch möglich,<br />
• dass durch Mobilität (im Sinne von sozialer und geographischer Mobilität) die Lebenswege der Menschen aus<br />
dem Herkunftsmilieu herausgelöst, durcheinander gewirbelt und in diesem Sinne „individualisiert" werden,<br />
wodurch neue soziale Beziehungsmuster in Bekanntschaft und Nachbarschaft und neue Formen des<br />
Zusammenlebens -entstehen können;7)<br />
• dass durch die Schaffung sozialstaatlicher Sicherungs- und Steuerungssysteme grundlegende Risiken der<br />
Lohnarbeiterexistenz (und daraus entstehende Ansatzpunkte zur Ausbildung von „Klassensolidaritäten")<br />
reduziert oder sogar teilweise abgebaut werden (z. B. Arbeitslosenversicherung, Krankheitsschutz); 8)<br />
• dass „künstliche" Binnendifferenzierungen (z. B. in Gestalt von Bildungsabschlüssen und bei betrieblichen<br />
Statushierarchien) und damit die Möglichkeit für gruppeninterne Auf- und Abstiege geschaffen werden, die<br />
ihrerseits die Ausbildung entsprechender individueller Aufstiegsorientierungen selbst dort erzwingen, wo von<br />
"sozialem Aufstieg" im Sinne der Ungleichheitsforschung noch lange nicht die Rede sein 'sann; 9)<br />
• dass Konkurrenzbeziehungen (und die mit ihnen verbundenen Zwänge zur individuellen Abschottung und<br />
Vereinzelung) in zeitlicher und sozialer Hinsicht ausgeweitet, d. h_ lebenszeitlich früher und in mehr sozialen<br />
Beziehungen erfahren werden;10)<br />
• dass alte Wohngebiete durch neue urbane Großstadtsiedlungen mit ihren lockeren Bekanntschafts- und<br />
Nachbarschaftsverhältnissen ersetzt werden. 11)<br />
• dass die Arbeitsmarktdynamik immer weitere Bevölkerungskreise erfasst (die Gruppen der<br />
Nichtlohnabhängigen also immer kleiner und die Gruppe der Lohnabhängigen immer größer wird), damit bei<br />
allen Unterschieden auch die Gemeinsamkeiten, insbesondere die Gemeinsamkeiten der Risiken<br />
(Arbeitslosigkeit, Dequalifizierung usw.) über unterschiedliche Einkommenshöhen, Bildungsabschlüsse hinweg<br />
wachsen 12)<br />
• dass die Erwerbsarbeitszeit kontinuierlich sinkt, wodurch sich (bei gleichzeitiger Verbesserung des<br />
Lebensstandards und Bildungsniveaus) gruppen- und generationsspezifisch unterschiedliche Entfaltungs- und<br />
Gestaltungschancen in der Privatsphäre ergeben 13)<br />
• dass durch alle diese Prozesse und Veränderungen traditionale, subkulturelle Differenzierung und<br />
„sozialmoralische Milieus" relativiert und ausgehöhlt werden und damit die vorgängige Einbindung der<br />
Menschen in alltags- und lebensweltlich identifizierbare Klassenstrukturen an sozialer Evidenz und Bedeutung<br />
verliert.14)<br />
In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich in diesem Sinne - das ist die These - ein rapider Wandel in den<br />
materiellen und soziokulturellen Lebensbedingungen und -perspektiven der Menschen unterhalb der<br />
Aufmerksamkeitsschwelle der Ungleichheitsforschung ereignet, und dieser Wandel hält immer noch an. Darin<br />
liegt zunächst einmal ein gravierendes Problem dieser Forschungsrichtung, der ihr Gegenstand sozusagen. unter den<br />
„Begriffshänden" weg geflossen ist. Die Wirklichkeit hat sich von der in gesamtgesellschaftlichen<br />
Schichtungsmodellen denkenden Ungleichheitsforschung verabschiedet; sie ist ihr gleichsam davongelaufen, und<br />
hier dürfte auch ein entscheidender Grund dafür liegen, dass sich die soziologische Ungleichheitsforschung,<br />
(übrigens nicht nur sie) mehr und mehr in die Schmollecke der gesellschaftlicher Irrelevanz gedrängt sieht.15)<br />
Dieses Auseinander entwickeln von Forschung und Wirklichkeit ist allein äußerst interessant und<br />
erklärungsbedürftig. Doch diese mehr forschungssoziologischen und forschungstheoretische Fragen sind hier nicht<br />
Thema. In diesem Beitrag soll vielmehr die skizzierte Perspektive systematisch entwickelt werden, dass sich in den<br />
vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten in allen reichen westlichen Industrieländern und besonders deutlich in der<br />
Bundesrepublik Deutschland unter dem Deckmantel weitgehend konstanter Ungleichheitsrelationen ein<br />
gesellschaftlicher "Individualisierungsschub ereignet hat“.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 29