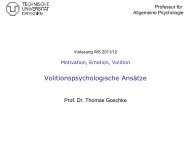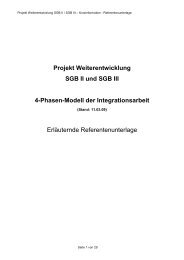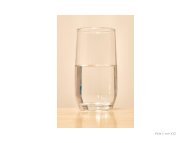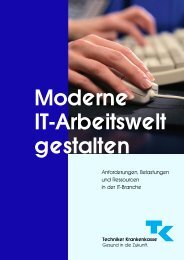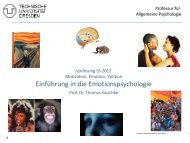Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die menschliche Natur, fassbar in ihren Triebimpulsen, wird durch <strong>Sozialisation</strong>sprozesse so<br />
bearbeitet, dass die individuellen Bedürfnisdispositionen im optimalen Fall mit den<br />
gesellschaftlichen, in Rollennormen institutionalisierten Wertvorstellungen zur Deckung kommen.<br />
Dies erst macht zwischenmenschliches Handeln rational, d.h. kalkulierbar.<br />
In Anlehnung an Freud unterscheidet Parsons fünf Phasen der <strong>Sozialisation</strong>. In jeder Phase<br />
internalisiert das Individuum ein bestimmtes, immer komplexer werdendes Verhältnis zur Umwelt,<br />
oder es lernt in jeder Phase, sich in einer spezifischen, immer differenzierter werdenden Weise zur<br />
Umwelt zu verhalten. Voraussetzung für den erfolgreichen <strong>Sozialisation</strong>sprozess sind voll<br />
sozialisierte <strong>Sozialisation</strong>sagenten, zumindest für die ersten drei Phasen. Was das Individuum jeweils<br />
internalisiert, nennt Parsons Objektsysteme: Das Mutter-Kind-Objektsystem und das Vater-<br />
Mutter-Kind-Objektsystem sind dabei die grundlegenden Orientierungsmuster, auf denen die<br />
folgenden aufbauen. Der Internalisierungsprozess ist ebenfalls analog zu Freud zu sehen: Der<br />
<strong>Sozialisation</strong>sagent löst Lernprozesse aus. indem er erwünschtes Verhalten belohnt, bis eine gewisse<br />
Verhaltenssicherheit erreicht ist. Dann wird nicht mehr belohnt, und es setzt eine Phase der<br />
Frustration ein, die dazu führt, sich neuen Bindungen zuzuwenden. Anders ausgedrückt: Bestimmte<br />
Objektsysteme sind so Inge positiv besetzt, bis sie verinnerlicht sind. Dann erfolgt die Frustration.<br />
was zum Abzug der positiven Besetzungen führt, und es werden neue, komplexere Objektsysteme<br />
positiv besetzt. Dies soll an den fünf Phasen der <strong>Sozialisation</strong> nach Parsons verdeutlicht werden.<br />
Die erste Phase<br />
In den ersten Lebenstagen internalisiert das Kind die Mutter. Das Kind ist noch nicht in der Lage, die<br />
Quelle seiner Bedürfnisbefriedigung, die Mutter, als von sich geschieden zu betrachten. Daher nennt<br />
Parsons die erste Phase auch die der Mutter-Kind-Identität. Da es die Mutter von sich nicht<br />
differenzieren kann, ist es auch noch nicht fähig, eine Interaktionsbeziehung zu ihr aufzunehmen. Es<br />
ist in seiner Bedürfnisbefriedigung total von ihr abhängig. Es lernt in dieser Phase das Objektsystem<br />
Abhängigkeit.<br />
Die zweite Phase<br />
Allmählich lernt (las Kind. die verschiedenen Akte seiner Bedürfnisbefriedigung zu verallgemeinern<br />
und mit der Mutter als von ihm getrennten Objekt zu verbinden. Mit dieser Ausdifferenzierung der<br />
Mutter aus dem Selbst wird es zum Interaktionspartner. zum Rollenspieler: Es orientiert seine<br />
Erwartungen am Verhalten der Mutter, wie auch diese sich am Kind orientiert. In dieser Phase der<br />
Mutter- Kind - Dyade (Zweiheit) verstärkt sich einerseits das Objektsystem Abhängigkeit, zum<br />
anderen aber internalisiert das Kind das Objektsystem Autonomie. Es hat nunmehr zwei<br />
Objektsysteme verinnerlicht.<br />
Die dritte Phase<br />
Man könnte diese Phase auch als die Vater- Mutter- Kind- Triade bezeichnen. Es tritt also nunmehr<br />
die Familie als Struktur ins Bewusstsein des Kindes und lässt es die grundlegende Rollenverteilung<br />
in der Kernfamilie erkennen: Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Dabei wird die Rolle des Vaters als die<br />
instrumentelle Rolle erkannt: Aufgrund seiner Rolle reguliert er das Verhältnis der Familie zur<br />
Umwelt (Berufsrolle, Lebenssicherung der Familie). Die Rolle der Mutter wird als expressive<br />
erkannt: Sie bewältigt die innerhalb des Familiensystems auftretenden Spannungen und hat eine die<br />
Familie integrierende Funktion. Durch Identifikation mit dem Vater findet der Sohn seine<br />
instrumentell geprägte Geschlechtsrolle und analog die Tochter ihre expressive Rolle durch<br />
Identifikation mit der Mutter. Am Ende der dritten Phase hat damit das Kind die beiden Basisrollen<br />
gelernt: die Generationsrolle, die auf den Objektsystemen Abhängigkeit (der Kinder) und Autonomie<br />
(der Eltern) beruht. sowie die Geschlechtsrolle, die beim Knaben auf dem Objektsystem<br />
Instrumentalität, beim Mädchen auf dem Objektsystem Expressivität beruht. Da auch der Knabe das<br />
Objektsystem Expressivität als das .,andere" lernt, d.h. sich in Aktion und Reaktion gegenüber<br />
Mutter oder Schwester auf dieses einzustellen hat, wie umgekehrt das Mädchen auf diese Weise<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 19