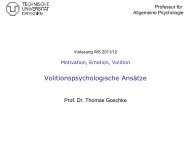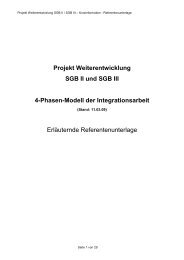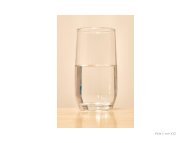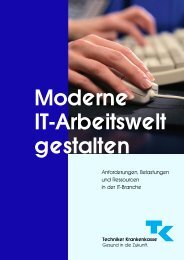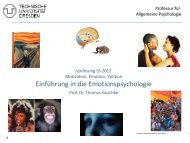Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auswirkungen belastender Ereignisse und Übergänge im Lebenslauf:<br />
Wie bereits bei der Analyse von Belastungen im Kindesalter diskutiert, ist in der psychologischen<br />
Forschung zur Erlassung berstender Ereignisse in Familie, Freundeskreis und Freizeit, teilweise unter<br />
Einschluss des Arbeitsbereiches, ein differenziertes Instrumentarium entwickelt<br />
Die Social Readjustment Rating Scale (SRRS) umfasst insgesamt 43 Life- Events, darunter (mit dem<br />
jeweilig Durchschnitts-Punktwert der Belastung):<br />
1. Tod des Ehepartners 100<br />
2. Scheidung 73<br />
3. Trennung vom Ehepartner 65<br />
4. Haftstrafe 65<br />
5. Tod eines nahen Familienangehörigen 63<br />
6. Eigene Verletzung oder Krankheit 53<br />
7. Heirat 50<br />
8. Verlust des Arbeitsplatzes 47<br />
9. Aussöhnung mit dem Ehepartner 45<br />
10. Pensionierung 45<br />
11. Änderung im Gesundheitszustand<br />
eines Familienmitglieds 44<br />
12. Schwangerschaft 40<br />
13. Sexuelle Schwierigkeiten 39<br />
14. Familienzuwachs 39<br />
15. Geschäftliche Veränderung 39<br />
16. Erhebliche Einkommensveränderung 38<br />
17. Tod eines nahen Freundes 37<br />
Die vorliegenden Untersuchungen weisen au!<br />
einen Zusammenhang zwischen Belastungen<br />
und den alltäglichen Lebensaktivitäten, den<br />
Mustern des Lebensstils und der Lebensweise<br />
ein-,. Bevölkerungsgruppe, hin. Alle<br />
einschlägigen Studien liefern Belege = eine<br />
stärkere Ausprägung verschiedener Symptome<br />
von Lebensbelastung in Bevölkerungsgruppen<br />
mit ungünstigem sozio- ökonomischem Status.<br />
Offenbar sind sowohl die objektiven<br />
Belastungskomponente: wie auch die subjektiv<br />
wahrgenommenen Belastungen in den<br />
unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen<br />
höher. Auch herrscht in stärkerem Maße das<br />
Gefühl vor, den Entwicklungsaufgaben und<br />
den alltäglich= Herausforderungen des Lebens<br />
nicht in vollem Maße gewachsen zu sein, so<br />
dass es zu einem Gefühl von Machtlosigkeit<br />
gegenüber Lebensforderungen, fehlendem<br />
Selbstvertrauen sowie zur Entwicklung von<br />
ungeeigneten Strategien der<br />
Lebensbewältigung kommt.<br />
Durch die objektiven Lebensumstände sind<br />
Unterschichtangehörige also einer größeren<br />
Zahl von belastenden Ereignissen und<br />
Situationen ausgesetzt und sie sind zugleich<br />
„verletzlicher" durch diese objektiven<br />
Belastungen als es in den sozialen<br />
Mittelschichten und Oberschichten.<br />
der Fall ist. Kessler und Cleary (1980)<br />
erklären das durch die relativ begrenzten<br />
Zugangsmöglichkeiten sowohl zu<br />
intrapsychischen als auch zu sozialen<br />
Ressourcen, also zu den<br />
Bewältigungsmechanismen und<br />
Kontrolltechniken der Lebenssituation auf der<br />
einen Seite und den materiellen und<br />
immateriellen Unterstützungsmöglichkeiten<br />
auf der anderen Seite.<br />
Diese Merkmale der Lebensweise drücken<br />
sich in unterschiedlichen sozialen Definitionen<br />
von Gesundheit und Krankheit aus. Wie Baur<br />
(1987) betont, wird Krankheit bei Mitgliedern<br />
unterer sozialer Schichten oft als Schwäche<br />
interpretiert, welche die gewohnte Nutzung<br />
des Körpers beeinträchtigt oder behindert.<br />
Krankheit wird dann zur Kenntnis genommen,<br />
wenn sie sich, jenseits einer relativ hohen<br />
Schmerzschwelle, nicht mehr übergehen lässt.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 37