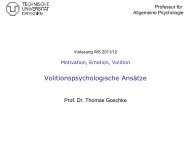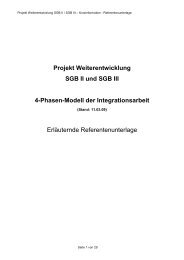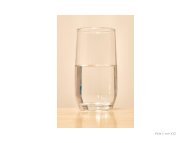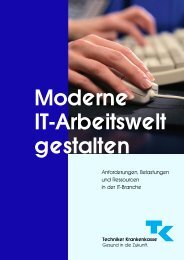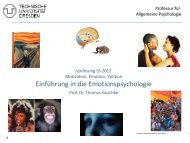Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.4.2 Aspekte und Dimensionen der<br />
<strong>Sozialisation</strong>: <strong>Sozialisation</strong> als<br />
soziale Interaktion<br />
Aus unseren bisherigen Darlegungen wurde schon<br />
deutlich, dass sich <strong>Sozialisation</strong>svorgänge nicht auf die<br />
Kindheit beschränken, sondern als relativ allgemeiner<br />
Bestandteil des menschlichen Lebenszyklus zu<br />
verstehen sind.<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesse lassen sich zunächst danach<br />
unterscheiden, ob es darum geht, die grundlegende<br />
Mitgliedschaft in der Gesellschaft und damit die<br />
Fähigkeit zur Teilnahme am sozialen Geschehens<br />
überhaupt erst zu erwerben, oder darum, neue<br />
Möglichkeiten der Verwirklichung dieser Beteiligung<br />
zu lernen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass<br />
nicht nur die <strong>Sozialisation</strong> als ein dynamischer Prozess,<br />
sondern auch der Begriff der Person dynamisch zu<br />
verstehen ist. Leben bedeutet eine komplexe Abfolge<br />
von Prozessen des Lernens, Verlernens und neuen<br />
Lernens.<br />
„So erfährt ein Kleinkind, dass die Umwelt auf sein<br />
Schreien in ganz bestimmter Weise reagiert. Wenn das<br />
Kind dann später eine elementare Sprache gelernt hat,<br />
wird erwartet, dass sich von da ab das Kind der Sprache<br />
bedient, statt undifferenziert zu schreien: Schreien als<br />
Form der Kommunikation ist zu verlernen, Sprechen<br />
selbst bei sehr dringlichen Bedürfnissen zu erlernen.<br />
Weinen als Form der Mitteilung des Kindes, nun<br />
wünsche es Trost und zumindest Aufmerksamkeit, wird<br />
in unserem Kulturkreis über viele Lebensjahre hinweg<br />
akzeptiert, wird dann aber mit dem Beginn des<br />
Schulalters immer weniger legitim. Zunächst soll das<br />
Kind sich vertrauensvoll an alle Erwachsenen wenden.<br />
In dem Masse, wie der Kreis der Erwachsenen, denen<br />
das Kind begegnet, differenzierter wird, soll das Kind<br />
lernen, sich differenziert zu verhalten und unbekannten<br />
Erwachsenen gegenüber misstrauisch zu sein."<br />
(Scheuch & Kutsch 1972: 103 f.). Mit anderen Worten:<br />
Die Erwartungen, die mit der Teilnahme am<br />
gesellschaftlichen Leben verknüpft sind, ändern sich<br />
mit zunehmendem Alter und mit der Erweiterung der<br />
Lebenskreise. Veränderte Situationen und Umgebungen<br />
stellen an das Individuum neue Probleme der sozialen<br />
Beteiligung und Beanspruchung. Manches muss<br />
korrigiert, manches neu erworben werden.<br />
Man bezeichnet die erste und elementare <strong>Sozialisation</strong><br />
in der frühen Kindheit als primäre <strong>Sozialisation</strong>. Sie<br />
erfolgt in der Regel in der Familie und vermittelt<br />
inhaltlich und formal die Grunderfahrungen des<br />
sozialen. Lebens in einer kleinen und vertrauten<br />
Gruppe: Das Kind lernt, welche Bedeutungen die<br />
Menschen seiner unmittelbaren Umgebung mit ihren<br />
Worten, Gesten, Mienen und mit ihrem Tun und Lassen<br />
verbinden; es lernt, sich selbst, bestimmte<br />
Verhaltensweisen bzw. vorsprachliche und dann auch<br />
sprachliche Ausdrucksformen anzueignen die die<br />
anderen verstehen und gelten lassen; und schließlich<br />
muss das Kind lernen, seine Bedürfnisse mit den<br />
Erwartungen seiner Umwelt in Einklang zu bringen.<br />
Fachlich gesprochen werden damit kognitive,<br />
sprachliche, motivationale und affektiv-emotionale<br />
Persönlichkeitsmerkmale in der primären <strong>Sozialisation</strong><br />
zunächst elementar ausgeformt.<br />
Die hierbei vermittelten gesellschaftlichen<br />
Verhaltensmuster und Erfahrungen legen zwar ein<br />
relativ solides Fundament, das im Verlauf späterer<br />
Lebensphasen jedoch nach zahlreichen Richtungen hin<br />
weiter ausgebaut und ergänzt, aber auch differenziert<br />
und modifiziert werden muss. Dies geschieht in der so<br />
genannten sekundären <strong>Sozialisation</strong>, die auf der Basis<br />
primärer Sozialisiertheit aufbaut, hingegen im<br />
wesentlichen im außerfamiliären Raum verläuft, wie<br />
z.B. im Kindergarten, in der Schule und in<br />
Freundschaftsgruppen, im Beruf, in der Freizeit, in<br />
Vereinen, in religiösen Gruppen, aber auch in<br />
„anonymen" Feldern der Konsumindustrie, der<br />
Massenmedien usw.<br />
<strong>Sozialisation</strong> müssen wir darum auch als einen<br />
kumulativen, aktuell sich vollziehenden lebenslangen<br />
Prozess verstehen, der nicht - wie manche Autoren<br />
(z.B. Schelsky 1963: 84 ff.) noch annahmen – mit dem<br />
Ende der Jugendphase als abgeschlossen gelten kann. In<br />
jeder neuen Lebensphase ergeben sich insbesondere<br />
auch unter veränderten materiellen Bedingungen und<br />
durch den Wechsel von sozialen Beziehungen (z.B. bei<br />
Eheschließung, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit, Wahl<br />
in einen Vereinsvorstand, Pensionierung, Umzug in ein<br />
Altersheim) immer wieder neue<br />
<strong>Sozialisation</strong>skonstellationen, die beim Individuum<br />
Veränderungen von bestehenden bzw. die Übernahme<br />
neuer Handlungsfähigkeiten erforderlich machen. So<br />
lässt sich unter soziologischer Perspektive für unsere<br />
Kultur und Gesellschaft als eine mögliche<br />
Strukturgliederung im Lebenslauf beispielsweise<br />
folgende Phaseneinteilung der sozialen Bedingungen<br />
und Folgen des lebenslangen <strong>Sozialisation</strong>sprozesses<br />
vornehmen.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 9