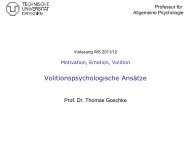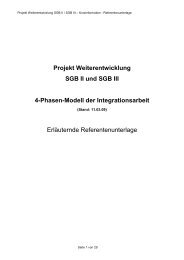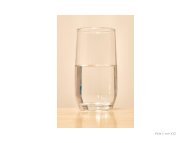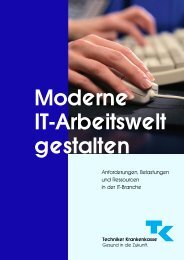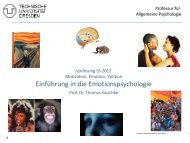Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mangelnde<br />
Handlungskompetenz und<br />
Unterschicht<br />
dieser Interpretation entsprechend verhält (und z.B. einen Vertrag unterschreibt).<br />
Mangelnde Handlungskompetenz ist nun zum einen ein besonderes Problem<br />
der Lebensphasen ;,Kindheit"_ und „Jugend", zum anderen aber auch ein<br />
Problem der <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen bzw. Erfahrungsmöglichkeiten.<br />
Dass Kinder und Jugendliche über mangelhafte Kompetenzen verfügen, ist<br />
nach den vorangegangenen Erläuterungen nicht weiter verwunderlich. Der<br />
Erwerb von Wissen und Kompetenzen mit dem Ziel der Aneignung von<br />
Umwelt und der Identitätsbildung (Ich-Identität) ist ja gerade Gegenstand<br />
des <strong>Sozialisation</strong>sprozesses. Aber Handlungskompetenz ist nur zum Teil<br />
eine quantitative Frage, d.h. eine Frage der Erfahrungsmenge, die mit<br />
zunehmendem Lebensalter gewissermaßen ,-natürlich" angesammelt wird<br />
und wächst. Zum anderen Teil ist Handlungskompetenz eben auch ein<br />
qualitatives Problem, d.h. davon abhängig, auf welche Weise soziale<br />
Erfahrungen erworben werden und wie diese Erfahrungen strukturiert sind.<br />
Insofern betreffen Kompetenzunterschiede nicht nur Kinder und<br />
Jugendliche, sondern auch Erwachsene.<br />
Bei Erwachsenen machen sich Kompetenzmängel allerdings in erster<br />
Linie nur bemerkbar in Situationen, die außerhalb der eingespielten und<br />
erarbeiteten Alltagsroutine lugen. Man könnte auch sagen: Je kleiner und<br />
geschlossener die Alltagswelt und je enger die Sinnhorizonte gesteckt sind,<br />
um so begrenzter ist auch die Handlungskompetenz.<br />
Kinder und Jugendliche, die aus Familien kommen, die aufgrund<br />
sozialstatistischer und kultureller Faktoren der Unterschicht zuzuordnen<br />
sind, haben nun besondere Schwierigkeiten in der Entwicklung von<br />
Handlungskompetenz (und damit in der Entwicklung von Fähigkeiten, die<br />
notwendig sind für die Aneignung von Umwelt). Zum einen sind sie wie<br />
alle Jugendlichen von der in der Gesellschaftsstruktur angelegten Tatsache<br />
betroffen, dass „Jugend" eine Übergangsphase mit besonderen<br />
sozialisatorischen Anforderungen ist. Die Entwicklung von<br />
Handlungskompetenz wird für sie jedoch dadurch weiter erschwert, dass<br />
wesentliche Teile der Handlungsmuster und -Strategien, die in der<br />
familialen <strong>Sozialisation</strong> gelernt und internalisiert werden, der Aneignung<br />
von Umwelt relativ enge Grenzen setzen.<br />
Wir werden uns mit den Erziehungsstilen und besonders mit den Sprachstilen in<br />
Unter- und Mittelschicht weiter unten noch näher befassen, wollen aber schon hier<br />
Bedingungen für eine geringere Entwicklung von Handlungskompetenz in der<br />
Unterschiss etwas konkreter andeuten. Ein wesentliches Element sind<br />
unterschiedliche Sprachstile in Unter- und Mittelschicht (die Unterschiede werden<br />
ebenfalls weiter unten noch erläutert). Unterschichtspezifische Sprachformen sind<br />
weniger komplex und differenziert. Wenn Sie sich an den oben ausführlich<br />
dargestellten Zusammenhang von Sprache, Denken, Ordnung von Erfahrung und<br />
Aneignung vor-- Umwelt erinnern, wird Ihnen klar, dass geringere Komplexität und<br />
Differenziertheit von Sprache über das Denken auch das Vermögen des Kindes<br />
begrenzen, „Welt" zu begreifen und Umwelt anzueignen.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 Das Kind wird sowohl durch Elemente der Sprachstruktur an eine jeweilige Situation<br />
gebunden, indem situationsübergreifende, allgemeinere Prinzipien der Geltung und<br />
Begründung von Regeln nicht mehr vermittelt werden, als auch durch besondere<br />
Inkonsistenz im Erziehungsverhalten der Eltern, die auf gleiche Handlungen des Kindes für<br />
dieses völlig uneinsichtig unterschiedlich reagieren -mal bestrafen, mal straflos zur Kenntnis<br />
nehmen, mal ignorieren. Die grundlegende Erfahr des Kindes im Rahmen derartiger<br />
<strong>Sozialisation</strong>sbedingungen ist die der "Auslieferung" an jeweils aktuelle soziale Situationen<br />
mit nur bedingter Vorhersehbarkeit der Erwartungen und Reaktionen des<br />
Interaktionspartners. Die Notwendigkeit zur Entwicklung eines situativen Opportunismus<br />
begrenzt die Autonomie des Kindes und das Maß, in dem es andere, abstraktere Ebenen<br />
sozialer (gesellschaftliche') Realität in sozialen Situationen zu erkennen und sich handelnd<br />
25