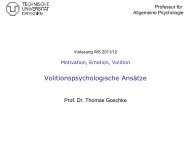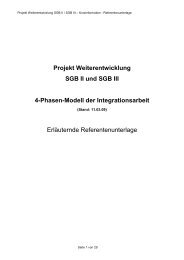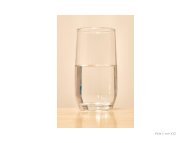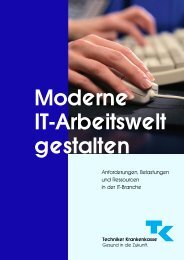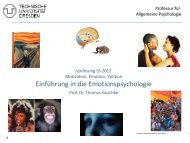Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Persönlichkeit ein Spiegelbild der sozial-kulturellen<br />
Verhältnisse dar, die sie geprägt haben. Später wird<br />
allerdings noch zu zeigen sein, dass die sozialkulturelle<br />
Persönlichkeit nicht einfach als ein Ergebnis der<br />
passiven Anpassung des Individuums an die<br />
Gesellschaft zu verstehen ist.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Hans Paul Bahrdt, Zur Frage des Menschenbildes in<br />
der Soziologie. In: Europäisches Archiv für Soziologie,<br />
1, 1961.<br />
Alfred Bellebaum, Soziologische Grundbegriffe. Eine<br />
Einführung für Soziale Berufe. (Darin Kapitel 3:<br />
„Instinktverhalten und soziales Handeln", S. 22 29).<br />
Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1972.<br />
Es sind jedoch gerade diese Lernvorgänge, die den<br />
Soziologen besonders interessieren. Denn dass der<br />
Mensch durch seine Umwelt geformt werden kann, ist<br />
zunächst keine exklusive Erkenntnis der<br />
Sozialwissenschaft: alle Erziehung fußt auf dieser<br />
Voraussetzung. Unser Alltagswissen verbucht erst dann<br />
durch die soziologische Perspektive einen Zugewinn an<br />
„Weltverständnis", wenn prägende Einflüsse dort<br />
entdeckt werden, wo man zunächst keine vermutet,<br />
oder wenn wir als Soziologen zeigen können, dass die<br />
intendierte Erziehung oder die geplante Ausbildung<br />
noch andere als die beabsichtigten Effekte hat: eben die<br />
Vermittlung jener sozialen Regeln und Gepflogenheiten<br />
menschlichen Zusammenlebens und konkreter<br />
Lebenswirklichkeit, die kein Erziehungsprogramm und<br />
kein Curriculum thematisieren.<br />
2.4 <strong>Sozialisation</strong> und soziale Rolle: <strong>Sozialisation</strong> begegnet uns damit als ein relativ weit<br />
Wir alle spielen Theater<br />
(ebendort, S 66 – 75)<br />
2.4.1 Die Mitgliedschaft in der<br />
Gesellschaft: <strong>Sozialisation</strong><br />
Die Vermittlung sozialer Normen und<br />
Wertvorstellungen erfolgt in einem Prozess, den die<br />
Soziologie als <strong>Sozialisation</strong> bezeichnet. Der Begriff<br />
<strong>Sozialisation</strong> (engl.: socialisation) stammt aus den<br />
angelsächsischen Sozialwissenschaften. Gelegentlich<br />
wird er auch mit „Sozialisierung" (z.B. Seger 1970,<br />
Fend 1972) übersetzt, was jedoch leicht zu<br />
Missverständnissen führt, da dieses. Wort durch seine<br />
wirtschaftspolitische Bedeutung (= Verstaatlichung der<br />
Privatwirtschaft) bereits belegt" ist.<br />
<strong>Sozialisation</strong> meint mehr als der klassische<br />
pädagogische Begriff der „Erziehung", der sich ja vor<br />
allem auf jene in der Regel absichtsvollen und bewusst<br />
geplanten Bemühungen und Handlungsschritte von<br />
Eltern oder Lehrern bezieht, die zum Ziel haben, die<br />
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes pädagogisch<br />
positiv zu beeinflussen, d.h. bestimmte<br />
Verhaltensdispositionen zu entwickeln oder vorhandene<br />
zu verändern (vgl. hierzu Kob 1976: 9, Hurrelmann<br />
1976: 19 f.).<br />
Vielmehr schließt <strong>Sozialisation</strong> den Vorgang der<br />
Erziehung mit ein und umfasst darüber hinaus auch jene<br />
ungeplanten, aber persönlichkeitsprägenden<br />
Lernvorgänge, die sowohl das Kleinkind wie auch<br />
später noch der Erwachsene durch eigene Erfahrungen<br />
machen kann. Hierzu zählen jene unspezifischen<br />
Lernvorgänge, für die auch in Gesellschaften mit breit<br />
entwickeltem Erziehungswesen keine erziehende<br />
Instanz und keine erzieherischen Maßnahmen als<br />
explizite Einwirkungen auszumachen sind. Überhaupt<br />
lassen sich solche Einflüsse - denkt man beispielsweise<br />
an die prägenden Wirkungen von jugendlichen<br />
Freundschaftsgruppen, Fan-Clubs, Reklame,<br />
Massenmedien, Interessenorganisationen, politische<br />
Öffentlichkeit usw. - nach pädagogischem<br />
Selbstverständnis schwerlich alle sinnvoll als Erziehung<br />
oder Ausbildung charakterisieren, während sie faktisch<br />
indessen zweifellos sozialisierende Prozesse darstellen.<br />
gefasster Begriff, der alle sozialen Geschehensverläufe<br />
abbildet, durch die das Individuum, das mit<br />
rudimentären Instinkten, aber mit dispositionell großer<br />
Plastizität und Lernfähigkeit, also „mit einer enormen<br />
Variationsbreite von Verhaltensmöglichkeiten geboren<br />
wird, zur Ausbildung seines faktischen, weit enger<br />
begrenzten Verhaltens geführt wird wobei die Grenzen<br />
(Im Üblichen und akzeptablen Verhaltens durch die<br />
Normen der Gruppe, der es angehört; bestimmt<br />
werden" (Child 1959: 665). In anderen Worten: der<br />
Begriff <strong>Sozialisation</strong> bezeichnet einen Vorgang, der aus<br />
unendlich vielen Einzelereignissen zusammengesetzt<br />
ist, die sich unmöglich nur einem einzigen, z.B. dem<br />
„pädagogischen" Handlungssystem und -Feld zuordnen<br />
lassen. <strong>Sozialisation</strong> ist vielmehr allgegenwärtig und<br />
beinhaltet alle prozessualen Zusammenhänge, durch die<br />
der zunächst nur „biologisch" geborene Mensch<br />
allmählich zu einem Mitglied seiner ihn umgebenden<br />
Gruppe und Gesellschaft wird, eben zur<br />
sozial-kulturellen Person. Von daher lässt sich<br />
<strong>Sozialisation</strong> auch mit „Vergesellschaftung der<br />
menschlichen Natur" (Hurrelmann 1976: 15)<br />
umschreiben.<br />
Die - biologisch gesehen - „defizitäre" Ausstattung des<br />
„Mängelwesens" Mensch (Gehlen 1961 ) erweist sich<br />
damit gerade aufgrund ihres „Nicht- festgelegt- Seins"<br />
als eine positive, den Menschen auszeichnende<br />
Voraussetzung zu einer fast unendlichen Lernfähigkeit<br />
und sozial-kulturellen Variabilität. So ist der Mensch<br />
,,Nesthocker" und „Nestflüchter" zugleich, -ein<br />
„hilfloser Nestflüchter" (Portmann 1969)', der zunächst<br />
auf intensive Pflege und ständige Zuwendung durch<br />
seine soziale Umwelt angewiesen .ist, aber andererseits<br />
infolge seiner entwickelten Sinnesorgane und der damit<br />
korrespondierenden Weltoffenheit und<br />
Entscheidungsfreiheit sich verschiedenen kulturellen<br />
Umgebungen und gesellschaftlichen Alternativen<br />
anpassen kann bzw. dieselben auch nach seinen<br />
Wünschen und Bedürfnissen umzugestalten in der Lage<br />
ist, um in ihnen leben zu können. In diesem Sinne kann<br />
der Mensch als zugleich Schöpfer und Geschöpf der<br />
Kultur bezeichnet werden (Landmann 1961, Mühlmann<br />
1962).<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 7