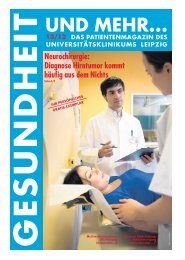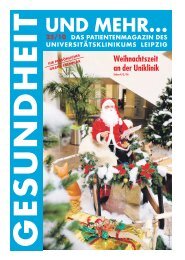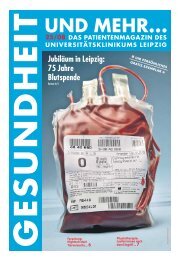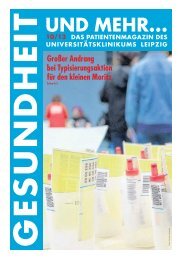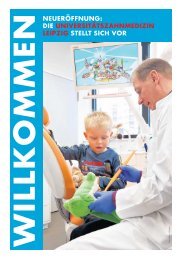als PDF - Universitätsklinikum Leipzig
als PDF - Universitätsklinikum Leipzig
als PDF - Universitätsklinikum Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
UNIVERSITÄTS-LEBEN 11<br />
Ausgabe 6 / 19. März 2010<br />
Gesundheit und mehr...<br />
TEILCHEN<br />
Neue Gefahr für Erbgut entdeckt<br />
<strong>Leipzig</strong>er Forscher messen<br />
erstm<strong>als</strong> die Bindungsenergie<br />
eines Elektrons<br />
in wässriger Lösung und entdecken<br />
dabei einen neuen Mechanismus<br />
für Strahlenschäden<br />
der Erbsubstanz durch<br />
Hochenergiestrahlung. Diese<br />
Entdeckung hat möglicherweise<br />
Auswirkungen auf die Dosierung<br />
der Strahlentherapie<br />
von Krebs. Die Forschungsergebnisse<br />
wurden jetzt in der<br />
Zeitschrift Nature Chemistry<br />
veröffentlicht.<br />
„Lange Zeit hat man angenommen,<br />
dass Strahlungsschäden<br />
der DNA durch Hochenergiestrahlung<br />
wie etwa Röntgenoder<br />
Partikelstrahlung besonders<br />
durch das Auftreten von<br />
sogenannten OH-Radikalen (O<br />
steht für Sauerstoff und H für<br />
Wasserstoff) hervorgerufen<br />
werden. Nun sieht es so aus,<br />
<strong>als</strong> ob ein weiteres Teilchen<br />
aus der Spaltung des Wassers<br />
durch Hochenergiestrahlen<br />
– das teilweise von Wassermolekülen<br />
umgebene Elektron<br />
an Grenzflächen – ein noch viel<br />
gefährlicheres Teilchen für das<br />
Erbgut von Lebewesen ist“,<br />
sagt Prof. Dr. Bernd Abel vom<br />
Wilhelm-Ostwald-Institut für<br />
Physikalische und Theoretische<br />
Chemie der Universität <strong>Leipzig</strong><br />
und Seniorautor des Papers.<br />
„Wenn Hochenergiestrahlung<br />
auf die DNA einer Zelle trifft,<br />
dann kann sie damit gespalten<br />
und zerstört werden, ein Mechanismus<br />
der bei der Radiotherapie<br />
von Krebs ausgenutzt<br />
wird“, erklärt Prof. Abel. „Aber<br />
auch gesunde<br />
Zellen können<br />
durch<br />
Hochenergiestrahlung<br />
geschädigt<br />
werden.“<br />
Zunächst<br />
schädigt die<br />
Primärstrahlung<br />
das Erbgut<br />
durch Ionisation<br />
und<br />
Spaltung. Die<br />
Primärstrahlung<br />
erzeugt<br />
außerdem<br />
eine Reihe<br />
von weiteren<br />
Teilchen – so<br />
zum Beispiel<br />
das teilweise<br />
in Wasser<br />
gelöste Elektron,<br />
das<br />
komplett abgebremste hydratisierte<br />
Elektron in Wasser<br />
und freie Radikale wie das<br />
OH-Radikal, die ebenfalls erbgutschädigend<br />
sind. „Und das<br />
OH-Radikal galt eben bisher<br />
<strong>als</strong> das gefährlichste Teilchen<br />
in diesem Teilchenzoo“ so<br />
Prof. Abel weiter.<br />
Ein gelöstes Elektron – <strong>als</strong> e- dargestellt – ist in der Lage, einen sich in<br />
seiner Nähe befindlichen DNA-Strang zu spalten. Grafik: Uni <strong>Leipzig</strong><br />
Durch die neuen Ergebnisse<br />
der <strong>Leipzig</strong>er Arbeitsgruppe in<br />
Kooperation mit Wissenschaftlern<br />
aus Göttingen und Berlin<br />
konnte gezeigt werden, dass<br />
die Elektronen in Wasser an<br />
Grenzflächen – wie zum Beispiel<br />
an Membranen oder<br />
Grenzflächen von Biomolekülen<br />
– eine besonders schädigende<br />
Wirkung haben können.<br />
Dies liegt an der Bindungsenergie,<br />
die energetisch sehr<br />
günstig für eine Spaltung von<br />
DNA-Strängen ist. Wie die Forscher<br />
zeigen konnten, leben<br />
diese Teilchen<br />
auch besonders<br />
lange, so<br />
dass sich ihre<br />
schädigende<br />
Wirkung besonders<br />
gut<br />
entfalten<br />
kann.<br />
So wurde<br />
nun 45 Jahre<br />
nach der Entdeckung<br />
des<br />
freien gelösten<br />
Elektrons in<br />
Wasser seine<br />
bisher unbekannte<br />
Bindungsenergie<br />
gemessen. Prof.<br />
Dr. Bernd Abel:<br />
„Dass es dabei<br />
auch noch eine<br />
bisher unbekannte<br />
Spezies<br />
gibt – das teilweise gelöste<br />
Elektron an einer Grenzfläche<br />
– ist neu. Seine Existenz und<br />
seine Lebensdauer wurden mit<br />
einer neuen Ultrakurzzeitapparatur<br />
(einer schnellen Kamera<br />
auf der Basis von Lasern für<br />
kurzlebige reaktive Teilchen)<br />
erstmalig aufgenommen.“<br />
„Die nun erstmalig bestimmten<br />
Bindungsenergien und Lebensdauern<br />
von vollständig und<br />
teilweise hydratisierten Elektronen<br />
in Wasser und an Wassergrenzflächen<br />
werden dazu<br />
führen, dass Strahlungsdosen<br />
in der Zukunft möglicherweise<br />
neu bewertet werden müssen<br />
und der neue DNA-Spaltungsmechanismus<br />
mit niederenergetischen<br />
Elektronen in<br />
Wasser könnte möglicherweise<br />
Auswirkungen für die Strahlentherapie<br />
von Krebs haben“,<br />
schlussfolgert Prof. Abel.<br />
Die neuesten Forschungsergebnisse<br />
der <strong>Leipzig</strong>er wurden<br />
in der neuesten Ausgabe der<br />
Zeitschrift Nature Chemisty (7.<br />
März 2010) veröffentlicht: K. R.<br />
Siefermann, Y. Liu, E. Lugovoy,<br />
O. Link, M. Faubel, U. Buck,<br />
B. Winter and B. Abel. Binding<br />
energies, lifetimes and implications<br />
of bulk and interface solvated<br />
electrons in water. Nature<br />
Chemistry. DOI: 10.1038/<br />
NCHEM.580. Diskutiert und<br />
viel gelobt wurde der Beitrag<br />
im gleichen Heft von Daniel M.<br />
Neumark von der University of<br />
California in Berkeley,USA.<br />
Dr. Bärbel Adams<br />
HOCHSCHULRAT<br />
Generalbundesanwältin hat den Vorsitz<br />
Am 4. März 2010 hat sich der<br />
siebenköpfige Hochschulrat der<br />
Universität <strong>Leipzig</strong> konstituiert<br />
und Prof. Monika Harms, Generalbundesanwältin<br />
beim Bundesgerichtshof,<br />
zur Vorsitzenden sowie Prof. Dr. Dr.<br />
h.c. Ernst Th. Rietschel, Präsident der<br />
Leibniz-Gemeinschaft, zum stellvertretenden<br />
Vorsitzenden gewählt.<br />
Der gemäß Paragraph 86 des Sächsischen<br />
Hochschulgesetzes einzurichtende<br />
Hochschulrat ist seit heute Aufsichtsund<br />
Beratungsorgan der Universität.<br />
Er führt die bewährte Funktion des<br />
bisherigen Kuratoriums mit erweiterten<br />
Zuständigkeiten fort und gibt mit<br />
externem sowie internem Sachverstand<br />
der Universität Empfehlungen zur Profilbildung<br />
und Verbesserung ihrer Leistungs-<br />
und Wettbewerbsfähigkeit. Nach<br />
dem Hochschulgesetz obliegt ihm eine<br />
Reihe von Zuständigkeiten, insbesondere<br />
die Genehmigung des Wirtschaftsplanes<br />
der Universität; ferner muss er<br />
der Entwicklungsplanung der Hochschulen<br />
zustimmen. Die Zuständigkeit<br />
für die akademischen Angelegenheiten<br />
verbleibt in erste Linie beim Senat und<br />
Rektorat der Universität.<br />
Der Hochschulrat der Universität <strong>Leipzig</strong><br />
besteht aus sieben Mitgliedern,<br />
davon <strong>als</strong> externe Mitglieder Prof. Dr.<br />
Reinhold R. Grimm (Friedrich-Schiller-<br />
Universität Jena, Lehrstuhl für romanische<br />
Literaturwissenschaft), Professor<br />
Monika Harms (Generalbundesanwältin<br />
beim Bundesgerichtshof), Prof. Dr.<br />
Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel, Präsident<br />
der Leibniz-Gemeinschaft), Dr. Jürgen<br />
Staupe (Staatssekretär im Sächsischen<br />
Der neue Hochschulrat mit der Vorsitzenden Prof. Monika Harms mit dem Rektorat<br />
der Universität <strong>Leipzig</strong> am Gründungstag.<br />
Foto: Uni <strong>Leipzig</strong><br />
Staatsministerium für Kultus und<br />
Sport) und Dr. h.c. Klaus Tschira (Klaus<br />
Tschira Stiftung).<br />
Mitglieder aus der Universität sind<br />
Prof. Dr. Annette G. Beck-Sickinger<br />
(Geschäftsführende Direktorin des Institutes<br />
für Biochemie der Fakultät<br />
für Biowissenschaften, Pharmazie und<br />
Psychologie) sowie Prof. Dr. rer. biol.<br />
hum. habil. Elmar Brähler (Leiter der<br />
Abteilung für Medizinische Psychologie<br />
und Medizinische Soziologie an der<br />
Medizinischen Fakultät).<br />
Die Mitglieder des Hochschulrats hat<br />
das SMWK auf Vorschlag des Senats<br />
und des SMWK berufen. Sie sind in<br />
ihrer Tätigkeit im Hochschulrat unabhängig<br />
und an Weisungen nicht gebunden.<br />
Das Gremium wird mindestens zweimal<br />
im Semester und bei Bedarf tagen. Erste<br />
verantwortliche Aufgabe des Hochschulrates<br />
ist die Mitwirkung bei der<br />
Wahl der Rektorin oder des Rektors:<br />
Auf der Grundlage eines vom Hochschulrat<br />
im Einvernehmen mit dem Senat<br />
erstellten Wahlvorschlages wird der<br />
Erweiterte Senat noch in diesem Jahr<br />
eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger<br />
des bisherigen Rektors wählen.<br />
Dr. Manuela Rutsatz