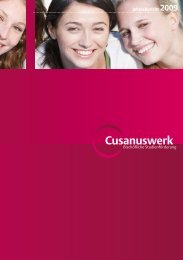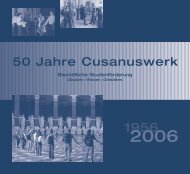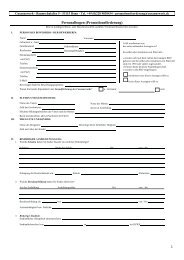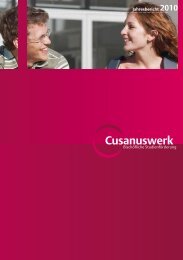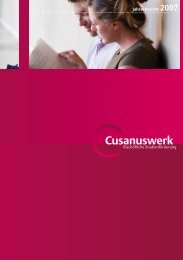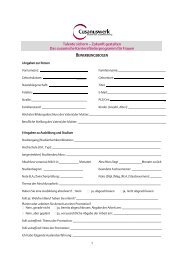Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nistische Regierung in Polen warf der kath.<br />
Kirche „Vaterlandsverrat“ vor, die Bischöfe<br />
der DDR mussten sich vor dem SED-Regime<br />
rechtfertigen und aus der Bevölkerung<br />
in der Bundesrepublik erschollen zahlreiche<br />
kritische Stimmen. Im vergangenen Jahr<br />
äußerten beide Bischofskonferenzen in ihrer<br />
gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag<br />
dieses denkwürdigen Briefwechsels<br />
ihre Besorgnis, dass im Zuge der „Erinnerung<br />
an die finstersten Stunden unserer gemeinsamen<br />
Geschichte“ erneut der „Ungeist<br />
des Aufrechnens“ Einzug halten könnte.<br />
ihre Meinung äußern“ (Dorota Simonides,<br />
Wie es den Polen mit den Deutschen geht?<br />
in: zur debatte 1/2006, 33f). Die volle Achtung<br />
des polnischen Kirche errang dagegen<br />
die bereits am 1. Oktober 1965 von evangelischer<br />
Seite veröffentlichte Erklärung „Die<br />
Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des<br />
deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“,<br />
die sog. Ostdenkschrift der EKD, sowie<br />
das ein paar Monate später in der Akademie<br />
in Bensberg verfasste (und von Joseph<br />
Ratzinger mit unterzeichnete) „Memorandum<br />
der deutschen Katholiken in der Frage<br />
der deutsch-polnischen Verhältnisse“: „Diese<br />
zwei Dokumente wurden in Polen <strong>als</strong> die<br />
wahre Meinung der deutschen Christen betrachtet<br />
und bewirkten eine wesentliche Intensivierung<br />
der deutsch-polnischen Kontakte“<br />
(Dorota Simonides, aaO.).<br />
Aktuelle Konfliktfelder<br />
Andrzej Pagowski, Wir wollen<br />
in der Union leben, 2003<br />
Quelle: http://www.posterpage.<br />
ch/exhib/ex152pag/ex152pag.<br />
htm<br />
Deutsche und Polen dürften ihre geistigen<br />
und materiellen Kräfte jedoch niem<strong>als</strong> wieder<br />
gegeneinander richten, sondern seien<br />
aufgerufen, „sie zum Wohle aller in das zusammenwachsende<br />
Europa einzubringen<br />
und dessen christliche Identität zu stärken“.<br />
Es gehe darum, „unseren Kontinent im<br />
christlichen Sinne auch für die künftigen<br />
Generationen <strong>als</strong> Lebensort zu gestalten, der<br />
die unveräußerliche Würde und die wahre<br />
Freiheit der Menschen achtet und gewährleistet“<br />
(vgl. „40 Jahre deutsch-polnische<br />
Versöhnungsschreiben“, in: Herder Korrespondenz<br />
59 (11/2005), 549-551).<br />
Von polnischer Seite hören wir, dass die<br />
späte Antwort des deutschen Episkopats<br />
nicht wenige katholische Kreise enttäuschte,<br />
weil die Kommunikationsstruktur <strong>als</strong> asymmetrisch<br />
empfunden wurde: „Die polnischen<br />
Bischöfe riskierten mit ihrem Brief<br />
die Freiheit oder sogar ihr Leben, .. die deutschen<br />
Bischöfe dagegen walteten in demokratischen<br />
Verhältnissen und konnten frei<br />
Gerade die im polnischen Wahlkampf<br />
2005 geäußerten abwartenden Aussagen gegenüber<br />
Deutschland wie auch zur Europäischen<br />
Union haben gezeigt, dass die in<br />
den letzten Jahren nicht immer einfachen<br />
deutsch-polnischen Beziehungen mit den<br />
Regierungswechseln in Warschau wie Berlin<br />
wiederum vor neuen Herausforderungen<br />
stehen. Neben dem jüngst veröffentlichten<br />
Geständnis des Danziger Ehrenbürgers<br />
Günter Grass, Mitglied der Waffen-SS gewesen<br />
zu sein, und der aktuellen Ausstellung<br />
„Erzwungene Wege“ im Berliner Kronprinzenpalais,<br />
heißen die Reizthemen vor<br />
allem „Zentrum gegen Vertreibungen“ und<br />
Einforderung von Reparationsleistungen<br />
durch die sog. „Preußische Treuhand“. Ins<br />
Stocken geraten ist darüber auch die von der<br />
ehemaligen Kulturstaatsministerin Christina<br />
Weiss favorisierte und von den Kultusministern<br />
Deutschlands, Polens, der Slowakei<br />
und Ungarns beschlossene Idee des<br />
grenzüberschreitenden Zusammenschlusses<br />
wissenschaftlicher Einrichtungen, Institutionen<br />
und Museen zu einem „Europäischen<br />
Netzwerk Erinnerung und Solidarität“,<br />
um sich dem Thema Vertreibung im<br />
(mittel)europäischen Maßstab zu stellen.<br />
Der Vorschlag von Kulturstaatsminister<br />
Bernd Neumann, die im Bonner Haus der<br />
Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-<br />
12