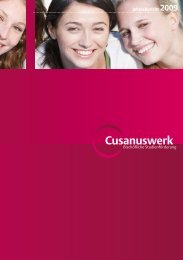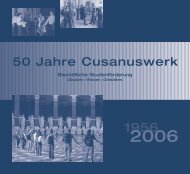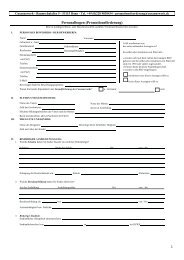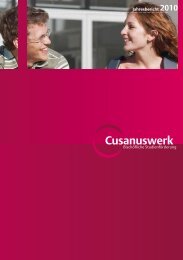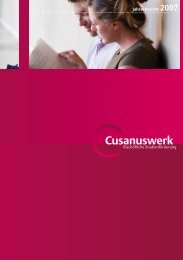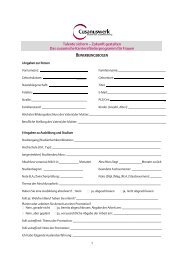Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zungen in Bezug auf die Präambel ausfalten<br />
lassen: Während der Verfassungsvertrag<br />
bewusst auf einen Gottesbezug verzichtet<br />
und lediglich das „kulturelle, religiöse und<br />
humanistische Erbe“ Europas in seiner Präambel<br />
anspricht, ohne das Christentum <strong>als</strong><br />
entscheidenden Bestandteil dieses Erbes<br />
ausdrücklich zu nennen, hat „der polnische<br />
Papst“ Johannes Paul II. Europa unermüdlich<br />
an seine christlichen Wurzeln erinnert<br />
und dazu aufgerufen, den Geist des Evangeliums<br />
auf dem „alten“ Kontinent lebendig<br />
zu halten. Auch sein deutscher Nachfolger<br />
hat nicht nur mit seiner Namenswahl - die<br />
mit Benedikt von Nursia, den Vater des<br />
westlichen Mönchtums und „Patron Europas“,<br />
an eine der prägendsten Gestalten für<br />
die Herausbildung des christlichen Abendlandes<br />
erinnert - vor den Gefährdungen<br />
eines von seinen christlichen Wurzeln abgeschnittenen,<br />
in seiner kulturell-religiösen<br />
Identität beschädigten Europas gewarnt.<br />
Nach der jüngsten Audienz der (protestantischen)<br />
Bundeskanzlerin in Castel Gandolfo<br />
scheint eine Annäherung zwischen<br />
deutschen, polnischen wie vatikanischen<br />
Positionen jedochnicht mehr gänzlich ausgeschlossen<br />
zu sein.<br />
Auch wenn die katholische Christenheit<br />
in Europa keinen geschlossenen Block<br />
darstellt (in Deutschland hat das Christentum<br />
traditionell eine konfessionelle Doppelstruktur,<br />
während der Katholizismus in Polen<br />
stark durch die Verbindung zur Nation<br />
charakterisiert ist) und es eine konfessionsübergreifend<br />
christliche Position zu Europa<br />
nicht gibt, so dass die europäische Dimension<br />
des gemeinsamen Christ- wie Kirche-<br />
Seins beim „Durchschnittsgläubigen“ (viel<br />
zu) wenig im Blick ist, so lassen sich doch<br />
einige Charakteristika christlichen Engagements<br />
für Europa herausstreichen: Weil<br />
christliche Kreise im Westen während des<br />
Kalten Krieges stets Kontakte mit den Kirchen<br />
im östlichen Teil Europas gepflegt haben,<br />
scheinen sie jetzt geradezu prädestiniert<br />
zu sein, Ressentiments gegen die 2004 erfolgte<br />
Erweiterung der Europäischen Union<br />
entgegenzutreten, und dafür zu werben,<br />
die neuen Mitgliedsstaaten nicht <strong>als</strong> lästige<br />
Konkurrenten, sondern <strong>als</strong> kulturelle Bereicherung<br />
wahrzunehmen (vgl. dazu auch<br />
die „Einladung zur Reflexion“ über „Das<br />
Werden der Europäischen Union und die<br />
Verantwortung der Katholiken“ der Kommission<br />
der Bischofskonferenzen der Europäischen<br />
Gemeinschaft, COMECE, vom 9.<br />
Mai 2005). Der Ausbau der ökumenischen<br />
Zusammenarbeit ist eine gerade wegen der<br />
nationalen Prägung vieler Kirchen schwierige,<br />
aber auf europäischer Ebene überaus<br />
wichtige Aufgabe der Zukunft. Und<br />
schließlich: Christen sind aus ihrem Glauben<br />
heraus in besonderer Weise dazu aufgefordert,<br />
für Freiheit, Gleichheit, Solidarität<br />
- und somit für die (gerade auch europaweite)<br />
Achtung der Grundrechte - einzutreten,<br />
so wie auch der Entwurf für den Verfassungsvertrag<br />
die Charta der Grundrechte<br />
enthält, die mit dem Bekenntnis zur Unantastbarkeit<br />
der Würde des Menschen beginnt<br />
und das Recht auf Gedankens-, Gewissens-<br />
und Religionsfreiheit garantiert.<br />
Wie Christen konkret politisch agieren,<br />
hängt jedoch vor allem von der jeweiligen<br />
politischen Konstellation ihres Landes ab,<br />
denn aus dem Evangelium lässt sich „keine<br />
Blaupause für ein christlich inspiriertes<br />
Europa ableiten, und auch der Rückgriff auf<br />
die Geschichte des Christentums in Europa<br />
liefert kein Modell, an dem man sich heute<br />
orientieren könnte“ (Ulrich Ruh, Europa<br />
und die Christen, in: Herder Korrespondenz<br />
59 (7/2005), 325-327).<br />
Zur kirchlichen Situation<br />
Für die katholische Kirche in Polen bedeutete<br />
der Tod von Papst Johannes Paul II.<br />
im April 2005 einen epochalen Einschnitt,<br />
versetzte das ganze Land zunächst in einen<br />
Ausnahmezustand. War man bislang daran<br />
gewöhnt, in Rom über eine Führungsfigur<br />
von unbestrittener Autorität zu verfügen,<br />
die sich - wie beispielsweise 2003 beim Referendum<br />
über den Beitritt zur Europäischen<br />
Union - immer wieder auch in innerpolnische<br />
Auseinandersetzungen einmischte,<br />
fühlt sich die katholische Kirche nach dem<br />
Tod des „größten Polen aller Zeiten“ geradezu<br />
verwaist. Vor allem junge und jetzt studierende<br />
Gläubige empfanden dies auch <strong>als</strong><br />
eine persönliche Zäsur in ihrem Leben.<br />
Auch in der jetzigen politischen wie<br />
kirchlichen Situation, da keiner der pol-<br />
14