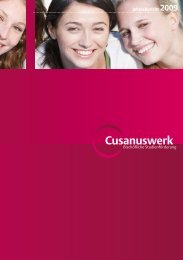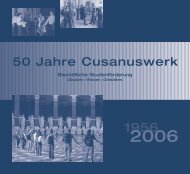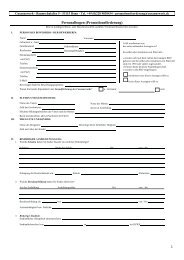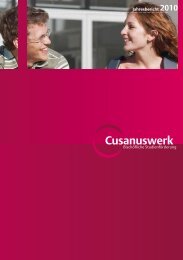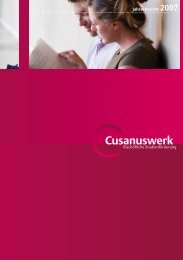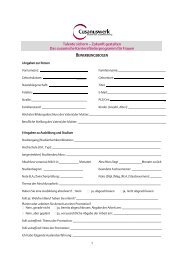Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeit ein - von Deutschen - besetztes Land<br />
war.<br />
Die zeitliche Koinzidenz der Debatten<br />
um Jedwabne mit der um das „Zentrum<br />
gegen Vertreibungen“ sowie der mit beiden<br />
verbundene rasante Perspektivwechsel zwischen<br />
Opfer und Täter rief bei vielen Polen<br />
jedoch auch Schutz- und Abwehrreflexe<br />
hervor. Vor diesem Hintergrund steht denn<br />
auch der Verdacht der Geschichtsrevision im<br />
Raum, wenn in Deutschland die privaten<br />
Erzählungen über Bombenopfer, Vertriebene<br />
und einzelne Soldatenschicksale in den<br />
öffentlichen Diskurs treten - so wie es Ralf<br />
Rothmann in seinem Nach-Wende-Roman<br />
„Hitze“ in einem Dialog der (polnischen)<br />
Protagonistin Lucilla mit ihrem (deutschen)<br />
Liebhaber DeLoo verdichtet:<br />
„‘Apropos. Mein Vater ist mal hiergewesen.<br />
Als Soldat. Er konnte sogar ein bißchen<br />
die Sprache, liebte polnische Gedichte.‘ ‚Ach<br />
Gott‘, sagte sie durch den Rauch. ‚Ein schöngeistiger<br />
Nazi?‘ DeLoo beugte sich vor, wischte<br />
ihr etwas Tabak vom Schoß. ‚Er war Soldat,<br />
kein Nazi. Er ist hier verwundet worden.‘<br />
Sie grunzte leise. ‚Unschuldig, klar. Wie alle.‘<br />
‚Nein. Schuldig führte er sich schon. Aber das<br />
hatte andere Gründe, eher persönliche“.<br />
Ist es angesichts dieser Gemengelage überhaupt<br />
denkbar, dass Deutsche und Polen zu<br />
einem verbindenden historischen Gedenken<br />
finden? Werden sich die durch unterschiedliche<br />
Erfahrungen und Erinnerungen so verschieden<br />
geprägten historischen Identitäten<br />
nicht immer wieder trennend zwischen Polen<br />
und Deutsche stellen, ganz gleich wie die<br />
Konstellationen zwischen Gastgebern und<br />
Gästen auch beschaffen sein mögen? Mit Johannes<br />
Paul II. gefragt: „Wo liegt die Wasserscheide<br />
zwischen Generationen, die nicht<br />
genug bezahlt haben, und Generationen, die<br />
zu viel bezahlt haben? Wir, auf welcher Seite<br />
stehen wir?“ (Erinnerung und Identität. Gespräche<br />
an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden,<br />
Augsburg 2005, 100).<br />
Der Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen<br />
Zeitung macht darauf aufmerksam,<br />
dass wir es bei dem Streit zwischen<br />
Deutschen und Polen mit zwei Anliegen zu<br />
tun bekommen, von denen jede Seite sagt,<br />
wie moralisch berechtigt das ihre ist. „Die<br />
Vertriebenen und ihre Unterstützer sagen,<br />
wir wollen gewürdigt sehen, dass wir, diejenigen,<br />
die aus den Gebieten östlich von<br />
Oder und Neiße vertrieben worden sind, einen<br />
höheren Preis für den Krieg gezahlt haben,<br />
den natürlich alle Deutschen in ihrer<br />
Gesamtheit zu verantworten haben, <strong>als</strong> diejenigen,<br />
die nach dem Krieg das Glück hatten,<br />
in der britischen oder amerikanischen,<br />
<strong>als</strong>o in den Westzonen zu sein. Von polnischer<br />
Seite sagt man nun, und das ist genauso<br />
ein berechtigtes Anliegen: Wir waren<br />
im Krieg die Opfer. Es ist richtig, dass es<br />
die Vertreibung gab. Es ist auch richtig, dass<br />
es nach dem Krieg die Verdrängungspolitik<br />
Warschaus gab, die sicherlich auch den Tod<br />
vieler Betroffener in Kauf genommen hat.<br />
Aber es war keine Vernichtungspolitik wie<br />
die deutsche Politik während des Krieges in<br />
Polen. .. Wir haben das Problem, dass die<br />
polnische Argumentation bzw. die Hauptargumente<br />
auf deutscher Seite entweder nicht<br />
verstanden oder nicht akzeptiert werden“<br />
(Thomas Urban, Neue politische Aufbrüche<br />
in Polen, in: zur debatte 1/2006, 36f).<br />
Polen kennen lernen<br />
Mehr <strong>als</strong> sechs Jahrzehnte nach<br />
Kriegsende, 15 Jahre nach Inkrafttreten des<br />
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags<br />
und im dritten Jahr engster Nachbarschaft<br />
innerhalb der Europäischen Union unternimmt<br />
das Europäische Doktorandenkolloquium<br />
„Erinnerung und Identität“ den<br />
Versuch, national ausgesprochen unterschiedlich<br />
geprägte Memorialkulturen mit<br />
Konzeptionen gemeinsamer anamnetischer<br />
Vergegenwärtigung in das Gespräch zwischen<br />
deutschen und polnischen Studierenden<br />
wie Promovierenden zu bringen.<br />
Für die deutschen Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer bedeutet eine solche Bildungsveranstaltung,<br />
sich dem polnischen<br />
Geschichts- wie Selbstverständnis zu stellen.<br />
Die (deutsche) Koordinatorin für die<br />
deutsch-polnische Zusammenarbeit empfiehlt<br />
dazu, „den polnischen Sinn für Freiheit<br />
und Würde - traditionsreiche europäische<br />
Werte! - aus der polnischen Geschichte<br />
16