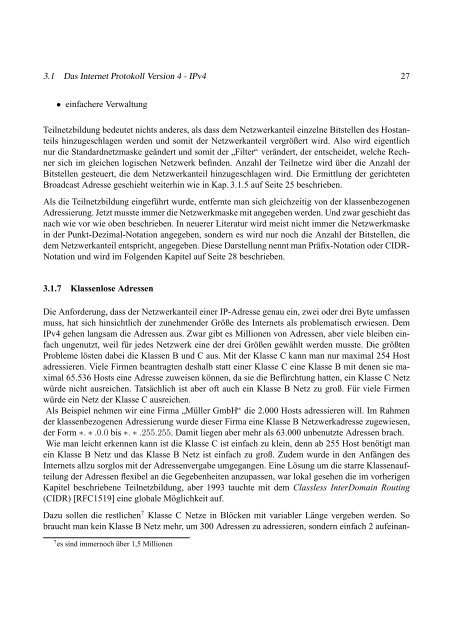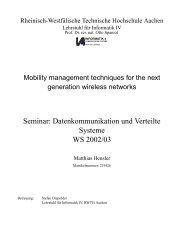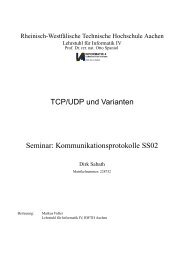IPv4 und IPv6 - Informatik 4
IPv4 und IPv6 - Informatik 4
IPv4 und IPv6 - Informatik 4
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3.1 Das Internet Protokoll Version 4 - <strong>IPv4</strong> 27<br />
• einfachere Verwaltung<br />
Teilnetzbildung bedeutet nichts anderes, als dass dem Netzwerkanteil einzelne Bitstellen des Hostanteils<br />
hinzugeschlagen werden <strong>und</strong> somit der Netzwerkanteil vergrößert wird. Also wird eigentlich<br />
nur die Standardnetzmaske geändert <strong>und</strong> somit der ”<br />
Filter“ verändert, der entscheidet, welche Rechner<br />
sich im gleichen logischen Netzwerk befinden. Anzahl der Teilnetze wird über die Anzahl der<br />
Bitstellen gesteuert, die dem Netzwerkanteil hinzugeschlagen wird. Die Ermittlung der gerichteten<br />
Broadcast Adresse geschieht weiterhin wie in Kap. 3.1.5 auf Seite 25 beschrieben.<br />
Als die Teilnetzbildung eingeführt wurde, entfernte man sich gleichzeitig von der klassenbezogenen<br />
Adressierung. Jetzt musste immer die Netzwerkmaske mit angegeben werden. Und zwar geschieht das<br />
nach wie vor wie oben beschrieben. In neuerer Literatur wird meist nicht immer die Netzwerkmaske<br />
in der Punkt-Dezimal-Notation angegeben, sondern es wird nur noch die Anzahl der Bitstellen, die<br />
dem Netzwerkanteil entspricht, angegeben. Diese Darstellung nennt man Präfix-Notation oder CIDR-<br />
Notation <strong>und</strong> wird im Folgenden Kapitel auf Seite 28 beschrieben.<br />
3.1.7 Klassenlose Adressen<br />
Die Anforderung, dass der Netzwerkanteil einer IP-Adresse genau ein, zwei oder drei Byte umfassen<br />
muss, hat sich hinsichtlich der zunehmender Größe des Internets als problematisch erwiesen. Dem<br />
<strong>IPv4</strong> gehen langsam die Adressen aus. Zwar gibt es Millionen von Adressen, aber viele bleiben einfach<br />
ungenutzt, weil für jedes Netzwerk eine der drei Größen gewählt werden musste. Die größten<br />
Probleme lösten dabei die Klassen B <strong>und</strong> C aus. Mit der Klasse C kann man nur maximal 254 Host<br />
adressieren. Viele Firmen beantragten deshalb statt einer Klasse C eine Klasse B mit denen sie maximal<br />
65.536 Hosts eine Adresse zuweisen können, da sie die Befürchtung hatten, ein Klasse C Netz<br />
würde nicht ausreichen. Tatsächlich ist aber oft auch ein Klasse B Netz zu groß. Für viele Firmen<br />
würde ein Netz der Klasse C ausreichen.<br />
Als Beispiel nehmen wir eine Firma ”<br />
Müller GmbH“ die 2.000 Hosts adressieren will. Im Rahmen<br />
der klassenbezogenen Adressierung wurde dieser Firma eine Klasse B Netzwerkadresse zugewiesen,<br />
der Form ∗. ∗ .0.0 bis ∗. ∗ .255.255. Damit liegen aber mehr als 63.000 unbenutzte Adressen brach.<br />
Wie man leicht erkennen kann ist die Klasse C ist einfach zu klein, denn ab 255 Host benötigt man<br />
ein Klasse B Netz <strong>und</strong> das Klasse B Netz ist einfach zu groß. Zudem wurde in den Anfängen des<br />
Internets allzu sorglos mit der Adressenvergabe umgegangen. Eine Lösung um die starre Klassenaufteilung<br />
der Adressen flexibel an die Gegebenheiten anzupassen, war lokal gesehen die im vorherigen<br />
Kapitel beschriebene Teilnetzbildung, aber 1993 tauchte mit dem Classless InterDomain Routing<br />
(CIDR) [RFC1519] eine globale Möglichkeit auf.<br />
Dazu sollen die restlichen 7 Klasse C Netze in Blöcken mit variabler Länge vergeben werden. So<br />
braucht man kein Klasse B Netz mehr, um 300 Adressen zu adressieren, sondern einfach 2 aufeinan-<br />
7 es sind immernoch über 1,5 Millionen