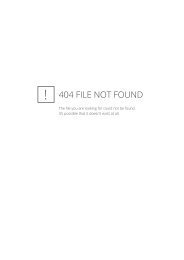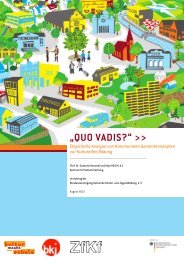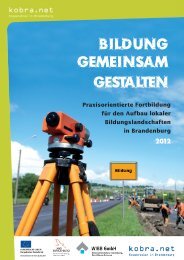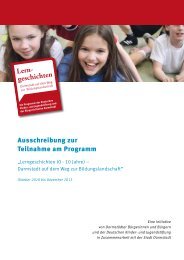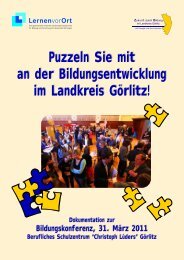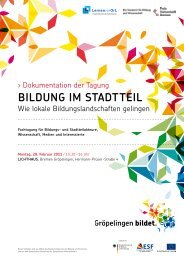Lokale Verantwortungsgemeinschaften für Bildung - Deutsche ...
Lokale Verantwortungsgemeinschaften für Bildung - Deutsche ...
Lokale Verantwortungsgemeinschaften für Bildung - Deutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
36<br />
aussehen muss als auf der Ebene von Ministerialbürokratien, Schulaufsicht,<br />
Schulträgern und verschiedensten Arten von sonstigen Trägern.<br />
In beiden Dimensionen braucht man so etwas wie einen Übersetzungsmechanismus,<br />
der Kooperationen, verschiedene Logiken sowie Interessen<br />
vermittelt und moderiert.<br />
Noch einmal die Frage zu dem Charakter von Kooperation. Sie haben Begriffe<br />
verwendet wie Dienstleister und Kunde. Ist das die richtige Sprache,<br />
wenn wir über integrative Modelle nachdenken und über eine sich<br />
ändernde Haltung<br />
Dr. Günter Warsewa:<br />
Wir finden in unserem <strong>Bildung</strong>ssystem und in den angelagerten und<br />
benachbarten Einrichtungen immer noch so etwas wie ein Behördenverständnis<br />
und wenn man übergehen könnte zu einem Verständnis<br />
von Kunden und von Dienstleistungen, dann wäre das ein Fortschritt.<br />
Dass wir darüber hinaus noch eine weitere Perspektive brauchen, die<br />
dann so etwas wie kooperatives Verständnis abbildet, da sind wir uns<br />
völlig einig. Wenn man tatsächlich ernsthaft Schulen zu Stadtteilangelegenheiten<br />
machen will, dann muss man über Schulangelegenheiten<br />
im Stadtteil diskutieren, entscheiden können. Das bedeutet, dass die<br />
verschiedenen Interessen, Stakeholder auf eine Art und Weise beteiligt<br />
werden, die nicht einem Bild vom Kunden, sondern einem Verständnis<br />
entspricht, sie als Mitglieder eines Netzwerkes gleichberechtigt an<br />
den Entscheidungen und an den Angelegenheiten teilhaben zu lassen.<br />
Wir wissen, wie schwierig es ist, ernsthafte Teilhabe in einer Schule herzustellen.<br />
Wie schwer muss es sein, wenn man ein gesamtes System auf der<br />
Grundlage von Teilhabe sehen möchte. Treffen Begriffe wie „Kunde“ oder<br />
„Dienstleistung“ das Verhältnis von Bürgern und den Institutionen, wenn<br />
es um Teilhabe und Partizipation geht Und wie kann es gelingen, Teilhabe<br />
nicht nur in einem Mikrokosmos Wirklichkeit werden zu lassen, sondern<br />
systematisch in einem größeren Kontext<br />
Prof. Dr. Sturzenhecker, Universität Hamburg<br />
Es geht nicht um Kunden und Dienstleistung, sondern um Bürgerinnen<br />
und Bürger, die gemeinsam entscheiden, wie <strong>Bildung</strong> in einer Kommune<br />
stattfinden soll, und zu denen gehören auch Kinder und Jugendliche.<br />
Der Skandal besteht darin, dass wir eine politische Entscheidungskultur<br />
haben, die viele Gruppierungen von Bürgerinnen und Bürgern<br />
ausgrenzt, die nämlich die Differenz der Bürger, das heißt auch die Differenz<br />
der Kinder und Jugendlichen nicht zur Kenntnis nimmt. Deshalb<br />
ist die erste Forderung aus Sicht von Kindern und Jugendlichen, Partizipation<br />
muss differenzgerecht sein, sie muss unterschiedliche Leute und<br />
„Kulturen“ unterstützen, sich auf ihre Weise beteiligen zu können. Saalfeld<br />
hatte ein super Projekt, wo die Kids die Wände in der Schule gesprayt<br />
haben. Dieses Projekt ist aber nicht in einem für sie greifbaren<br />
kommunikativen Kontakt zu seiner Umwelt: Die Kids, die sprayen, wissen<br />
gar nicht, was der Rat der Stadt damit zu tun hat. Sie bleiben isoliert<br />
und haben vielleicht eine Spaßinsel, aber kein Mitentscheidungsnetzwerk<br />
erfahren. Ich glaube, die Gestaltung von <strong>Bildung</strong>slandschaften<br />
wird nur funktionieren, wenn Kommunikationskanäle zwischen unterschiedlichen<br />
Betroffenen hergestellt werden. Partizipation muss Entscheidungsbeteiligung<br />
von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen<br />
Kommunikationsweisen eröffnen.<br />
Wie kann man in <strong>Bildung</strong>slandschaften den Reflexionsraum für Zielgruppen,<br />
die Sie im Auge haben, größer machen<br />
Prof. Dr. Sturzenhecker:<br />
Für die Kids erscheint doch alles erst einmal wie eine super Animation.<br />
Aber wie die Events in Entscheidungsprozesse eingebunden sind, das<br />
erklärt niemand, das wird nicht greifbar. Es ist ein kommunaler Raum,<br />
im Sinne eines gemeinsamen Raums der Aushandlung herzustellen und<br />
dazu muss man die Leute kennenlernen, die mitentscheiden, die einem<br />
erklären, wer sie sind, wie man mit ihnen in Austausch und Diskussion<br />
kommen kann. Es dürfte kein Projekt geben, das nicht gleichzeitig in<br />
einem Netzwerk stattfindet, unterschiedliche Betroffene einbezieht und<br />
ihnen seine Einbindung in Entscheidungsstrukturen deutlich macht.<br />
Welche Brücken brauchen wir vom engeren <strong>Bildung</strong>skontext hin zur Stadtentwicklung<br />
Brauchen wir eine differenzgerechte Stadtentwicklung<br />
Prof. Dr. Häußermann, Humboldt-Universität zu Berlin:<br />
Die beiden Projekte in unserem Forum, Bernburg im Salzlandkreis und<br />
Hamburg-Harburg, waren Beispiele dafür, wie man Stadtentwicklung<br />
und die Entwicklung einer <strong>Bildung</strong>slandschaft verknüpft. Im Campus<br />
Technicus in Bernburg werden drei Sekundarschulen vereint in eine<br />
Schule. Da wird baulich geplant und ergänzt und das ist die Verknüpfung<br />
von Schul- und Stadtentwicklung. Hinzu kommt - und das finde<br />
ich besonders wichtig -, dass diese Entwicklung mit einem inhaltlichen<br />
Neustart verbunden ist, dass zurzeit eine neue Konzeption entwickelt<br />
oder schon erprobt wird. Ein wesentlicher Aspekt in beiden Fällen ist<br />
die räumliche Konzentration, die inhaltliche Integration, die Entwicklung<br />
von neuen Vorstellungen zur Ganztagsbildung, die Öffnung der<br />
<strong>Bildung</strong>seinrichtung zur Stadt, die Vernetzung mit Bibliotheken und<br />
Musikschulen. In den Praxisbeispielen handelt es sich um Regionen,<br />
in denen der Anteil von Kindern aus bildungsfernen Schichten relativ<br />
hoch ist. Deshalb ist es umso wichtiger, sie nicht nur zu beschulen, sondern<br />
individuell zu fördern.