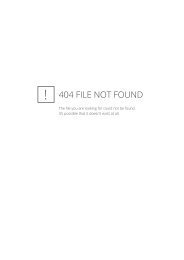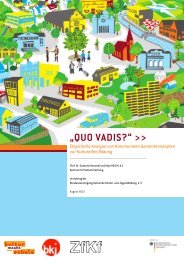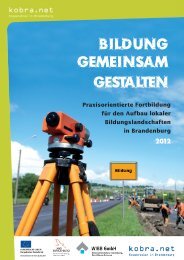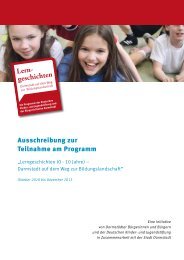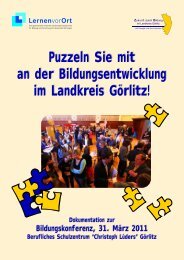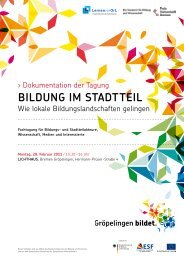Lokale Verantwortungsgemeinschaften für Bildung - Deutsche ...
Lokale Verantwortungsgemeinschaften für Bildung - Deutsche ...
Lokale Verantwortungsgemeinschaften für Bildung - Deutsche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
D Ausblick<br />
Dr. Bernd Ebersold<br />
Geschäftsführer der Jacobs Foundation<br />
Bei dem folgenden Text handelt es sich um die Transkription<br />
des Vortrags von Dr. Ebersold zum Abschluss des Fachtags.<br />
38<br />
Ich bin gebeten worden, der Veranstaltung einen Ausblick zu geben.<br />
Ausblick lässt mich an den Begriff Teichoskopie, aus dem Griechischen<br />
„Mauerschau“, denken, einem Mittel des antiken Dramas, das dazu<br />
dient, schwer darstellbare Ereignisse dem Zuschauer dadurch nahezubringen,<br />
dass ein Schauspieler sie schildert, als sähe er sie außerhalb der<br />
Bühne vor sich gehen. Also von einer Mauer oder einem Turm zu gucken<br />
und Ausschau zu halten. So habe ich mich heute gefühlt und nicht<br />
auf erhobenem Podest auf Sie, sondern in die Veranstaltung geblickt<br />
und eine gewisse Streitkultur erlebt.<br />
Streiten – im Sinne von Benedikt Sturzenhecker – ist ein produktiver<br />
Prozess. Ich fand es interessant, dass Diskurse insbesondere in unserem<br />
Workshop stattfanden und diese will ich aus Sicht eines Stiftungsvertreters,<br />
der ja Teil des Streites und dieser Streitkultur ist, pointierter<br />
zusammenfassen. Die Stiftungsdenke, das Visionäre kommt in dem<br />
Programm „Lebenswelt Schule“, der Vernetzung lokaler Akteure und<br />
Ressourcen für die individuelle Förderung von Kindern zum Ausdruck.<br />
Das ist fast so kompliziert wie die Lösung der Finanzmarktkrise.<br />
In „Lebenswelt Schule“ sind viele Dimensionen gebündelt, für die<br />
man eine Vision benötigt, die implizit der Zivilgesellschaft unterstellt<br />
wird; eine solche trägt die Stiftung in ihrem Herzen. Wir sind Visionäre,<br />
aber wir machen es uns viel zu leicht, denn wir reden über soziale<br />
Phänomene, über Komplexitäten, die wir eigentlich nicht verstehen,<br />
für die wir jedoch schon Lösungsansätze haben. Das kommt in Sätzen<br />
zum Ausdruck: Wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen, wer die Beteiligten<br />
sind und was wir eigentlich tun wollen. Demgegenüber war der<br />
erste Vortrag herzerfrischend, der mich zu zwei Methoden inspiriert,<br />
wie man einen rationalen Diskurs immer gewinnt. Die erste Möglichkeit<br />
ist, man redet pointiert und lässt anschließend keine Diskussion zu,<br />
die zweite besteht darin, den Abschlussvortrag zu halten. Nach diesem<br />
kommt nämlich auch keine Diskussion zustande und diese Gelegenheit<br />
nutze ich jetzt.<br />
In der Zivilgesellschaft ist Aktivitätspotenzial für das Visionäre vorhanden.<br />
Viele von Ihnen engagieren sich in ihr und erfahren Mut. Demgegenüber<br />
kontrastiert ein Sinn für Realität, für reale Probleme. Visionen<br />
hier und Ressourcen dort, wie es in den Vorträgen zu hören war, nicht<br />
nur finanzielle, sondern auch personelle Ressourcen, irgendwie passt<br />
das scheinbar nicht zusammen. Ich habe dafür vielleicht einen Lösungsansatz<br />
aus Stiftungssicht. Erstens, Stiftungen wollen immer mehr, als sie<br />
können und eigentlich müssten wir darüber reden, was wir wollen/sollen.<br />
Zweitens, das ist auch in Deutschland weit verbreitet, diskutieren<br />
wir Visionen und Rationalität, reale Befindlichkeiten und Zielvorstellungen<br />
fast immer dichotomisch. Ich glaube, es ist notwendig, den Mut<br />
zu Visionen weiterhin aufrechtzuerhalten. Wir müssen an die Front gehen,<br />
dort mit zivilgesellschaftlichem Engagement kämpfen, bei Anerkennung<br />
der Realitäten. Wir müssen akzeptieren, dass wirtschaftliche<br />
Krisenzeiten so sind, wie sie sind, und dass bildungspolitische Ideale<br />
bei den Anforderungen der Finanzmarktkrise ein wenig auf der Strecke<br />
bleiben können. Man kann das aber auch positiver formulieren.<br />
Wenn man den Begriff Zivilgesellschaft aufgeben und klassisch von<br />
Bürgergesellschaft reden würde, wäre schon etwas gewonnen. Zivil, das<br />
klingt toll, weil es sich nicht interessengebunden anhört. Die Bürgergesellschaft<br />
dagegen, das habe ich von Ralf Dahrendorf erfahren und<br />
als Quelle notiert, ist zunächst einmal dadurch gekennzeichnet, dass sie<br />
interessengeleitet und in der Regel auch interessendivergent ist. Diese<br />
Erkenntnis hat den Vorteil, dass wir nicht immer nur den Staat anprangern<br />
müssen und sagen: Das ist eigentlich etwas anderes als Zivilgesellschaft.<br />
Wenn wir im politischen Willensbildungsprozess das visionäre,<br />
zivilgesellschaftliche, bürgergesellschaftliche Tun, die Praxis und<br />
die Realität nicht außer Acht lassen, sondern uns als Teil dieses Prozesses<br />
der Willensbildung verstehen, die eine langfristige Vision und<br />
Veränderung der Gesellschaft zum Besseren nicht vergisst, dann ist das<br />
die Klammer, die einen guten Ausblick bietet.<br />
Noch ein Hinweis: Ich empfinde es als positiv, dass die Bundesregierung<br />
480 Milliarden Bürgschaften für den Bankensektor und den zusammencrashenden<br />
Bereich bereitstellt. Warum Es sollte uns Mut machen,<br />
weil die Finanzmarktkrise und ihre Behandlung in der Politik auch für<br />
den <strong>Bildung</strong>sbereich zeigt, dass Politik, wenn ein politisch, gesellschaftlich<br />
relevantes Problem, und um ein solches handelt es sich, auftritt,<br />
per se handlungsfähig ist. Ob sie im richtigen Sinne handlungsfähig ist<br />
und die Richtung stimmt, das kann ich nicht beurteilen, in diesem Bereich<br />
bin ich kein Experte, aber zunächst einmal ist sie handlungsfähig.<br />
Leidens-, Entscheidungs- und Problemdruck sind zumindest eine<br />
politische Kategorie, auf die Politik hört. Der zweite positive Ansatz ist<br />
der, dass Politik reagiert, weil die Bürgergesellschaft ihr zutraut, dass es<br />
sich um ein Problemfeld handelt, das solche Einschnitte und finanziellen<br />
Umschichtungen tatsächlich notwendig macht.<br />
Wenn der <strong>Bildung</strong>s- oder Forschungssektor, aus dem ich ursprünglich<br />
herkomme, begreift, dass er in diese Richtung die Problemfelder,<br />
den Leidensdruck richtig adressiert und sich im Rahmen der bürgergesellschaftlichen<br />
Engagements als Teil des politischen Willensbildungsprozesses<br />
versteht, dann hat man die Hoffnung, dass es einen sozialen<br />
Wandel geben wird. Ansonsten brechen bürgergesellschaftliches Engagement<br />
und Realität wieder auseinander. Ich fand beeindruckend, dass<br />
beides in dieser Veranstaltung dicht beieinander lag und nicht strittig,<br />
sondern in einem rationalen Diskurs ausgetragen wurde. Vielen herzlichen<br />
Dank, der Fachtag war ein Gewinn für mich.