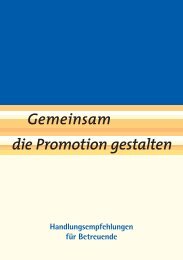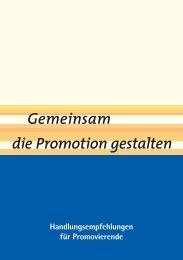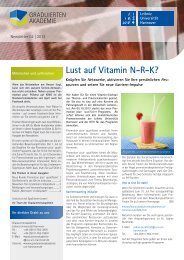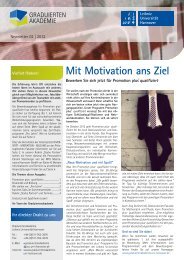Ergebnisbericht zur strukturierten Doktorandenausbildung
Ergebnisbericht zur strukturierten Doktorandenausbildung
Ergebnisbericht zur strukturierten Doktorandenausbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
(§4(2) PO), häufig in enger Kooperation mit benachbarten Gruppen. Diese individuelle<br />
Nachwuchsförderung als Qualifikationsphase für die besten Absolventen des Faches<br />
repräsentiert die bewährte Promotionskultur der Fakultät; sie zeichnet sich durch die<br />
enge, von Verantwortung getragene Betreuung der Promovenden durch Doktorvater/-<br />
mutter aus, gewährleistet eine straffe und auf das jeweilige Berufsfeld ausgerichtete<br />
Promotion und soll als Erfolgsmodell auch künftig gepflegt werden: Immerhin schließt<br />
die Naturwissenschaftliche Fakultät jedes Jahr über 100 Promotionsverfahren auf diese<br />
Weise ab. Jedoch wird eine strukturierte und institutionalisierte Ausgestaltung der <strong>Doktorandenausbildung</strong>,<br />
wie sie z. B. in den Graduiertenkollegs der DFG praktiziert wird,<br />
geeignet sein, zukunftsorientierte Ansprüche an eine Sicherung der Qualität der Ausbildung<br />
auch im Fortgeschrittenenbereich zu erfüllen.<br />
Definierte Verantwortlichkeiten<br />
Die betreuende Person stellt gemeinsam mit der/dem Doktorandin/en einen Arbeitsplan<br />
mit transparenten Arbeitszielen („Meilensteine“) für das Promotionsvorhaben auf, der<br />
für beide Seiten verbindlich ist (Basis §4(1) PO). Dieser Arbeitsplan ist regelmäßig zu<br />
aktualisieren. Die betreuende Person motiviert die/den Doktorandin/den, an ausgewählten<br />
Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen und die eigenen Forschungsergebnisse<br />
zu publizieren. Sie wirkt darauf hin, dass die jeweilige Promotion in adäquater<br />
Zeit abgeschlossen und bewertet werden kann.<br />
Regelmäßige Fortschrittsbesprechungen<br />
Betreuer und Doktorand treffen sich (über die Institutskolloquien hinaus) in regelmäßigem<br />
Abstand, um das Protokoll zu besprechen, welches die geleistete Arbeit und den<br />
aktuellen Stand im Forschungsplan dokumentiert. So entsteht auf Doktorandenseite<br />
eine Routine, über die eigenen Versuche frühzeitig und regelmäßig zu reflektieren, und<br />
für den Betreuer wird der Fortschritt transparenter.<br />
Förderung des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen<br />
Die betreuende Person unterstützt die Integration in das wissenschaftliche Umfeld z. B.<br />
durch das Fördern der Teilnahme von Promovenden an Tagungen, Sommerschulen<br />
oder workshops der jeweiligen Fachgebiete ideell und finanziell. Die Doktoranden sollen<br />
ihre Forschungsergebnisse selbst präsentieren. Zur Vorbereitung diskutieren sie<br />
ihre Präsentationen im Rahmen von institutsinternen Kolloquien. Hierfür sind Kompetenzen<br />
im Bereich der Projektbearbeitung, der fachspezifischen Kommunikationstechniken,<br />
des wissenschaftlichen Schreibens und der Postergestaltung ein zentraler Erfolgsfaktor.<br />
In Abhängigkeit von der Interessenlage der Promovenden können weitere Qualifikationen<br />
förderungswürdig sein:<br />
• Fachspezifische Forschungsmethoden und -fähigkeiten<br />
• Selbst-, Zeit- und Projektmanagement<br />
• Erkenntnistheoretische und wissenschaftsethische Konzepte<br />
• Team- und Personalführungskompetenzen, Persönlichkeitsbildung<br />
• Software, elektronische Medien, Informationsbeschaffung und -verwaltung.<br />
43