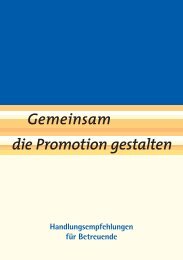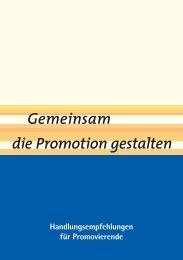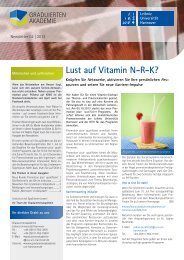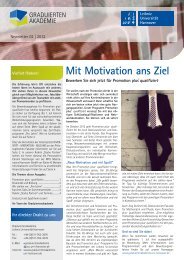Ergebnisbericht zur strukturierten Doktorandenausbildung
Ergebnisbericht zur strukturierten Doktorandenausbildung
Ergebnisbericht zur strukturierten Doktorandenausbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1.4 Sicherung der Qualität der Betreuung/Promotionsdauer<br />
Eine intensive fachliche Betreuung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche<br />
Promotion. Für eine Verbesserung der Betreuung sollte die Beziehung zwischen<br />
Hauptbetreuer/-in und Doktorand/-in durch eine kooperative Betreuung verschiedener<br />
Hochschullehrer/-innen ergänzt werden. Betreuungsteams von bis zu drei Hochschullehrern<br />
entlasten die Beziehung zwischen Betreuer/-in und Doktorand/-in und lockern<br />
die Abhängigkeit des Promovierenden von der Doktormutter bzw. dem Doktorvater.<br />
Zudem gilt es, verbindliche und belastbare Richtlinien und Maßstäbe für die Betreuung<br />
von Doktoranden/-innen zu verfassen und junge Professoren/-innen sowie Privatdozenten/-innen<br />
auf Betreuungsaufgaben durch erfahrene Wissenschaftler/-innen vorzubereiten.<br />
Die Promotion ist als zeitlich klar begrenzte Qualifizierungsphase zu verstehen, weshalb<br />
die Promotionsdauer sinnvoll begrenzt werden sollte. Für diejenigen Promovierenden,<br />
die von promotionsfernen Aufgaben entlastet sind und sich vollständig ihrer<br />
Forschungsarbeit widmen können, stellt eine Bearbeitungszeit von drei Jahren ein<br />
adäquater Zeitrahmen für die Erstellung einer Dissertation dar. Bei Promovierenden,<br />
die als wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen in größerem Umfang nicht unmittelbar promotionsbezogene<br />
Aufgaben in Forschung und Lehre übernehmen müssen, sollte auf<br />
eine Bearbeitungszeit von höchstens fünf Jahren hingewirkt werden. Um die Promotionsdauer<br />
kalkulierbar zu machen, sollen promotionsferne Tätigkeiten zeitlich und sachlich<br />
klar begrenzt werden.<br />
Der gleich zu Beginn der Promotion zu erstellende Zeit- und Arbeitsplan gibt dem Doktoranden<br />
einen Rahmen vor. Der Fortschritt des Dissertationsprojektes sollte durch regelmäßige<br />
Zwischenbewertungen – z.B. im Rahmen eines Doktorandenkolloquiums –<br />
überprüft werden. Dabei sollen Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Promovierenden<br />
gefordert und gefördert werden.<br />
Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, ist es die Aufgabe der Fakultäten, ihren<br />
Promovierenden eine zügige Durchführung des Promotionsverfahrens zu garantieren.<br />
In der Regel sollten zwischen Abgabe und Verteidigung der Arbeit nicht mehr als vier<br />
Monate liegen.<br />
Bei ernsthaften Konflikten zwischen Betreuer/-in und Doktorand/-in übernimmt eine von<br />
den Fakultäten ernannte Ombudsperson die Schlichtung.<br />
2.1.5 Integration in das wissenschaftliche Umfeld<br />
Die Qualität der Dissertation und die Wahrnehmung der Forschungsergebnisse hängen<br />
auch davon ab, inwieweit es der Doktorandin bzw. dem Doktoranden gelingt, seine Arbeit<br />
im Kontext der wissenschaftlichen Diskussion zu positionieren. Aus diesem Grund<br />
sollen die Promovierenden frühzeitig mit der aktiven Unterstützung ihrer Betreuer in die<br />
jeweilige „scientific community“ integriert werden.<br />
Doktorandenkolloquien bieten den Promovierenden Möglichkeiten <strong>zur</strong> gemeinsamen<br />
kritischen Diskussion von Fragen, Problemen und Ergebnissen. Deshalb ist sicherzustellen,<br />
dass jede/r Doktorand/-in Zugang zu einem einschlägigen Kolloquium hat und<br />
57