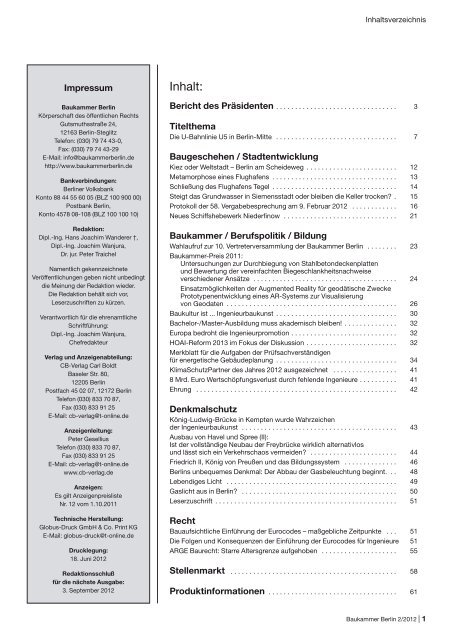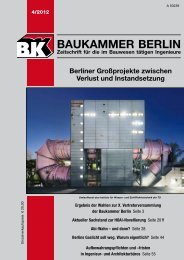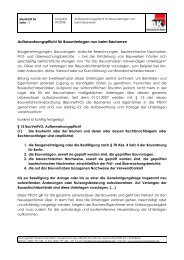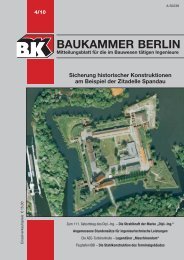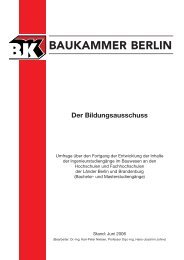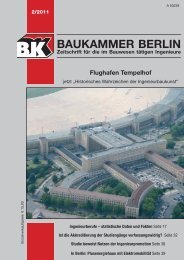BK-Heft 2/2012 - Baukammer Berlin
BK-Heft 2/2012 - Baukammer Berlin
BK-Heft 2/2012 - Baukammer Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 1<br />
Impressum<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Körperschaft des öffentlichen Rechts<br />
Gutsmuthsstraße 24,<br />
12163 <strong>Berlin</strong>-Steglitz<br />
Telefon: (030) 79 74 43-0,<br />
Fax: (030) 79 74 43-29<br />
E-Mail: info@baukammerberlin.de<br />
http://www.baukammerberlin.de<br />
Bankverbindungen:<br />
<strong>Berlin</strong>er Volksbank<br />
Konto 88 44 55 60 05 (BLZ 100 900 00)<br />
Postbank <strong>Berlin</strong>,<br />
Konto 4578 08-108 (BLZ 100 100 10)<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. Hans Joachim Wanderer †,<br />
Dipl.-Ing. Joachim Wanjura,<br />
Dr. jur. Peter Traichel<br />
Namentlich gekennzeichnete<br />
Veröffentlichungen geben nicht unbedingt<br />
die Meinung der Redaktion wieder.<br />
Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserzuschriften zu kürzen.<br />
Verantwortlich für die ehrenamtliche<br />
Schriftführung:<br />
Dipl.-Ing. Joachim Wanjura,<br />
Chefredakteur<br />
Verlag und Anzeigenabteilung:<br />
CB-Verlag Carl Boldt<br />
Baseler Str. 80,<br />
12205 <strong>Berlin</strong><br />
Postfach 45 02 07, 12172 <strong>Berlin</strong><br />
Telefon (030) 833 70 87,<br />
Fax (030) 833 91 25<br />
E-Mail: cb-verlag@t-online.de<br />
Anzeigenleitung:<br />
Peter Gesellius<br />
Telefon (030) 833 70 87,<br />
Fax (030) 833 91 25<br />
E-Mail: cb-verlag@t-online.de<br />
www.cb-verlag.de<br />
Anzeigen:<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste<br />
Nr. 12 vom 1.10.2011<br />
Technische Herstellung:<br />
Globus-Druck GmbH & Co. Print KG<br />
E-Mail: globus-druck@t-online.de<br />
Drucklegung:<br />
18. Juni <strong>2012</strong><br />
Redaktionsschluß<br />
für die nächste Ausgabe:<br />
3. September <strong>2012</strong><br />
Inhalt:<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Bericht des Präsidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
Titelthema<br />
Die U-Bahnlinie U5 in <strong>Berlin</strong>-Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
Kiez oder Weltstadt – <strong>Berlin</strong> am Scheideweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
Metamorphose eines Flughafens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
Schließung des Flughafens Tegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Steigt das Grundwasser in Siemensstadt oder bleiben die Keller trocken? . 15<br />
Protokoll der 58. Vergabebesprechung am 9. Februar <strong>2012</strong> . . . . . . . . . . . . 16<br />
Neues Schiffshebewerk Niederfinow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Wahlaufruf zur 10. Vertreterversammlung der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> . . . . . . . . 23<br />
<strong>Baukammer</strong>-Preis 2011:<br />
Untersuchungen zur Durchbiegung von Stahlbetondeckenplatten<br />
und Bewertung der vereinfachten Biegeschlankheitsnachweise<br />
verschiedener Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Einsatzmöglichkeiten der Augmented Reality für geodätische Zwecke<br />
Prototypenentwicklung eines AR-Systems zur Visualisierung<br />
von Geodaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
Baukultur ist ... Ingenieurbaukunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
Bachelor-/Master-Ausbildung muss akademisch bleiben! . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
Europa bedroht die Ingenieurpromotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
HOAI-Reform 2013 im Fokus der Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
Merkblatt für die Aufgaben der Prüfsachverständigen<br />
für energetische Gebäudeplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
KlimaSchutzPartner des Jahres <strong>2012</strong> ausgezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
8 Mrd. Euro Wertschöpfungsverlust durch fehlende Ingenieure . . . . . . . . . . 41<br />
Ehrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />
Denkmalschutz<br />
König-Ludwig-Brücke in Kempten wurde Wahrzeichen<br />
der Ingenieurbaukunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
Ausbau von Havel und Spree (II):<br />
Ist der vollständige Neubau der Freybrücke wirklich alternativlos<br />
und lässt sich ein Verkehrschaos vermeiden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
Friedrich II, König von Preußen und das Bildungssystem . . . . . . . . . . . . . . 46<br />
<strong>Berlin</strong>s unbequemes Denkmal: Der Abbau der Gasbeleuchtung beginnt. . . 48<br />
Lebendiges Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
Gaslicht aus in <strong>Berlin</strong>? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
Leserzuschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
Recht<br />
Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes – maßgebliche Zeitpunkte . . . 51<br />
Die Folgen und Konsequenzen der Einführung der Eurocodes für Ingenieure 51<br />
ARGE Baurecht: Starre Altersgrenze aufgehoben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
Stellenmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />
Produktinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 1
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 2<br />
Autoren dieser Ausgabe<br />
Dipl.-Ing. (FH) Sven Cordewinus<br />
IfE Grothe GmbH<br />
Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann<br />
Engelsmann Peters<br />
Beratende Ingenieure GmbH<br />
Dr.-Ing. Ralf Gastmeyer<br />
Beratender Ingenieur,<br />
Krebs und Kiefer GmbH<br />
Adrian Grabara<br />
Preisträger <strong>Baukammer</strong>preis<br />
Dr. Dankwart Guratzsch<br />
Korrespondent Städtebau/Architektur,<br />
DIE WELT<br />
Andreas Heinz,<br />
Journalist, Neues Deutschland<br />
Rechtsanwalt Ronny Herholz<br />
Geschäftsführer des AHO<br />
2 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Autoren dieser Ausgabe<br />
Christian Hunziker<br />
Journalist, Neue Zürcher Zeitung<br />
Jens Jessen<br />
Ressortleiter Feuilleton DIE ZEIT<br />
Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
Beratender Ingenieur<br />
Präsident der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Ulf Kreuziger<br />
Preisträger <strong>Baukammer</strong>preis<br />
Dipl.-Ing. Berthold Kujath<br />
Vorsitzender<br />
Gaslicht-Kultur e.V.<br />
Dipl.-Ing. Carsten Liebich<br />
Projektmanager Neubau U5,<br />
<strong>Berlin</strong>er Verkehrsbetriebe<br />
Rechtsanwalt Lars Christian Nerbel<br />
Rechtsanwälte<br />
Prof. Dr. Sangenstedt und Partner<br />
Rechtsanwalt<br />
Prof. Dr. jur. Hans Rudolf Sangenstedt<br />
Rechtsanwälte<br />
Prof. Dr. Sangenstedt und Partner<br />
Dipl.-Geol. Jörg Seegers<br />
Projektleiter Neubau U5,<br />
<strong>Berlin</strong>er Verkehrsbetriebe<br />
Dr. Peter Traichel<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Unseren im letzten Jahr verstorbenen Mitgliedern bewahren wir ein ehrendes Andenken:<br />
Dipl.-Ing. Hartmut Helmchen Dipl.-Ing. Rudolf Klimesch<br />
Dipl.-Ing. Heinrich Lupprian Dipl.-Ing. Fritz Mrozek<br />
Dipl.-Ing. Detlef Peetz Dipl.-Ing. (FH) Reno Radeboldt<br />
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Ziegler-Kähler
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 3<br />
Lassen Sie mich zunächst auf die wirklich<br />
erfreuliche <strong>Baukammer</strong>versammlung<br />
am 12. April (s. Fotos nächste Seiten)<br />
kurz zurückkommen und ich möchte<br />
mich bei dieser Gelegenheit auch bei<br />
Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich<br />
erschienen sind. Wir hatten über 300<br />
Gäste und es gab für unsere festliche<br />
Veranstaltung in der Peter-Behrens-Halle<br />
bisher nur lobende und anerkennende<br />
Kommentare. Ganz besonders bedanken<br />
möchte ich mich bei Herrn Prof. Kraft<br />
und natürlich bei dem Bildungsausschuss<br />
und dessen Vorsitzenden Herrn<br />
Prof. Hanschke, die am selben Tage mit<br />
großer Resonanz den zweiten <strong>Baukammer</strong>preis<br />
(s. Fotos unten und S. 24) verleihen<br />
konnten. Wie schon vor einem<br />
Jahr anlässlich der ersten <strong>Baukammer</strong>preis-Verleihung<br />
haben Sie, Herr Prof.<br />
Kraft, die Verleihung durchgeführt und<br />
ich kann sagen, dass es mir ein großes<br />
Vergnügen war, den sieben Preisträgern<br />
persönlich gratulieren zu können.<br />
Bekanntlich wurden die sieben besten<br />
Hochschulabschlussarbeiten prämiert,<br />
wobei zwei erste Preise mit je 1.500,-<br />
Euro, zwei zweite Preise mit je 1.000,-<br />
Euro und drei dritte Preise mit je 500,-<br />
Euro verliehen werden konnten. Der<br />
Erfolg dieses <strong>Baukammer</strong>preises, insbesondere<br />
das wachsende Interesse der<br />
Studenten daran, zeigt uns, dass wir hier<br />
unbedingt weitermachen müssen, um<br />
vor allem gute Leistungen junger Ingenieure<br />
besonders zu würdigen. Wir reden<br />
Prof. Dr.-Ing. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Frank Ulrich Vogdt und<br />
Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
Bericht des Präsidenten<br />
Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
immer davon, junge Ingenieure für den<br />
Ingenieurberuf zu interessieren, aber es<br />
geht auch darum, für unseren Nachwuchs<br />
in der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> selbst zu<br />
werben. Deshalb hat die <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong> auf ihrer letzten Vertreterversammlung<br />
am 21.05.<strong>2012</strong> beschlossen, eine<br />
außerordentliche studentische Mitgliedschaft<br />
in unserer Satzung festzuschreiben.<br />
Am 3. Mai fand die Mitgliederversammlung<br />
des AHO hier in <strong>Berlin</strong> statt.<br />
Bekanntgegeben wurde dort die Beauftragung<br />
eines Gutachtens zur Entwicklung<br />
der Planungsprozesse 1992 bis<br />
<strong>2012</strong>. Mit diesem Gutachten sollen die<br />
Veränderungen im Planungsgeschehen<br />
der letzten beiden Jahrzehnte qualitativ<br />
verdeutlicht werden. Dieses Gutachten<br />
Bericht des Präsidenten<br />
soll bis spätestens zum 30. September<br />
<strong>2012</strong> vorliegen, damit dessen Ergebnisse<br />
in die laufende Honoraruntersuchung<br />
im BMWi eingebracht werden können.<br />
Erwartet wird der Abschluss der HOAI-<br />
Novellierung bis 2013. Gefordert wurde<br />
erneut nachdrücklich die Rückführung<br />
der Planungsleistungen (ehemals Teile<br />
VI, X bis XIII HOAI 1996) in den verbindlichen<br />
Teil der HOAI. Viele der betroffenen<br />
Ingenieure sind seit der Freigabe dieser<br />
Leistungen angesichts des nicht mehr<br />
kostendeckenden, teilweise sogar ruinösen<br />
Preiswettbewerbs in erhebliche<br />
Bedrängnis geraten. Selbst Auftraggeber<br />
gestehen, dass durch die Freigabe der<br />
sog. Beratungsleistungen ein erheblicher<br />
Mehraufwand erzeugt wurde. Ferner<br />
wurde gesprochen über die gesamtschuldnerische<br />
Haftung und deren Problematik,<br />
als auch über vom BMWi angedachte<br />
besondere Verbraucherschutzvorschriften,<br />
die aber z. B. in Form eines<br />
außerordentlichen Kündigungsrechtes<br />
zu Lasten des Planers gingen. Die <strong>Baukammer</strong><br />
hat hieran vereint mit anderen<br />
Mitgliedern deutlich Kritik geäußert.<br />
Seitdem der neue Hauptgeschäftsführer<br />
der Fachgemeinschaft Bau, Herr Dipl.-<br />
Ing. Dellmann, der ehemalige Bauminister<br />
des Landes Brandenburg, im Amt<br />
ist, scheinen sich neue Beziehungen zur<br />
Fachgemeinschaft Bau leichter zu<br />
gestalten. Hier danke ich Herrn Dr. Traichel,<br />
der mit dem Hauptgeschäftsführer<br />
v.l.n.r. Prof. Dr.-Ing. Mike Schlaich, Dr.-Ing. Jens Karstedt, Prof. Dr.-<br />
Ing. Frank Ulrich Vogdt und die Preisträger Ulf Kreuziger, Adrian<br />
Grabara, Hannes Vorpahl, Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft, Oliver Justus,<br />
Bodo Harald Köpke, Stou Jankov und Mario Welzel<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 3
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 4<br />
Bericht des Präsidenten<br />
4 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Dipl.-Ing. Manfred<br />
Wunderlich,<br />
Dr.-Ing. Jürgen<br />
Sellmann<br />
Dr.-Ing. Jens<br />
Karstedt, Präsident<br />
der <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong><br />
Prof. Dr.-Ing. Frank<br />
Ulrich Vogdt (TU <strong>Berlin</strong>),<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus<br />
Dierks, Prof. Dr.-Ing.<br />
Udo Kraft<br />
Prof. Dr.-Ing. habil.<br />
Hans-Ulrich Mönnig<br />
(Präsident der<br />
Ingenieurkammer<br />
Thüringen), Dr. Peter<br />
Traichel (<strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong>)<br />
der Fachgemeinschaft Bau<br />
erste Kontakte geknüpft hat<br />
und auch schon erste<br />
Gespräche geführt hat. Im<br />
Ergebnis scheint eine<br />
Zusammenarbeit von <strong>Baukammer</strong><br />
und Fachgemeinschaft<br />
Bau auf den unterschiedlichsten<br />
Gebieten<br />
angezeigt (z. B. beim Thema<br />
„Werteverzehr Infrastruktur“,<br />
Bauordnung <strong>Berlin</strong>,<br />
Abgeordnetenkontakte<br />
etc.). Hier könnte auch mit<br />
der Architektenkammer<br />
Impressionen aus der
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 5<br />
Ass. jur. Anke Fellinger-Hoffmann<br />
(Geschäftsführerin der Ingenieurkammer<br />
Saarland), RA Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />
Ulrich Mönch (Geschäftsführer der<br />
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz)<br />
<strong>Berlin</strong> enger zusammengewirkt werden.<br />
Wir begrüßen die engere Zusammenarbeit<br />
mit der Fachgemeinschaft Bau und<br />
sehen hierin durchaus – zumindest von<br />
Fall zu Fall – eine Verstärkung unserer<br />
Interessenwahrnehmung.<br />
In Sachen EnEV-DV ist jetzt ein gemeinsames<br />
Merkblatt mit der Senatsverwaltung<br />
und der Architektenkammer, feder-<br />
Peter-Behrens-Halle<br />
Bericht des Präsidenten<br />
Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann<br />
(Vorstandsmitglied der<br />
Bundesingenieurkammer), Dr.-Ing. Jens<br />
Karstedt (Präsident der <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong>)<br />
Fotograf: Christian Vagt<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Frank Ulrich Vogdt (TU <strong>Berlin</strong>)<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 5
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 6<br />
Bericht des Präsidenten<br />
führend durch die <strong>Baukammer</strong>, fertiggestellt<br />
worden. Dieses Merkblatt ist im<br />
<strong>Baukammer</strong>heft veröffentlicht und alle<br />
Interessierten können dort die wesentlichen<br />
Punkte nachlesen. Im Übrigen steht<br />
selbstverständlich die <strong>Baukammer</strong> für<br />
Fragen zur Verfügung.<br />
Zu den ab 1. Juli geltenden EC-Normen<br />
ist zu sagen, dass wir auf Initiative von<br />
Herrn Dipl.-Ing. Enseleit ein Rundschreiben<br />
an alle Bezirksverwaltungen und an<br />
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
und Umwelt geschickt haben, auf<br />
das die Senatsverwaltung jetzt geantwortet<br />
hat. Erwartungsgemäß gibt es<br />
keine Übergangsfristen, gleichwohl<br />
bestehen aus Sicht der Obersten Bauaufsicht<br />
des Landes <strong>Berlin</strong> keine Bedenken,<br />
wenn ab dem 1. Juli <strong>2012</strong> bereits<br />
zuvor (für die Verfahren gemäß § 63 bis<br />
65 Bauordnung <strong>Berlin</strong>) geplante<br />
und bemessene Konstruktionen<br />
nach den bisher bekannt<br />
gemachten alten deutschen<br />
Normen ausgeführt werden. D.<br />
h., dass diese gleichwertig im<br />
Sinne § 3 Abs. 3 Bauordnung<br />
<strong>Berlin</strong> sind. Im Einzelnen wird<br />
auf das Rundschreiben von<br />
Herrn Wathling vom 30.04.<strong>2012</strong><br />
6 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
verwiesen, welches sich in diesem <strong>Heft</strong><br />
wiederfindet. Weiter möchte ich zur<br />
umfassenden Darlegung der Rechtslage<br />
auf ein ebenfalls hier abgedrucktes Kurzgutachten<br />
von Herrn Prof. Dr. Sangenstedt<br />
als auch auf den stattgefundenen<br />
Vortrag in der <strong>Baukammer</strong> von Herrn<br />
Rechtsanwalt Kemper hinweisen. Auch<br />
möchte ich nochmal auf die diversen Veröffentlichungen<br />
im Deutschen Ingenieurblatt<br />
verweisen, wo man sich ausführlich<br />
mit den zivilrechtlichen Aspekten der<br />
Einführung der neuen Eurocodes<br />
beschäftigt hat.<br />
Bekanntlich hat die <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
durch das neue Ingenieurgesetz die Aufgabe,<br />
ausländische Studienabschlüsse<br />
als Ingenieurstudiengänge anzuerkennen.<br />
Fast 70 Anträge sind bereits bearbeitet<br />
worden, wobei einige wenige auch<br />
in unserem Bildungsausschuss entschieden<br />
werden mussten, weil es sich<br />
um sehr schwierige Grenzfälle handelte.<br />
Hier möchte ich mich bei der Geschäftsstelle<br />
der <strong>Baukammer</strong>, insbesondere bei<br />
Frau Engling, bedanken, die hier einen<br />
erheblichen Aufgabenzuwachs erfahren<br />
hat. Den Bildungsausschuss bitte ich,<br />
sich, wie bisher, unbürokratisch dieser<br />
neuen Aufgabe zuzuwenden und danke<br />
ihm dafür.<br />
Aus der letzten Bundesingenieurkammer-Versammlung<br />
kann ich erwartungsgemäß<br />
berichten, dass ich angesichts<br />
der schon in der vorletzten Vertreterversammlung<br />
bekannt gewordenen<br />
Machenschaften der sog. Findungskommission<br />
in der Bundesingenieurkammer<br />
nicht mehr zur Wahl angetreten bin. Einziger<br />
Kandidat war deshalb Herr Dipl.-<br />
Ing. Kammeyer, der mit rund<br />
Dreiviertel aller Stimmen<br />
gewählt wurde. Alles Weitere ist<br />
bekannt und steht zusammengefasst<br />
auf den Seiten der <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong> und der Bundesingenieurkammer.<br />
Herrn Dipl.-<br />
Ing. Rainer Ueckert gratuliere<br />
ich zur Wiederwahl in den Bundesvorstand.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 7<br />
Zum Schluss lassen Sie mich noch ein<br />
paar Stichpunkte erwähnen:<br />
Die <strong>Baukammer</strong> war natürlich gefragter<br />
Gesprächspartner der Presse wegen der<br />
unerwarteten Verschiebung der Eröffnung<br />
des neuen Flughafens <strong>Berlin</strong>-Brandenburg.<br />
Vielleicht hat der eine oder<br />
andere meine sehr verkürzte Stellungnahme<br />
in der Abendschau hierzu gesehen.<br />
Es kann jedenfalls nicht richtig sein,<br />
Ingenieure pauschal für die Versäumnisse<br />
der Bauherrn oder der Politik verantwortlich<br />
zu machen. Hiergegen habe ich<br />
mich deutlich verwahrt.<br />
Offenbar ist die <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> selbst<br />
in Südkorea nicht unbekannt, denn Mitte<br />
März hat uns eine sechsköpfige Delegation<br />
aus Korea (zwei Vertreter des Ministeriums<br />
für Wissen und Wirtschaft, ein<br />
Vertreter der Verbände Elektro- bzw.<br />
Informationstechnik und ein Forscher<br />
sowie ein deutscher Architekt, der dort<br />
vor Ort arbeitet) besucht. Die Südkoreaner<br />
sind lebhaft daran interessiert, die<br />
Vorteile der Einzelvergabe in ihrem Lande<br />
zu nutzen, weil sie das deutsche Modell<br />
insofern für fortschrittlich halten. Die<br />
Generalunternehmer oder Generalplanervergabe<br />
ist in Korea sehr weit verbreitet,<br />
hat aber dort aus den auch uns<br />
bekannten Gründen immer mehr Kritiker.<br />
Wir haben uns jedenfalls gefreut, diese<br />
Delegation hier begrüßen zu können und<br />
wir konnten ihnen Rede und Antwort stehen.<br />
In Sachen geplanter Abbau von 44.000<br />
Gaslaternen kann ich Ihnen versichern,<br />
dass die <strong>Baukammer</strong> dies durchaus kritisch<br />
sieht, denn ein vorhandenes in der<br />
Welt einzigartiges dichtes Gaslaternennetz,<br />
historisch gewachsen, einfach<br />
durch Elektroleuchten zu ersetzen ist<br />
weder unter baukulturellen Aspekten<br />
vertretbar noch unter Energie- oder CO 2 -<br />
Einsparungsaspekten so eindeutig zu<br />
beurteilen. Gerade in der jetzigen Zeit,<br />
wo man große Schwierigkeiten hat, den<br />
Strom durch alternative Energien zu<br />
ersetzen – und dies ist ja politisch so<br />
gewollt – sollten wir uns überlegen, ob<br />
eine solche Maßnahme überhaupt noch<br />
zeitgemäß ist. Herrn Dr. Traichel danke<br />
ich dafür, dass er das öffentlichkeitsrelevante<br />
Thema aufgegriffen hat.<br />
Der Vorstand hat beschlossen, das<br />
bekannte Mitgliederverzeichnis der <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong> in Papierform wieder neu<br />
aufzulegen, weil es offenbar der Wunsch<br />
vieler Mitglieder ist, dieses Verzeichnis<br />
nicht nur online einsehen zu können. Ab<br />
2013 werden wir es Ihnen wieder wie<br />
gewohnt zusenden.<br />
Die U-Bahnlinie U5 in <strong>Berlin</strong>-Mitte<br />
Dipl.-Geol. Jörg Seegers, BVG AöR / Dilp.-Ing. Carsten Liebich, BVG AöR<br />
WEITERBAU DER U-BAHNLINIE U5<br />
Im Jahre 2010 feierte der Eröffnungsabschnitt<br />
Alexanderplatz – Friedrichsfelde<br />
der U-Bahnlinie U5 seinen 80-jährigen<br />
Geburtstag und mit der Eröffnung der<br />
Linie U55 im August 2009 wurde außerdem<br />
ein Stück der zukünftigen Verlängerung<br />
der U5 zum Hauptbahnhof als Inselbetrieb<br />
vorweg genommen. Mit einer<br />
Länge von 19,8 km (inkl. U55) entspricht<br />
die U5 damit 13,7 % des gesamten <strong>Berlin</strong>er<br />
U-Bahnnetzes. Dennoch fehlt noch<br />
ein Stück, um von Hönow ohne Ausbzw.<br />
Umsteigen zum <strong>Berlin</strong>er Hauptbahnhof<br />
zu gelangen.<br />
Nach Fertigstellung des nunmehr im Bau<br />
befindlichen Streckenabschnitts wird die<br />
Gesamtlänge der U5 22 km betragen.<br />
Die U5 ist danach hinter der U7 <strong>Berlin</strong>s<br />
zweitlängste U-Bahnlinie.<br />
Mit dem geplanten Weiterbau der U-<br />
Bahnlinie U5 in <strong>Berlin</strong>-Mitte erfolgt ein<br />
wichtiger Lückenschluss zwischen den<br />
derzeitigen Endhaltepunkten der U-<br />
Bahnlinien U5 (U-Bhf. Alexanderplatz)<br />
und U55 (U-Bhf. Brandenburger Tor). Die<br />
2,2 km lange Strecke führt vom Alexanderplatz<br />
vorbei am <strong>Berlin</strong>er Rathaus,<br />
Titelthema<br />
unter der Spree, der Museumsinsel und<br />
dem Spreekanal hindurch, die Straße<br />
Unter den Linden entlang bis zum Brandenburger<br />
Tor.<br />
Mit dieser neuen Strecke erhalten die<br />
Stadtteile Hellersdorf, Kaulsdorf, Lichtenberg<br />
und Friedrichshain eine umsteigefreie<br />
Verbindung zur historischen<br />
Innenstadt, zum Regierungsviertel und<br />
zum <strong>Berlin</strong>er Hauptbahnhof. Die für Touristen<br />
und <strong>Berlin</strong>er gleichermaßen<br />
bedeutsamen Ziele und Wahrzeichen<br />
rund um die Museumsinsel, entlang der<br />
Straße Unter den Linden und im Regierungsviertel<br />
können dann vom <strong>Berlin</strong>er<br />
Hauptbahnhof wie vom Alexanderplatz<br />
aus direkt mit der neuen U5 erreicht werden.<br />
[U1].<br />
Das aktuell im Bau befindliche Baulos 1<br />
des Gesamtbauvorhabens „Neubau U5“<br />
umfasst die Herstellung von zwei Tunnelröhren<br />
im Schildvortrieb (TUN) sowie den<br />
Bau einer Gleiswechselanlage (GWA)<br />
und zweier Bahnhöfe: U-Bhf. Museumsinsel<br />
(MUI) und U-Bhf. Unter den Linden<br />
(UDL) als zukünftiger Kreuzungsbahnhof<br />
von U6 und U5. Der Bahnhof <strong>Berlin</strong>er<br />
Rathaus (BRH) wird gesondert als Baulos<br />
Abbildung 1 Streckenverlauf Lückenschluss U-Bahnlinie U5 <strong>Berlin</strong>-Mitte mit den<br />
Bahnhöfen <strong>Berlin</strong>er Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden<br />
Quelle: BVG<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 7
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 8<br />
Titelthema<br />
2 ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für<br />
Januar 2013 geplant. Für die betrieblichen<br />
Anforderungen der BVG ist der Bau<br />
einer Gleiswechselanlage (GWA) erforderlich,<br />
die sich unmittelbar in Richtung<br />
Westen an den Bahnhof BRH anschließen<br />
wird und an deren Kopf sich die<br />
Startbaugrube für die Tunnelbohrmaschine<br />
befindet.<br />
DIE GEOLOGIE IN BERLIN-MITTE<br />
Überblick über die Geologie<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburgs<br />
Die Landschaft <strong>Berlin</strong>-Brandenburgs<br />
wurde während des Quartärs von mehreren<br />
Inlandeistransgressionen überzogen,<br />
die zu mehrfachen Erosions- und Aufschüttungszyklen<br />
innerhalb der pleistozänen<br />
Lockergesteinsablagerungen<br />
führten und ca. 95 % <strong>Berlin</strong>-Brandenburgs<br />
mit quartären Ablagerungen<br />
bedeckten. Die auf die pleistozäne Mehrfachvereisung<br />
Nordeuropas zurückzuführende<br />
Sequenz überlagert die vorwiegend<br />
aus flachmarinen Sedimenten<br />
bestehende Füllung der Norddeutschen<br />
Senke. [U8]<br />
Die Grundmoränenlandschaft <strong>Berlin</strong>s<br />
und seiner Umgebung ist vorwiegend als<br />
flachwellige Hügellandschaft ausgebildet<br />
mit den markanten Erhebungen der<br />
Barnimhochfläche im Nordosten und der<br />
Teltowhochfläche im Südwesten. Die<br />
Hochflächen werden vom <strong>Berlin</strong>er<br />
Urstromtal durchzogen, einem der<br />
Hauptabflusswege weichselkaltzeitlichen<br />
Schmelzwässer. Fehler! Verweisquelle<br />
konnte nicht gefunden werden.<br />
Abbildung 2 Geologischer Längsschnitt Bereich Weiterbau U5 [U4]<br />
8 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Geologische und hydrogeologische<br />
Verhältnisse im Projektgebiet, [1], [3]<br />
Der oberflächennahe Auffüllungshorizont<br />
besteht aus Trümmerschutt, Fundamenten<br />
und alten Pfählen, seine Mächtigkeit<br />
schwankt stark. Insbesondere das<br />
Gebiet des ehemaligen Schlosskomplexes<br />
wurde historisch bedingt mehrfach<br />
grundlegend verändert. Aus den archäologischen<br />
Ausgrabungen im Bereich des<br />
historischen Rathauses von <strong>Berlin</strong> lässt<br />
sich schließen, dass das ursprüngliche<br />
Gelände unter dem heutigen Geländeniveau<br />
lag. Im Jahr 1640 war ein etwa 30 m<br />
breiter Geländestreifen unmittelbar<br />
neben dem Westufer der Spree noch<br />
vom Wasser überflutet.<br />
Unterhalb des Auffüllungshorizontes folgen<br />
mehr als 70 m mächtige, überwiegend<br />
sandige Ablagerungen. Der obere<br />
Teil dieser Ablagerungen - der sog. Talsand<br />
- erfuhr keine Vorbelastung durch<br />
Inlandeis. Seiner Ablagerung ging eine<br />
Erosion durch Schmelzwasser voraus,<br />
das die weichselkaltzeitliche Grundmoräne<br />
sowie die organogenen Bildungen<br />
der Eem-Warmzeit vollständig und auch<br />
noch ältere, darunterliegende Sandund/oder<br />
Geschiebemergelschichten<br />
teilweise abtrug. Der untere Teil dieser<br />
Ablagerungen – der sog. Schmelzwassersand<br />
– hingegen erfuhr eine Vorbelastung<br />
durch Inlandeis.<br />
Die Grenze zwischen Tal- und Schmelzwassersanden<br />
verläuft etwa zwischen 10<br />
m und 20 m unter Geländeoberkante<br />
(GOK). Sie ist meist nur durch eine deutliche<br />
Zunahme der Lagerungsdichte zu<br />
erkennen, nicht jedoch anhand von<br />
Bohrprofilen.<br />
Bereichsweise sind im Übergang zwischen<br />
Tal- und Schmelzwassersanden<br />
saalekaltzeitliche Geschiebemergel in<br />
Bändern und Schollen anzutreffen, an<br />
deren Basis sich oft Grobgeschiebe -<br />
auch als „Steinlage” bezeichnet - konzentrieren.<br />
Selbst dort, wo der Geschiebemergel<br />
durch das Eis vollständig erodiert<br />
wurde, sind häufig die in dem Mergel<br />
eingelagerten Steinlagen und „Findlinge“<br />
zurückgeblieben, die an das voreiszeitliche<br />
Vorhandensein des Geschiebemergels<br />
erinnern.<br />
Die Niederungen von Spree und Spreekanal<br />
queren das Projektgebiet im<br />
Bereich des U-Bhf. Museumsinsel. Weiter<br />
westlich wird die Trasse noch von drei<br />
mehr als 10 m tiefen „Rinnen“ gekreuzt.<br />
Diese sind durch Erosion saalekaltzeitlicher<br />
Schmelzwassersande unterhalb<br />
des Inlandseises entstanden. Mit Abtauen<br />
des Eises verblieben in diesen Erosionsrinnen<br />
sog. Toteisblöcke, die im Zuge<br />
der Ablagerung weichselkaltzeitlicher<br />
Talsande eingeschlossen und konserviert<br />
wurden. Innerhalb dieser Rinnen bildeten<br />
sich im Holozän Mudden, Torfe<br />
und Faulschlämme, die lokal bis in den<br />
Ausbruchquerschnitt des Tunnels hineinreichen<br />
können. Zudem finden sich<br />
geringmächtigen Vorkommen organogener<br />
Böden in den Niederungen der Spree<br />
und des Spreekanals.<br />
Die zuvor beschriebenen, quartären<br />
Böden werden ab einer Tiefe von ca. 70
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 9<br />
m u. GOK durch tertiäre Böden (Geschiebemergel,<br />
Braunkohlesedimente, Sande<br />
sowie ab etwa -100 m NHN horizontbeständiger,<br />
mariner Septarienton/Rupelton)<br />
unterlagert.<br />
Die Grundwasserstände variieren im Projektgebiet<br />
zwischen ca. 3,5 m und 6,0 m<br />
u. GOK. In den letzten Jahren wurde in<br />
<strong>Berlin</strong> ein stetig steigender GW-Stand<br />
beobachtet, so dass gemäß [U7] in bautechnischer<br />
Hinsicht die Berücksichtigung<br />
des zeHGW empfohlen wird. Dieser<br />
variiert im Projektgebiet zwischen ca. 3,0<br />
m und 4,0 m u. GOK.<br />
BAUWEISE UND BAUVERFAHREN,<br />
[2]<br />
Die im vorstehenden Kapitel beschriebenen<br />
Bodenverhältnisse zeigen, dass in<br />
Teilen des Baugebiets der U5 Böden mit<br />
sehr unterschiedlichen Eigenschaften<br />
anstehen, die bautechnisch eine große<br />
Herausforderung darstellen und auf die<br />
die zum Einsatz kommenden Bauverfahren<br />
technisch abzustimmen sind.<br />
Aufgrund des in <strong>Berlin</strong>s Mitte anstehenden<br />
hohen Grundwasserstands, müssen<br />
die eigentlichen Bauwerke bzw. der Rohbau<br />
in eigens dafür herzustellenden<br />
nahezu wasserdichten<br />
Baugruben errichtet<br />
werden. Diese<br />
Baugruben müssen<br />
statisch so bemessen<br />
werden, dass sie dem<br />
Wasser- und Erddruck<br />
standhalten können.<br />
Nach Fertigstellung<br />
der Baugruben darf in<br />
diesen gemäß den<br />
behördlichen Auflagen<br />
lediglich noch<br />
eine Restwassermenge<br />
von 1,5 l/s*1000<br />
m? benetzte Fläche<br />
gefördert werden.<br />
Die Herstellung der<br />
Baugruben erfolgt in<br />
der Wand-Sohle-Dekkel-Bauweise.<br />
Hierzu<br />
werden zunächst die<br />
erforderlichen Schlitzwände<br />
bis in unterschiedliche<br />
Tiefen hergestellt. Die max.<br />
Herstelltiefe der Schlitzwände beträgt<br />
bis zu ca. 45 m. Anschließend werden<br />
die Basisabdichtungen der Baugruben<br />
hergestellt, die entweder durch die Ausführung<br />
des Düsenstrahlverfahrens als<br />
Als Partner des Mittelstandes stehen wir Ihnen mit Investitionskrediten, Leasing,<br />
Krediten für Energiesparmaßnahmen und unserem Know-how zur Seite. Damit Ihr<br />
Unternehmen mehr Spielraum hat. Wir beraten Sie gern. Mehr Informationen unter<br />
Telefon (030) 30 63 - 33 77 oder unter www.berliner-volksbank.de<br />
* <strong>2012</strong> ist das Internationale Jahr der Genossenschaften. Entdecken Sie hier, was es für uns bedeutet, Genossenschaftsbank zu sein.<br />
Abbildung 3 Regelquerschnitt Tunnel im Schildvortrieb<br />
Titelthema<br />
tiefliegende Dichtsohlen oder als Unterwasserbetonsohlen<br />
hergestellt werden.<br />
In einem weiteren Schritt erfolgt dann<br />
nach einem entsprechenden Voraushub<br />
der Baugruben die Herstellung der Baugrubendeckel.<br />
Diese Vorgehensweise<br />
„ Mein Unternehmen<br />
erweitern.“<br />
Mit unseren<br />
flexiblen Lösungen<br />
für Ihre Finanzierung<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 9
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 10<br />
Titelthema<br />
Abbildung 4: Bahnhof Museumsinsel<br />
ermöglicht dann ein Weiterarbeiten<br />
unterhalb der Deckel, so dass die Behinderungen<br />
und Einschränkungen im Straßenland<br />
auf ein Minimum reduziert werden<br />
können.<br />
Bevor jedoch der weitere Aushub der<br />
Baugruben erfolgt, werden ab April 2013<br />
die Tunnelröhren durch die Tunnelbohrmaschine<br />
aufgefahren. Hierzu wird, wie<br />
eingangs bereits beschrieben, im Bereich<br />
Marx-Engels-Forum am westlichen<br />
Ende der Gleiswechselanlage eine Startbaugrube/Startschacht<br />
errichtet.<br />
Abbildung 5: Frostkörper Bahnhof Museumsinsel<br />
10 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Es werden zwei parallele Tunnelröhren<br />
hergestellt. Die Tunnel werden von einer<br />
Tunnelvortriebsmaschine im sogenannten<br />
Schildvortriebsverfahren hergestellt.<br />
Hierbei haben die Unterfahrung der Uferwände<br />
der Spree, die Berücksichtigung<br />
des Neubaus des zukünftigen Neuen<br />
<strong>Berlin</strong>er Schlosses und der Anschluss an<br />
den bestehenden Bahnhof Brandenburger<br />
Tor besonderen Einfluss auf die Planung<br />
und die Ausführung des Schildvortriebs.<br />
Die Tunnelvortriebe beginnen im Startschacht<br />
in der Gleiswechselanlage und<br />
enden vor dem Bahnhof Brandenburger<br />
Tor. Die Tunnel werden im Schildvortrieb<br />
mit einer flüssigkeitsgestützten Ortsbrust<br />
aufgefahren. Der Innendurchmesser<br />
der Tunnelröhren beträgt 5,70 m.<br />
Die Tunnelröhren werden mit Stahlbetontübbings<br />
ausgekleidet. Es ist ein<br />
Blocktübbingring von 35 cm Dicke vorgesehen.<br />
Die Ringbreite wird konisch<br />
ausgeführt und beträgt im Mittel 1500<br />
mm (Abb. 2). Die Dichtung der Tübbingfugen<br />
erfolgt mittels eines in einer Nut<br />
eingebetteten geschlossenen Elastomerrahmens.<br />
Die Dichtung ist auf einen<br />
max. Wasserdruck von 3.0 bar zu<br />
bemessen. In den Tübbings ist ein Bohrraster<br />
vorgesehen der es ermöglicht, den<br />
Ringspalt nachzuinjizieren.<br />
Die Tunnelröhren werden nacheinander<br />
von Osten nach Westen aufgefahren. Es<br />
ist vorgesehen, zuerst die Tunnelröhre für<br />
Gleis 1, danach die Röhre für Gleis 2 vorzutreiben.<br />
Die Anfahrt der Schildvortriebsmaschine<br />
erfolgt im Startschacht im Bereich der<br />
Gleiswechselanlage. Die im Zuge des<br />
Schildvortriebs zu durchörternde Baugrubenwand<br />
wird im Bereich der Schilddurchfahrt<br />
mit Glasfaserbewehrung hergestellt.<br />
Für die Anfahrt ist ein redundantes Dichtungssystem<br />
bestehend aus Anfahrtopf<br />
mit Lippendichtungen, aufblasbarer Notdichtung<br />
sowie aus einem erdseitig vor<br />
der Schlitzwand hergestellten Düsenstrahl-Körper<br />
(DSV-Körper) vorgesehen.<br />
Die Vortriebe erfolgen nach Herstellung<br />
der Baugrubenumschließungen für die<br />
Bahnhofsbauwerke und vor dem Lenzen<br />
und Aushub der Baugruben. Innerhalb<br />
der Baugruben ist der Stützdruck aufgrund<br />
des in den Baugruben vorhandenen<br />
kleineren beaufschlagbaren Bodenvolumens<br />
für den Vortrieb zu reduzieren.<br />
Aus diesem Grund ist der in den Baugruben<br />
vorhandene Wasserdruck mittels<br />
der für den Lenzvorgang vorgesehenen<br />
Brunnen an den aufzubringenden erforderlichen<br />
Stützdruck anzugleichen.<br />
Der Schildvortrieb unterfährt die Spree,<br />
den ehemaligen Palast der Republik, auf<br />
dessen Gelände das zukünftige <strong>Berlin</strong>er<br />
Schloss (Humboldtforum) errichtet wird,<br />
den Spreekanal, das Bertelsmann-<br />
Gebäude, den Lindentunnel, das Reiterstandbild<br />
Friedrich des Großen sowie<br />
den S-Bahntunnel der Nord-Süd-Bahn<br />
im Bereich „Unter den Linden“. Die<br />
Unterfahrungen der Gewässer stellen<br />
aufgrund der Geologie und des
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 11<br />
Abstands zur Gewässersohle von ca. 6,0<br />
m besondere Anforderungen an den<br />
Schildvortrieb. Die Gewässersohlen sind<br />
unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung<br />
des Schiffsverkehrs mit Stahlplatten<br />
oder Schwerbetonwürfeln zu ballastieren.<br />
Die Tunnelröhren sollen in den Jahren<br />
2013 bis 2014 hergestellt werden.<br />
Messtechnische Überwachung, [2]<br />
Der innerstädtische Vortrieb der Tunnelröhren<br />
erfordert eine umfassende messtechnische<br />
Überwachung der Bauarbeiten.<br />
Hierzu wurden im Zuge der Ausschreibung<br />
für jedes Bauwerk sowie für<br />
jede Anlage Dritter, die im Bereich der<br />
prognostizierten Setzungsmulde liegen,<br />
Verformungswerte ermittelt und daraus<br />
Melde- und Alarmwerte abgeleitet.<br />
Zur Kontrolle der eingehaltenen Verformungswerte<br />
wurden ein Messprogramm<br />
mit vorgegebenen Messquerschnitten,<br />
Messmitteln und Messhäufigkeiten<br />
sowie die Ziele der Messauswertungen<br />
in den Ausschreibungsunterlagen als<br />
Mindestanforderungen vorgegeben. Es<br />
sind sowohl Messquerschnitte im<br />
Bereich der Baugruben für den Verbau<br />
und die bleibende Konstruktion vorgesehen<br />
als auch Messquerschnitte zur Analyse<br />
und Darstellung der sich tatsächlich<br />
einstellenden Setzungsmulde während<br />
des Schildvortriebs.<br />
Die Bahnhöfe<br />
Die beiden Bahnhöfe „Unter den Linden“<br />
und „<strong>Berlin</strong>er Rathaus“ werden in offener<br />
Bauweise hergestellt. Besonders hervorgehoben<br />
wird hier der Bahnhof Museumsinsel,<br />
der in geschlossener Bauweise<br />
hergestellt wird.<br />
Der Bahnhof Museumsinsel beginnt am<br />
östlichen Spreekanalufer und endet auf<br />
Höhe des Kronprinzenpalais (Abb. 4).<br />
Das Bauwerk besteht aus zwei Schächten<br />
an den Enden des Bahnhofs mit den<br />
zugehörigen Zugängen und Verteilerebenen<br />
sowie den dazwischen liegenden<br />
Bahnsteigröhren.<br />
Die Bahnsteighalle zwischen den beiden<br />
Schächten liegt im Bereich des Spreekanals<br />
und wird im Schutze eines Frostkörpers<br />
in bergmännischer Bauweise hergestellt.<br />
Die minimale Überdeckung zwischen<br />
Frostkörper und Spreekanalsohle<br />
beträgt ca. 4,50 m.<br />
Der Frostkörper wird mittels maximal<br />
105 m langer horizontaler gesteuerter<br />
Bohrungen hergestellt. Hierzu werden<br />
von beiden Bahnhofsschächten auf einander<br />
zulaufende Bohrungen mit einer<br />
Länge von ca. 85 m und ca. 25 m ausgeführt.<br />
Aufgrund der Bahnhofsgeometrie<br />
ist es erforderlich, einen Teil der Bohrungen<br />
in ihrer gesamten Länge von einer<br />
Seite auszuführen. Die planmäßige statische<br />
Dicke des Frostkörpers beträgt 2,0<br />
m (Abb. 5).<br />
Die Bahnsteighalle wird in einem dreizelligen<br />
Querschnitt bestehend aus einem<br />
Mittel- und zwei Seitenstollen ausgebrochen.<br />
Der Bauablauf sieht vor, zunächst<br />
den Mittelstollen und dann zeitlich versetzt<br />
die Seitenstollen im bergmännischen<br />
Vortrieb mit kurz vorauseilender<br />
Kalotte und raschem Sohlschluss aufzufahren.<br />
Der Ausbruch des gefrorenen<br />
Bodens erfolgt mit einer Anbaufräse.<br />
Die Stollen werden mit Spritzbeton gesichert.<br />
Der Vortrieb der Seitenstollen<br />
erfolgt im Zuge einer Querschnittsaufweitung<br />
im Bereich der Tübbingröhren.<br />
Hierzu sind die Tübbingröhren in Teilflächen<br />
abzubrechen und der Ausbruch ist<br />
zu sichern. Der Einbau der bewehrten<br />
Die einzelnen Ausgaben der Zeitschrift<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
finden Sie auch im Internet auf der Hompage der<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
www.baukammerberlin.de<br />
Innenschale im Mittelstollen erfolgt bevor<br />
die Querschnittsaufweitung in den Seitenstollen<br />
beginnt. Den Vortrieben in den<br />
Seitenstollen nachfolgend werden die<br />
bewehrten Innenschalen in den Seitenstollen<br />
hergestellt und mit der Innenschale<br />
des Mittelstollens kraftschlüssig<br />
verbunden. Die Dicke der Innenschalen<br />
variiert und beträgt mindestens 45 cm<br />
(Abb. 5).<br />
Der Bau des Bahnhofes Museumsinsel<br />
soll im Frühjahr <strong>2012</strong> beginnen.<br />
QUELLEN<br />
Titelthema<br />
U1 Geotechnische und geologische Herausforderungen<br />
beim Weiterbau der U-<br />
Bahnlinie U5 in <strong>Berlin</strong>-Mitte, Dipl.-Ing.<br />
Georg Breitsprecher, CDM Consult<br />
GmbH, Dipl.-Geol. Jörg Seegers, BVG<br />
AöR Dipl.-Ing. Helmut Haß, CDM Consult<br />
GmbH, Forschung + Praxis, U-Verkehr<br />
und unterirdisches Bauen, Vorträge zur<br />
STUVA-Tagung ´11, Bauverlag BV<br />
U2<br />
GmbH, Gütersloh 2011<br />
Erdmann, P., Brenner, T., Schmeiser, J.<br />
(2011): Aspekte der Planung der U-Bahnlinie<br />
U5, <strong>Berlin</strong> – Lückenschluss zwischen<br />
Alexanderplatz und Brandenburger Tor,<br />
in: Forschung + Praxis, U-Verkehr und<br />
unterirdisches Bauen, Vorträge zur STU-<br />
VA-Tagung ´11, Bauverlag BV GmbH,<br />
Gütersloh 2011<br />
U3 Baugrund <strong>Berlin</strong> Ingenieurgesellschaft<br />
für Baugrunduntersuchungen mbH<br />
(1996):<br />
U-Bahnlinie U5: Abschnitt Pariser Platz -<br />
Bahnhof <strong>Berlin</strong>er Rathaus;<br />
Baugrundgutachten (Hauptuntersuchung),<br />
24.01.1996<br />
Auftrags-Nr. 94/2357,<br />
U4<br />
einschl. 1. bis 4. Ergänzungen späteren<br />
Datums<br />
Stackebrandt, W. (2006): Zu einigen geowissenschaftlichen<br />
Meilensteinen Brandenburgs,<br />
in: Brandenburgische Geowissenschaftliche<br />
Beiträge, Band 13, <strong>Heft</strong> ?,<br />
Kleinmachnow<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 11
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:44 Uhr Seite 12<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
Braucht <strong>Berlin</strong><br />
eine “Zentrale<br />
Stadtbibliothek”<br />
wie Baden-WürttembergsHauptstadt<br />
Stuttgart?<br />
Mit Neidgefühlen<br />
blickt man auf die<br />
Schwabenmetropole,<br />
die sich<br />
einen schmucke<br />
Bibliotheksbau<br />
auf den Gleisfeldern von Stuttgart21<br />
geleistet hat, während sich <strong>Berlin</strong> mit seit<br />
hundert Jahren beklagten Zuständen auf<br />
diesem Sektor behelfen muß. Zur Debatte<br />
steht ein Zukunftsprojekt, das anders<br />
als Staats- und Universitätsbibliotheken<br />
der “breiten Bevölkerung” zugute kommen<br />
soll, ein Geschenk an die Bürger, ein<br />
“Forum der Stadtgesellschaft und Ort<br />
der Kreativität”, wie Volker Heller von der<br />
Senatskanzlei hervorhebt. Die Buchbestände<br />
sind bisher aufgeteilt auf die<br />
räumlich weit auseinander liegende<br />
Amerika Gedenkbibliothek und die<br />
Stadtbibliothek hinter dem Staatsratsgebäude.<br />
Das will der Senat mit einem<br />
Federstrich ändern und eine “Zentralbibliothek”<br />
schaffen, wie sie erstmals<br />
schon 1914, dann erneut 1926 und 1936<br />
geplant, aber nie realisiert worden ist.<br />
Doch Bürger und Architekten murren.<br />
Denn das 270-Millionen-Euro-Projekt<br />
soll auf die Tempelhofer Freiheit, das<br />
ANZEIGENSCHLUSS<br />
FÜR HEFT 3/<strong>2012</strong><br />
IST AM<br />
31. AUGUST <strong>2012</strong><br />
CB-VERLAG CARL BOLDT<br />
POSTFACH 45 02 07<br />
12172 BERLIN<br />
TELEFON (030) 833 70 87<br />
E-MAIL:<br />
CB-VERLAG@T-ON LINE.DE<br />
12 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Kiez oder Weltstadt - <strong>Berlin</strong> am Scheideweg<br />
Zur zentralen Stadtbibliothek auf dem Tempelhofer Feld<br />
Dr. Dankwart Guratzsch<br />
Rollbahngelände des stillgelegten innerstädtischen<br />
Flughafens Tempelhof. Und<br />
die Idee ist nicht, wie es das Baugesetzbuch<br />
vorschreibt, mit den Bürgern erörtert,<br />
sondern vom Regierenden Bürgermeister<br />
Wowereit wie das berühmte<br />
Kaninchen aus dem Hut gezaubert worden,<br />
nachdem sich, wie Behördenvertreter<br />
und Bibliothekare unisono beteuern,<br />
zuvor Dutzende von Alternativstandorten<br />
als untauglich erwiesen hätten.<br />
Jetzt freilich will der Senat alles ganz<br />
schnell durchziehen: Aufnahme in den<br />
Doppelhaushalt <strong>2012</strong>/2013, Festzurren<br />
im Koalitionsvertrag SPD/CDU, Baubeginn<br />
2014, Fertigstellung spätestens<br />
2020. Nur eines hatte man vergessen:<br />
den „mündigen Bürger“ mitzunehmen.<br />
Dabei sind die Weichen offenbar schon<br />
unverrückbar gestellt. Und diese Regie<br />
ist es, die den gesamten Kiez von Pankow<br />
über Mitte bis Tempelhof alarmiert.<br />
Warum auf dem Tempelhofer Feld, wo<br />
den Bürgern ein Park versprochen wurde?<br />
Warum dann nicht gleich im 1,2 Kilometer<br />
langen Flughafengebäude, in dem<br />
der Senat bisher nur gestückelte Nutzungen<br />
vom Polizeipräsidium bis zu Messelokalitäten<br />
untergebracht hat? Warum<br />
nicht wirklich “zentral” in der Mitte <strong>Berlin</strong>s,<br />
etwa im neuen Schloß oder gegenüber<br />
dem Traditionssitz Breite Straße, wo<br />
Bagger gerade leerstehende Bürogebäude<br />
abräumen? Warum überhaupt ein<br />
solcher Bau, wo <strong>Berlin</strong> doch kein Geld<br />
hat, wo sich soviele Bezirksbibliotheken<br />
in Existenznot befinden und nur mit<br />
ehrenamtlichen Helfern am Leben gehalten<br />
werden können? Als die stolzgeschwellte<br />
Mannschaft der Behördenvertreter<br />
mit dem Projekt jetzt erstmals an<br />
die Öffentlichkeit ging, sah sie sich einem<br />
Trommelfeuer unangenehmer Fragen<br />
ausgesetzt.<br />
Inzwischen weitet sich das Thema zur<br />
Fundamentalkritik insbesondere der<br />
Hochschulprofessoren an der <strong>Berlin</strong>planung<br />
Wowereits aus. “Die Rochade der<br />
Flughäfen wird die gesamte Stadtregion<br />
beeinflussen, doch wie sehen die Antworten<br />
auf dieses Jahrhundertereignis<br />
aus? War noch für die Wahl der Koalition<br />
die Verlängerung der A 100 ausschlaggebend,<br />
wurde mittlerweile die Zentral- und<br />
Landesbibliothek zum Lieblingsprojekt<br />
auserkoren. Doch weder Ort, Gestalt<br />
noch Programm dieses wichtigen Projektes<br />
wurden öffentlich diskutiert.” Das<br />
wollen die Architekten und Planer jetzt<br />
am 14. April auf eigene Faust nachholen<br />
- mit der eigens neu begründeten Reihe<br />
“Stadtpolitik trifft Stadtforschung - Dialoge<br />
zur Stadtentwicklung an der TU <strong>Berlin</strong>”.<br />
Man kann es auch als schallende<br />
Ohrfeige für die tatenarm und visionslos<br />
vor sich hindümpelnde Senatsbaudirektion<br />
werten, vielleicht gar als Generalabrechnung<br />
mit einer kaum noch konturierten<br />
Hauptstadtidee.<br />
Bislang bot <strong>Berlin</strong> in dieser für die Stadtentwicklung<br />
zentralen Frage das typische<br />
Beispiel für eine Debattenkultur, die<br />
auf bloße Akklamation setzt. Doch der<br />
Bürger will nicht über Entscheidungen<br />
aufgeklärt werden, sondern an der Entscheidungsfindung<br />
beteiligt sein. Gerade<br />
in <strong>Berlin</strong> war man da schon einmal deutlich<br />
weiter. Mit dem “Stadtforum” des<br />
Stadtentwicklungssenators Volker Hassemer<br />
hatte man in den 1990er Jahren<br />
ein Format gefunden, das deutschlandund<br />
europaweit hätte beispielhaft sein<br />
können, wenn man sich seine weit über<br />
Ort und Stunde hinausreichende Bedeutung<br />
bewußt gemacht hätte.<br />
Als ein echtes “Ständeparlament”, in<br />
dem alle wichtigen gesellschaftlichen<br />
Gruppen von den Gewerkschaften über<br />
die Kirchen bis hin zur Wirtschaft und zu<br />
den Planungsfachleuten, an einen Tisch<br />
gebracht wurden und bei dem die Politiker<br />
ebenso Zuhörer waren wie die Bürger,<br />
hat es die Weichen für den Wiederaufstieg<br />
<strong>Berlin</strong>s aus einer zerrissenen<br />
Regionalstadt zur Metropole des wiedervereinigten<br />
Deutschland gestellt. Demgegenüber<br />
erweist sich die Praxis der<br />
herkömmlichen “Bürgerbeteiligung”<br />
nach erfolgter politischer Beschlußfassung<br />
als ein Verfahren, das im Endeffekt<br />
den “großen Wurf” verhindert und kleinkarierte<br />
Lösungen von bescheidenstem<br />
provinziellem Zuschnitt produziert.<br />
Erst jetzt wird klar, daß bei der Schließung<br />
von Tempelhof kein Konzept vorhanden<br />
war, wie mit dem viertgrößten<br />
Gebäude der Welt und der gewonnenen<br />
Freifläche mitten im Siedlungsgefüge<br />
umzugehen sei. Daß sich ein Bauwerk<br />
dieses Charakters geeignet haben wür-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 13<br />
de, eine Institution von nationaler und<br />
internationaler Bedeutung zu installieren,<br />
das haben zum Beispiel die Franzosen<br />
bei der Umwidmung des Trocadero in<br />
Paris zum Nationalmuseum für Architektur<br />
demonstriert.<br />
Für den Flughafen Tempelhof hätte<br />
durchaus auch die Einrichtung des<br />
Museums der außereuropäischen Kulturen<br />
zur Wahl gestanden, das sich mit<br />
dem einstigen Ankunftsort internationaler<br />
Fluglinien auf sinnstiftende Weise hätte<br />
verknüpfen lassen. Stattdessen zieht<br />
Die Zukunft beginnt in einem schmucklosen<br />
Bürogebäude am Rande des Flughafens<br />
Tegel. Hier arbeitet Hardy Rudolf<br />
Schmitz mit einigen wenigen Mitarbeitern<br />
seiner Tegel Projekt GmbH an der<br />
Vision, das Gelände des heutigen Flughafens<br />
Tegel zu einem innovativen Forschungs-<br />
und Industriepark von weltweiter<br />
Ausstrahlung zu entwickeln. Wo heute<br />
noch Flugzeuge starten und landen,<br />
sollen in Zukunft Jungunternehmer an<br />
umweltfreundlichen Produkten tüfteln<br />
und Weltkonzerne zahlreiche Arbeitskräfte<br />
beschäftigen.<br />
Dass die Tage Tegels als Flughafen<br />
gezählt sind, steht schon lange fest.<br />
Denn als die zuständigen Politiker im<br />
Jahr 1996 Schönefeld zum Standort des<br />
neuen <strong>Berlin</strong>er Grossflughafens<br />
bestimmten, legten sie fest, dass die beiden<br />
Flughäfen Tempelhof und Tegel<br />
geschlossen werden. In Tempelhof wurde<br />
der Flugbetrieb bereits 2008 eingestellt;<br />
mit der Eröffnung des neuen Flughafens<br />
Willy Brandt, welche die Flughafengesellschaft<br />
eben kurzfristig vom<br />
ursprünglich geplanten Termin Anfang<br />
Juni auf März 2013 verschieben musste,<br />
wird bald auch über Tegel Ruhe einkehren.<br />
Wechselnde Ideen<br />
Dazu, wie das Areal im Nordwesten <strong>Berlin</strong>s<br />
künftig genutzt werden soll, gab es<br />
im Lauf der Zeit zahlreiche Ideen. Bald<br />
war die Rede von einem Wohngebiet mit<br />
4000 neuen Wohnungen, bald sollte das<br />
Terminal zu einer Firmenzentrale oder<br />
dieses Institut jetzt mit überfrachteter<br />
Symbolik in das ehemalige Schloß und<br />
entzieht dem Bibliotheksprojekt an diesem<br />
tatsächlich zentralen Ort die Entfaltungsmöglichkeiten.<br />
Mehr und mehr scheint sich in der <strong>Berlin</strong>er<br />
Öffentlichkeit die Einsicht durchzusetzen,<br />
daß nicht nur die neue Zentralbibliothek,<br />
sondern Tempelhof insgesamt,<br />
der ebenfalls vor der Stillegung stehende<br />
Flughafen Tegel und erst recht das riesige<br />
leere Marx-Engels-Forum zwischen<br />
Rotem Rathaus und Marienkirche (um<br />
Metamorphose eines Flughafens<br />
einem Freizeitzentrum umgebaut werden.<br />
Der bekannte Architekt Meinhard<br />
von Gerkan wiederum, der das in den frühen<br />
siebziger Jahren errichtete Flughafengebäude<br />
geplant hatte, propagierte<br />
die Idee einer ökologisch vorbildlichen<br />
Energie-Plus-Stadt. Letztlich aber entschied<br />
sich der <strong>Berlin</strong>er Senat 2009<br />
dafür, in Tegel einen «Forschungs- und<br />
Industriepark Zukunftstechnologien» zu<br />
schaffen.<br />
«<strong>Berlin</strong>», konstatierte die damalige<br />
Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg<br />
Junge-Reyer, «gewinnt durch die<br />
Schliessung des Flughafens Tegel eine<br />
hochattraktive Fläche zurück.» Tatsächlich<br />
ist die Verlegung eines Flughafens<br />
eine seltene stadtplanerische Chance.<br />
München nutzte sie, um nach dem 1992<br />
erfolgten Umzug seines Flughafens am<br />
alten Standort Riem einen Messekomplex<br />
zu errichten. Und die Region Zürich<br />
diskutiert darüber, wie es nach dem bis<br />
2014 gesicherten Flugbetrieb mit dem<br />
traditionsreichen Flugplatz Dübendorf<br />
weitergehen soll - auch dort ist ein Innovationspark<br />
im Gespräch.<br />
Doch während in diesen Städten innerstädtische<br />
Grundstücke knapp sind, hat<br />
<strong>Berlin</strong> ein ganz anderes Problem: Die<br />
deutsche Hauptstadt hat schlicht zu viele<br />
Areale, die ihrer Entwicklung harren.<br />
Allein der ehemalige Flughafen Tempelhof<br />
umfasst eine Fläche von 3,6 Quadratkilometern,<br />
die zwar grösstenteils als<br />
Park dienen, in den Randbereichen aber<br />
ebenfalls bebaut werden sollen. Innovative<br />
Firmen können sich auch im nördli-<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
nur drei Beispiele zu nennen) vor kleinkarierten<br />
Stückwerkslösungen bewahrt<br />
werden müssen, wie sie sich in Tempelhof<br />
zu etablieren drohen. Genau das ist<br />
die Debatte, die <strong>Berlin</strong> jetzt führen muß.<br />
Hier steht Deutschlands Hauptstadt,<br />
steht die Mittelmacht Europas nicht in<br />
Konkurrenz zu Stuttgart, sondern zu<br />
Shanghai oder Paris. Kiez oder Weltstadt<br />
- das ist die Debatte, um die <strong>Berlin</strong> nicht<br />
herumkommt. Sie kann nicht auf dem<br />
Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners<br />
ausgefochten werden.<br />
Der <strong>Berlin</strong>er Flughafen Tegel soll nach seiner Schliessung zu einem Zentrum urbaner Technologien werden<br />
<strong>Berlin</strong>s Flughafenplanung sorgt für Turbulenzen.<br />
Doch auch wenn die Eröffnung des neuen Grossflughafens auf März 2013 verschoben wurde, sind die Tage des Airports Tegel<br />
gezählt. Ein Gelände von fast fünf Quadratkilometern sucht eine neue Bestimmung.<br />
Christian Hunziker, <strong>Berlin</strong><br />
chen Stadtteil Buch oder in der neuen<br />
Europacity neben dem Hauptbahnhof<br />
ansiedeln. Unternehmen hauptsächlich<br />
aus der Solarenergiebranche will der<br />
Clean Tech Business Park in Marzahn<br />
gewinnen, und im Südosten der Stadt<br />
hat sich der Wissenschafts- und Technologiepark<br />
Adlershof etabliert.<br />
Lösungen für die Grossstadt<br />
Um sich davon abzugrenzen, soll sich<br />
Tegel als Standort urbaner Technologien<br />
profilieren. Darunter verstehen die Fachleute<br />
alle Bereiche, die mit dem Leben in<br />
der Stadt zu tun haben: umweltfreundliche<br />
Mobilität, innovative Versorgungsund<br />
Entsorgungskonzepte sowie energetische<br />
Gebäudesanierung, aber auch<br />
Unterstützung älterer Menschen durch<br />
technische Assistenzsysteme. <strong>Berlin</strong> sei<br />
als Grossstadt ideal geeignet, solche<br />
innovativen Lösungen in die Praxis<br />
umzusetzen, sagt der Grundstücksentwickler<br />
Schmitz.<br />
Nur: Wollen diese Firmen tatsächlich<br />
nach <strong>Berlin</strong>? Dass Siemens sein neues<br />
Stadtentwicklungszentrum, das sich<br />
genau mit diesen Fragen befasst, nicht<br />
etwa in <strong>Berlin</strong>, sondern in London ansiedelt,<br />
gilt manchen Beobachtern als<br />
schlechtes Omen. Andere bezweifeln,<br />
dass <strong>Berlin</strong> überhaupt noch eine Chance<br />
als Industriestadt habe. Denn nach der<br />
Wende gingen in der einstigen Industriemetropole<br />
Hunderttausende von Fabrikarbeitsplätzen<br />
verloren. In der Folge konzentrierte<br />
sich der Senat auf Tourismus<br />
und andere Dienstleistungen. Erst seit<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 13
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 14<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
kurzem setzt er mit seinem «Masterplan<br />
Industriestadt» wieder auf forschungsund<br />
technologieorientierte Produktionsbetriebe.<br />
Für diese fehle es in der Stadt<br />
an grossen, zusammenhängenden Flächen,<br />
stellte 2009 eine Untersuchung der<br />
Industrie- und Handelskammer (IHK)<br />
fest.<br />
Angeklopft haben die Grosskonzerne bei<br />
Hardy Rudolf Schmitz jedoch noch nicht.<br />
Deshalb setzt der Geschäftsführer der im<br />
Auftrag des Landes <strong>Berlin</strong> tätigen Tegel<br />
Projekt GmbH auf ein Konzept, das<br />
bereits in Adlershof erfolgreich war: Aus<br />
einem Kern von universitären und ausseruniversitärenForschungseinrichtungen<br />
sollen sich Ausgründungen entwikkeln,<br />
die dann organisch wachsen und<br />
sich auf dem Gelände in Tegel ausbreiten.<br />
Ein Zufall ist diese Analogie nicht -<br />
Schmitz war vor seiner Tätigkeit in Tegel<br />
für die Entwicklung von Adlershof<br />
zuständig.<br />
Eine zentrale Rolle kommt dabei der<br />
Beuth-Hochschule für Technik zu, die<br />
bereits ihr Interesse bekundet hat, mit<br />
einzelnen Instituten in das Tegeler Terminal<br />
zu ziehen. Schmitz hofft ausserdem,<br />
die renommierte Fraunhofer-Gesellschaft<br />
nach Tegel locken zu können. Diese<br />
setzt mit ihrem Konzept Morgenstadt<br />
14 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
einen Forschungsschwerpunkt, der<br />
exakt diejenigen Themen aufgreift, die in<br />
Tegel im Vordergrund stehen sollen.<br />
Offene Fragen<br />
Ob der Senat jedoch genügend Geld für<br />
den Umbau der bestehenden Gebäude<br />
und für die Erschliessung der noch unbebauten<br />
Flächen zur Verfügung stellt, ist<br />
offen. Ebenfalls noch nicht verabschiedet<br />
ist der Bebauungsplan, der festlegt,<br />
wo welche Baukörper entstehen dürfen.<br />
Nicht genug der Fragen: Ungeklärt ist die<br />
Finanzierung der Unterhaltskosten, die<br />
fällig werden, wenn das Areal drei Monate<br />
nach Schliessung des Flughafens an<br />
das Land <strong>Berlin</strong> und den Bund übergehen<br />
wird. <strong>Berlin</strong> ist nämlich keineswegs<br />
allein für das Gelände zuständig: Gut 60<br />
Prozent des Flughafenareals gehören<br />
dem Bund. Immerhin haben der Senat<br />
und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben<br />
bereits eine Kooperationsvereinbarung<br />
abgeschlossen, in der sie sich<br />
verpflichten, bei der Entwicklung zusammenzuarbeiten.<br />
Alles viel zu unkonkret, und überhaupt<br />
kämen die Überlegungen zu spät, kritisieren<br />
derweil lokale Politiker und<br />
Medien. Hardy Rudolf Schmitz setzt deshalb<br />
auf eine Idee, die an der Spree in<br />
Drucksache 17 / 10 173 · Kleine Anfrage · 17. Wahlperiode<br />
solchen Fällen fast immer vorgebracht<br />
wird: auf Zwischennutzungen. «<strong>Berlin</strong> ist<br />
eine Stadt, die mit Vorläufigkeit extrem<br />
gut umgehen kann», sagt Schmitz. Deshalb<br />
will er jungen Unternehmen Flächen<br />
im Terminal für eine äusserst niedrige<br />
Miete anbieten. Damit will er vermeiden,<br />
dass Tegel völlig verwaist, und den<br />
Standort auch für andere Nutzer attraktiv<br />
machen.<br />
Doch wollen sich Jungunternehmer wirklich<br />
an einem Ort niederlassen, an dem<br />
es kein Café und keinen Laden gibt und<br />
der jegliches urbane Flair vermissen lässt<br />
- zumal es in <strong>Berlin</strong> viele andere Möglichkeiten<br />
gibt, günstige Flächen anzumieten?<br />
Es klingt fast etwas trotzig, wenn<br />
Schmitz sein Konzept gegen Bedenken<br />
verteidigt: «Um Wachstum zu erzielen,<br />
hat <strong>Berlin</strong> nur bei neuen Technologien<br />
eine Chance. Die alten kommen nicht<br />
wieder.»<br />
Noch wird in <strong>Berlin</strong>-Tegel gestartet und<br />
gelandet.<br />
Kleine Anfrage des Abgeordneten Tim-Christopher Zeelen (CDU) vom 06. Februar <strong>2012</strong><br />
Im Namen des Senats von <strong>Berlin</strong> beantworte<br />
ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:<br />
Frage 1: In welcher Form wird sich der<br />
Senat mit Feierlichkeiten vom Flughafen<br />
Tegel verabschieden, so wie man es<br />
auch bei der Schließung des Flughafen<br />
Tempelhof gemacht hat?<br />
Frage 2: Wie werden die <strong>Berlin</strong>erinnen<br />
und <strong>Berlin</strong>er in die Feierlichkeiten mit eingebunden?<br />
Frage 3: In welcher Form wird sich die<br />
<strong>Berlin</strong>er Flughafengesellschaft an den<br />
Feierlichkeiten beteiligen?<br />
Frage 4: Wie werden sich die Fluggesellschaften<br />
an den Feierlichkeiten beteiligen?<br />
Antwort zu 1, 2, 3 und 4: Zunächst ist zu<br />
beachten, dass der Flughafen Tegel (wie<br />
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Februar <strong>2012</strong>) und Antwort<br />
Schließung des Flughafens Tegel<br />
auch der Flughafen Schönefeld) bis zur<br />
Schließung unter Volllastbetrieb stehen<br />
werden. Erst in der Nacht vom 2. auf den<br />
3. Juni <strong>2012</strong> wird ein Umzug der gesamten<br />
für den Betrieb am neuen Standort<br />
notwendigen Infrastruktur zum Flughafen<br />
<strong>Berlin</strong> Brandenburg stattfinden. Insofern<br />
bietet sich keine adäquate Feierlichkeit<br />
auf dem Flughafen Tegel an.<br />
Der Senat hält daher eine Konzentration<br />
der Feierlichkeiten auf die Eröffnung des<br />
Flughafens <strong>Berlin</strong> Brandenburg (BER),<br />
selbstverständlich unter Einbeziehung<br />
der <strong>Berlin</strong>er und Brandenburger Bürgerinnen<br />
und Bürger, für angemessener.<br />
Die Planung der Flughafen <strong>Berlin</strong> Brandenburg<br />
GmbH (FBB) sieht vor, am 12.<br />
und 13. Mai <strong>2012</strong> Publikumstage durchzuführen.<br />
Bei einem Rundgang werden<br />
sich alle Interessierten über den neuen<br />
Erschienen in der<br />
„Neuen Zürcher Zeitung“<br />
am 22.05.<strong>2012</strong><br />
Mit freundlicher Genehmigung der<br />
„Neuen Zürcher Zeitung“<br />
Flughafen informieren können. Zur offiziellen<br />
Eröffnungsfeier am 24. Mai <strong>2012</strong><br />
lädt die FBB <strong>Berlin</strong>er und Brandenburger<br />
Bürgerinnen und Bürger ein.<br />
In Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters<br />
von <strong>Berlin</strong> und des Ministerpräsidenten<br />
von Brandenburg werden die<br />
Fluggesellschaften Air <strong>Berlin</strong> (für Tegel)<br />
und Aeroflot (für Schönefeld) mit ihren<br />
jeweils letzten Abflügen die jahrzehntelange<br />
Tradition der beiden schließenden<br />
Flughäfen beenden.<br />
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
der Flughafengesellschaft ist darüber<br />
hinaus im Spätsommer ein Mitarbeiterfest<br />
in Tegel geplant.<br />
Frage 5: Wird es auf dem Grundstück<br />
des ehemaligen Flughafens Tegel die<br />
Möglichkeit geben, dass die Berli-nerin-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 15<br />
nen und <strong>Berlin</strong>er das Areal betreten können?<br />
Frage 6: Wann wird eine öffentliche<br />
Begehung erstmals möglich sein?<br />
Antwort zu 5 und 6: Die Eigentümer der<br />
Flächen – das Land <strong>Berlin</strong> und der Bund,<br />
vertreten durch die Bundesan-stalt für<br />
Immobilienaufgaben BImA – werden den<br />
Zugang ab dem 01. September <strong>2012</strong><br />
schrittweise ermöglichen, zunächst im<br />
Rahmen von geführten Touren und<br />
besonderen Anlässen. Mit zunehmendem<br />
Projektfortschritt der Nachnutzung<br />
des Areals und der Ansiedlung von<br />
ersten Nutzern werden dann Flächen, die<br />
der Öffentlichkeit bislang verschlossen<br />
waren, zugänglich gemacht. Dies werden<br />
insbesondere heutige Terminalbereiche<br />
und Funktionsgebäude sein.<br />
Im Namen des Senats von <strong>Berlin</strong> beantworte<br />
ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:<br />
Frage 1. Wie haben sich in den Jahren<br />
2010 und 2011 im Monatsverlauf die<br />
aktuellen Grundwasserstände an den<br />
folgenden, beispielhaft ausgewählten,<br />
Siemensstädter Grundwassermessstellen<br />
entwickelt? Bitte jeweils pro Monat<br />
Frage 7: Wann wird die BVG die Buslinie<br />
TXL zum Flughafen Tegel einstellen?<br />
Antwort zu 7: Die BVG beabsichtigt, den<br />
Betrieb der Linie TXL in der Nacht vom 2.<br />
auf den 3. Juni <strong>2012</strong>, also nach Beendigung<br />
des Flugbetriebs am Flughafen<br />
Tegel, einzustellen. Als Ersatz soll zur<br />
Erfüllung der innerstädtischen Verkehrsaufgaben<br />
der Streckenabschnitt zwischen<br />
Alexanderplatz und S-Bahnhof<br />
Beusselstraße ab dem 3. Juni <strong>2012</strong> mit<br />
der Linie 105 bedient werden.<br />
Frage 8: Wie werden die <strong>Berlin</strong>erinnen<br />
und <strong>Berlin</strong>er darauf aufmerksam<br />
gemacht, dass der TXL nicht mehr fährt?<br />
Antwort zu 8: Die Fahrgastinformation<br />
erfolgt – wie bei anderen Fahrplanänderungen<br />
auch – durch die BVG, also unter<br />
anderem in der Kundenzeitung, auf der<br />
die Höchst- und Niedrigst-Werte auflisten<br />
für die Messstellen<br />
a. 622<br />
b. 1306<br />
c. 1320<br />
d. 1324<br />
17. Wahlperiode ·<br />
Antwort zu 1.: siehe Tabellen<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
Homepage der BVG, über Pressearbeit<br />
und durch die Aktualisierung der Fahrplanaushänge<br />
und der elektronischen<br />
Fahrplanauskunft.<br />
Da in Zusammenhang mit dem Flughafenumzug<br />
umfassende Linienänderungen<br />
vorgenommen werden, werden<br />
zudem zum Fahrplanwechsel am 3. Juni<br />
<strong>2012</strong> die gedruckten Infoprodukte aktualisiert,<br />
z.B. der BVG-Atlas.<br />
<strong>Berlin</strong>, den 29. Februar <strong>2012</strong><br />
Kleine Anfrage · des Abgeordneten Matthias Brauner (CDU) vom 14. Februar <strong>2012</strong><br />
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. Februar <strong>2012</strong>) und Antwort<br />
Steigt das Grundwasser in Siemensstadt<br />
oder bleiben die Keller trocken?<br />
In Vertretung<br />
Christian Gaebler<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
und Umwelt<br />
(Eingang beim Abgeordnetenhaus<br />
am 02. Mrz. <strong>2012</strong>)<br />
Frage 2.: Wie bewertet der Senat die<br />
Messergebnisse?<br />
Antwort zu 2.: Generell zeigen die<br />
gemessenen Werte einen Jahresgang<br />
mit höheren Grundwasserständen im<br />
Winterhalbjahr und niedrigeren Grundwasserständen<br />
im Sommerhalbjahr, der<br />
aber beispielsweise durch ungewöhnlich<br />
622 1306 1320 1324<br />
Monat Höchst- Niedrigst- Höchst- Niedrigst- Höchst- Niedrigst- Höchst Niedrigst-<br />
Wert Wert Wert Wert Wert Wert -Wert Wert<br />
m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN<br />
1/2010 30,25 30,15 29,26 29,20 28,44 28,33 29,39 29,23<br />
2/2010 30,27 30,13 29,24 29,19 28,43 28,07 29,30 29,20<br />
3/2010 30,36 30,23 29,27 29,18 28,33 28,07 29,41 29,25<br />
4/2010 30,34 30,19 29,30 29,19 28,36 28,30 29,40 29,23<br />
5/2010 30,26 30,17 29,22 29,15 28,28 28,22 29,31 29,22<br />
6/2010 30,23 30,10 29,21 29,11 28,29 28,20 29,27 29,18<br />
7/2010 30,10 30,03 29,22 29,07 28,33 28,26 29,22 29,16<br />
8/2010 30,21 30,05 29,20 29,09 28,61 28,26 29,44 29,18<br />
9/2010 30,23 30,18 29,28 29,20 28,66 28,45 29,48 29,40<br />
10/2010 30,30 30,24 29,33 29,28 28,70 28,48 29,53 29,48<br />
11/2010 30,47 30,25 29,43 29,32 28,57 28,48 29,71 29,67<br />
12/2010 30,52 30,37 29,51 29,43 28,59 28,41 29,75 29,60<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 15
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 16<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
erhöhte Niederschläge im Juli 2011 stark<br />
überprägt ist. Zusätzlich ist in der Messstelle<br />
1320 sowie in geringerem Umfang<br />
auch in der Messstelle 1324 eine Beeinflussung<br />
der Grundwasserstände durch<br />
die Grund-wasserhaltungsmaßnahmen<br />
in dem nicht mehr für die Trinkwasserproduktion<br />
eingesetzten Wasserwerk<br />
Jungfernheide erkennbar.<br />
Frage 3.: Welche Maßnahmen zur<br />
Gewährleistung siedlungsverträglicher<br />
Grundwasserstände für das gesamte<br />
Stadtgebiet <strong>Berlin</strong>s<br />
a. wurden bisher vom Senat getroffen?<br />
b. plant der Senat?<br />
Antwort zu 3.a. und 3.b.: Die Gewährleistung<br />
siedlungsverträglicher Grundwasserstände<br />
im Stadtgebiet <strong>Berlin</strong>s ist keine<br />
Aufgabe des Senats. Vielmehr ist<br />
der/die Bauherr/in gesetzlich verpflichtet,<br />
sein Gebäude gegen Grundwasser<br />
zu schützen (Bauordnung für <strong>Berlin</strong> [Bau-<br />
OBln] § 13). Nach der einschlägigen<br />
16 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
622 1306 1320 1324<br />
Monat Höchst- Niedrigst- Höchst- Niedrigst- Höchst- Niedrigst- Höchst Niedrigst-<br />
Wert Wert Wert Wert Wert Wert -Wert Wert<br />
m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN m NHN<br />
1/2011 30,70 30,47 29,69 29,51 28,55 28,40 29,87 29,65<br />
2/2011 30,68 30,45 29,70 29,54 28,38 27,97 29,81 29,44<br />
3/2011 30,44 30,31 29,54 29,38 28,10 27,87 29,42 29,16<br />
4/2011 30,34 30,27 29,41 29,28 28,16 28,11 29,44 29,36<br />
5/2011 30,27 30,16 29,37 29,16 28,16 28,11 29,36 29,29<br />
6/2011 30,17 30,11 29,24 29,08 28,43 28,09 29,32 29,24<br />
7/2011 30,31 30,11 29,18 29,08 28,63 28,44 29,57 29,31<br />
8/2011 30,43 30,30 29,32 29,19 28,73 28,13 29,72 29,39<br />
9/2011 30,28 30,21 29,28 29,17 28,11 27,98 29,37 29,24<br />
10/2011 30,27 30,18 29,27 29,10 27,98 27,93 29,30 29,19<br />
11/2011 30,23 30,16 29,19 29,12 28,22 27,85 29,22 29,14<br />
12/2011 30,34 30,16 29,15 29,10 28,31 27,96 29,38 29,19<br />
Rechtsprechung besteht unter keinen<br />
rechtlichen Gesichtspunkten ein Rechtsanspruch<br />
von Grundstückseigentümern/innen<br />
auf grundwassersenkende<br />
Maßnahmen, denn öffentliche, industrielle<br />
und andere private Grundwasserförderungen<br />
bedürfen nach dem Wasserhaushaltsgesetz<br />
(WHG § 7 und 8)<br />
einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder<br />
einer Bewilligung.<br />
Um lokale Sanierungsmaßnahmen von<br />
Gebäuden und Altlasten zu ermöglichen,<br />
hat der Senat Ende der neunziger Jahren<br />
zwei Grundwasserregulierungsanlagen<br />
für einen temporären Einsatz errichtet.<br />
Dadurch konnten auch die Mitte der<br />
neunziger Jahre besonders zahlreich<br />
auftretenden Kellerwasserschäden im<br />
Einflussbereich der betroffenen Wasserwerke<br />
durch ansteigendes Grundwasser<br />
verringert werden. Im Jahr 2001 wurde<br />
dann die Grundwassersteuerungsverordnung<br />
(GruWaSteuV) erlassen, mit<br />
SenStadtUm <strong>Berlin</strong>,12. April <strong>2012</strong> - VI A - Tel.: 90139 4220<br />
dem Ziel siedlungsverträgliche Grundwasserstände<br />
im Rahmen der Trinkwasserversorgung<br />
durch den optimierten<br />
Einsatz der Wasserwerke im Urstromtal<br />
anzustreben. Aufgrund des anhaltend<br />
rückläufigen Trinkwasserbedarfs ergibt<br />
sich jedoch, dass aktuell im Einflussbereich<br />
der Wasserwerke dadurch nicht<br />
überall siedlungsverträgliche Grundwasserstände<br />
zu erzielen sind.<br />
Der Senat wird entsprechend der Koalitionsvereinbarung<br />
in diesem Jahr mit<br />
Fachleuten und Betroffenen Gesprächsrunden<br />
zum Umgang mit den<br />
Grundwasserständen durchführen.<br />
<strong>Berlin</strong>, den 27. Februar <strong>2012</strong><br />
In Vertretung<br />
Christian Gaebler<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
und Umwelt<br />
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am<br />
01. März. <strong>2012</strong>)<br />
Protokoll der 58. Vergabebesprechung am 9.Februar <strong>2012</strong><br />
TOP 1 Begrüßung<br />
Herr Groth (VI A) begrüßt die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer und stellt die<br />
Genehmigung des Protokolls der 57. Vergabebesprechung<br />
fest. Als neue Mitarbeiterinnen<br />
werden Frau Gandyra (VI A<br />
15) und Frau Tschugg (VI A 11) vorgestellt.<br />
Herr Meinhardt (VI A 14) ist leider<br />
auf Dauer erkrankt und wird aus dem<br />
Dienst ausscheiden.<br />
TOP 2 Aktuelle Berichterstattung<br />
Herr Groth referiert zur aktuellen Entwicklung<br />
des Vergaberechts seit der letzten<br />
Vergabebesprechung. Von den aktuellen<br />
Änderungen im europäischen<br />
Recht (insbesondere im Bereich Verteidigung<br />
und Sicherheit durch die RL<br />
2009/81/ EG) ist das Land <strong>Berlin</strong> nicht<br />
betroffen: Die Umsetzung in nationales<br />
Recht durch die Änderungen im GWB<br />
und die künftige besondere Rechtsverordnung<br />
des Bundes (VSVgV) und den<br />
künftigen 3. Abschnitt der VOB/A betrifft<br />
nicht die <strong>Berlin</strong>er Vergabestellen.<br />
Anders ist es mit den künftigen Änderungen<br />
des 2. Abschnitts der VOB/A (durchgeschriebene<br />
Fassung; kleinere redaktionelle<br />
Änderungen dazu - vgl. BAnz.<br />
Nummer 182a vom 02.12.2011)<br />
Die routinemäßige Änderung der EU-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 17<br />
Schwellenwerte ab dem 01.01.<strong>2012</strong><br />
durch die EUVerordnung Nummer<br />
1251/2011 vom 30.11.2011, deren<br />
Bestimmung durch die 5. Änderungsverordnung<br />
zur VgV vom 14. März <strong>2012</strong><br />
erfolgt ist (BGBl. I S. 844), führt für den<br />
Baubereich zum herkömmlichen Wert<br />
von 5 Mio EUR, für VOL- und VOF- Leistungen<br />
zu 0,2 Mio EUR.<br />
Nach § 1 Absatz 2 der Sektorenverordnung<br />
gilt – durch dortige dynamische<br />
Verweisung – der neue Wert von 0,4 Mio<br />
EUR direkt ohne besondere nationale<br />
Umsetzung.<br />
<strong>Berlin</strong> hatte sich übrigens im Bundesrat<br />
bereits – bisher vergeblich – um eine entsprechende<br />
Dynamisierungsregelung<br />
auch in der Vergabeverordnung eingesetzt.<br />
Die landesrechtlichen <strong>Berlin</strong>er Regelungen<br />
sollen einen Schwerpunkt bei einer<br />
der nächsten Vergabebesprechungen<br />
bilden.<br />
TOP 3<br />
Präsentation: Aktuelle Kammergrichtsentscheidung<br />
zur Vergabesperre<br />
beim unerlaubten Nachunternehmer-<br />
INGENIEURE BEEINDRUCKT WENIG.<br />
HÖCHSTENS DIE GÜNSTIGEN TARIFE<br />
DER PRIVATEN GRUPPENVERSICHERUNG<br />
FÜR INGENIEURE.<br />
Krankheitskostenvollversicherung<br />
220,96<br />
ab220,96 EUR/Mon.<br />
mtl. Beitrag für einen 35-jährigen<br />
Ingenieur nach Tarif BM 4/3<br />
mit 1.600 EUR Selbstbehalt p. a.<br />
einsatz (RA Dr. Volker Dobmann, <strong>Berlin</strong>)<br />
Herr Rechtsanwalt Dr. Dobmann (<strong>Berlin</strong>)<br />
referiert zur rechtskräftigen Entscheidung<br />
des Kammergerichts – 2 U 11/11<br />
Kart – vom 08.12. 2011 zur zulässigen<br />
Vergabesperre beim unerlaubten Nachunternehmereinsatz<br />
(Anlage).<br />
Im entschiedenen Fall konnte der Auftragnehmer<br />
<strong>Berlin</strong>s nicht belegen, sich –<br />
bei verschiedenen Gelegenheiten - sorgfältig<br />
und vollständig genug um den<br />
unerlaubten Nachunternehmereinsatz<br />
durch seine eigenen Subunternehmer<br />
gekümmert und derartige Vertragsverstöße<br />
auf der Ebene der Sub-Subunternehmer<br />
nicht verhindert zu haben.<br />
Es ist nunmehr bestätigt, dass auch derartige<br />
Vertragsverstöße zur Auftragssperre<br />
und auch Versagung einer ULV-<br />
Eintragung beim Hauptauftragnehmer<br />
führen können. Dies hat erhebliche Auswirkungen<br />
bei der wirksamen Bekämpfung<br />
von Schwarzarbeit, zu der sich <strong>Berlin</strong><br />
besonders verpflichtet sieht. Voraussetzung<br />
ist eine Dokumentation der<br />
Sachverhalte durch die jeweilige Dienststelle.<br />
Ich vertrau der DKV �<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
Die Baudienststellen sind aufgefordert,<br />
ihr Augenmerk verstärkt auf den tatsächlichen<br />
Einsatz von Arbeitskräften auf der<br />
Baustelle zu richten.<br />
Herr Dr. Dobmanns hat den Fall zugleich<br />
besprochen im VergabeR <strong>2012</strong>, 208 , 212<br />
(Anlage).<br />
Frau Hardge (VI A 38) weist auf folgendes<br />
hin:<br />
Unerlaubter Nachunternehmereinsatz<br />
sollte möglichst zeitnah an unser<br />
Haus gemeldet werden mit Angabe<br />
der Namen der Mitarbeiter, die angetroffen<br />
wurden, für welche Firma<br />
waren sie tätig, Datum.<br />
Auf die Einbeziehung des Hauptzollamts<br />
(RS VI A 11 /2009) wird ergänzend hingewiesen.<br />
TOP 4<br />
Bauwirtschaftliche Angelegenheiten<br />
Herr Neubauer (VI A 3) berichtet zu Angelegenheiten<br />
der Bauwirtschaft.<br />
Es wird auf das seit Herbst 2011 verwendete<br />
neue Layout für die bekannten<br />
Publikationen /Berichte des Bereiches<br />
verwiesen.<br />
Gestalten Sie als Ingenieur Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie jetzt<br />
noch effektiver.<br />
Die DKV bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß an<br />
Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die günstigen Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:<br />
BEITRAGSNACHLÄSSE UND KEINE WARTEZEITEN.<br />
� Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung<br />
für Ingenieure. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.<br />
� Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen<br />
für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke der<br />
Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben,<br />
verarbeitet und genutzt werden.<br />
Einfach ausschneiden und faxen: 02 21 / 5 78 -21 1 5<br />
Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln<br />
Telefon 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/ingenieure, ingenieur@dkv.com<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ, Ort<br />
Geburtsdatum Telefon privat/beruflich<br />
E-Mail<br />
Unterschrift<br />
� angestellt � selbstständig 180069807
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 18<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
Es folgt eine kurze Gesamtschau zu den<br />
Bereichen Statistische Daten, ULV und<br />
Korruptionsregister, die zum Teil die<br />
geleistete Arbeit der Vergabestellen des<br />
Landes <strong>Berlin</strong> darstellt.<br />
Bauwirtschaft<br />
„Den Bauunternehmen geht es gut.“<br />
– diese Einschätzung ist zu mindestens<br />
das Ergebnis einer Konjunkturumfrage<br />
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages<br />
(DIHK), die von<br />
Ende August bis Ende September<br />
2011 durchgeführt wurde.<br />
– niedriges Zinsniveau,<br />
– die Arbeitsplatzsicherheit und das gestiegene<br />
Einkommen<br />
– zurzeit vergleichsweise sichere Anlagealternative<br />
„Wohnimmobilie“ begünstigten<br />
in den vergangenen Monaten<br />
diese Entwicklung.<br />
Die zuständigen Verbände:<br />
– Handwerkskammer<br />
– Fachgemeinschaft Bau<br />
– Verband der Bauindustrie sprechen<br />
von einem regelrechten Boom steuerliche<br />
Erleichterungen, Förderprogramme<br />
(energetische Sanierung,<br />
altersgerechter Umbau etc.), der<br />
Wohnungsmarkt begünstigen diesen<br />
Verlauf.<br />
– Teilweise wird über „ausgeschöpfte<br />
Kapazitäten“ geklagt.<br />
Allgemeine Sorgen der Verbände:<br />
Rahmenbedingungen<br />
(u.a. Fachkräftesicherung, Rohstoffversorgung<br />
sichern, Auftragsvergabe, Bauforderungssicherungsgesetz,Schwarzarbeit)<br />
Wohnungsbau<br />
(u.a. steuerliche Anreize, Fördervolumen<br />
erhöhen und verstetigen)<br />
Infrastruktur<br />
(u.a. Sicherung und Durchführung von<br />
Großprojekten, Mittel für den Straßenbau<br />
aufstocken und verstetigen, Öffentlich<br />
Private Partnerschaften)<br />
Aktuelle Situation in <strong>Berlin</strong> (Stand<br />
November 2011) lässt sich wie folgt<br />
beschreiben:<br />
– Arbeitsstunden<br />
mehr geleistete Arbeitsstunden<br />
– Beschäftigungsstand<br />
mehr Beschäftigte<br />
– Umsatzvolumen<br />
höheres Umsatzvolumen<br />
gegenüber dem Vorjahr.<br />
18 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Auftragseingang<br />
Im November ein Plus von 19,8 %<br />
gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum (Jan.-Nov.) ein Plus<br />
von 5,8 %.<br />
Genehmigungen<br />
Errichtung neuer Gebäude sowie Baumaßnahmen<br />
an bestehenden Gebäuden<br />
in <strong>Berlin</strong> (Anzahl der Gebäude bzw. Baumaßnahmen<br />
und Anzahl der Wohnungen)<br />
ein Plus von 2,2 % bzw. 22 %<br />
gegenüber 2010<br />
Vergabeverhalten<br />
Gemäß den bis zum Zeitpunkt Ende<br />
Januar <strong>2012</strong> von den Vergabestellen<br />
übermittelten Vergabevermerken ergibt<br />
sich folgendes Bild:<br />
1.778 Aufträge, davon bezogen<br />
auf die Anzahl der Aufträge<br />
1.363 auf die<br />
Beschränkte Ausschreibung 77%<br />
294 auf die<br />
Öffentliche Ausschreibung 17%<br />
74 auf die<br />
Freihändige Vergabe 4%<br />
1.313 Aufträge (74 % ) gingen<br />
an <strong>Berlin</strong>er Firmen.<br />
Bauinsolvenzen / Aufrechnungen<br />
Die im Rahmen der Bauausführungen<br />
öffentlicher Baumaßnahmen bekannt<br />
gewordenen Insolvenzen werden bei<br />
SenStadtUm registriert und den Betroffenen<br />
wird mitgeteilt, ob Zahlungen<br />
geleistet werden können oder ob anstelle<br />
von Zahlungen mit Gegenforderungen<br />
aufgerechnet werden soll.<br />
In den zwölf Monaten des Jahres 2011 (I.<br />
- IV. Quartal) wurden bei SenStadtUm 58<br />
Fälle gegenüber 77 im gleichen Zeitraum<br />
2010 bearbeitet. Dies ergibt einen Rückgang<br />
von 24,7 % (Stand 31.12.2011).<br />
Von den 58 Insolvenzfällen waren 22 im<br />
ULV eingetragen, 36 nicht eingetragen,<br />
46 insolvente Firmen aus <strong>Berlin</strong>, 6 aus<br />
Brandenburg und 6 aus dem übrigen<br />
Bundesgebiet.<br />
Für das Jahr 2011 ergeben die offiziellen<br />
Zahlen des Amtes für Statistik <strong>Berlin</strong>-<br />
Brandenburg in Bezug auf Insolvenzen<br />
im <strong>Berlin</strong>er Baugewerbe einen Rückgang<br />
von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr (207<br />
Fälle 2011 zu 228 Fällen 2010), in Bezug<br />
auf Insolvenzen im Land Brandenburg<br />
ergibt sich per III. Quartale ein Rückgang<br />
von 9,8 % gegenüber dem Vorjahr (95<br />
Fälle im Jahr 2011 zu 104 Fällen im Jahr<br />
2010).<br />
Für die Bundesstatistik kann zum Insolvenzstand<br />
lt. Statistischem Bundesamt<br />
in Bezug auf das Baugewerbe im Vergleich<br />
der Jahre 2011 zu 2010 erst im<br />
Verlauf des I. Quartals <strong>2012</strong> eine Aussage<br />
getroffen werden.<br />
Stand Aufrechnungen 2011<br />
Mittels bearbeiteter Aufrechnungsvorgänge<br />
für die Baudienststellen <strong>Berlin</strong>s<br />
(ohne Insolvenzfälle) finanziellen Schaden<br />
für das Land <strong>Berlin</strong> abgewendet:<br />
Jahr Fälle in Höhe von<br />
2010 7 ca. 250.000 EUR<br />
2011 8 ca. 169.000 EUR<br />
Mittels durchgeführter Aufrechnungen<br />
bei Insolvenzvorgängen finanziellen<br />
Schaden für das Land <strong>Berlin</strong><br />
abgewendet:<br />
Jahr Fälle in Höhe von<br />
2010 6 ca. 61.700 EUR<br />
2011 5 ca. 31.500 EUR<br />
Präqualifikation / ULV<br />
Unternehmer und Lieferantenverzeichnis<br />
für öffentliche Aufträge (ULV).<br />
Die Eignungsprüfung erfolgt durch Sen-<br />
StadtUm Abt. VI als frontoffice für die<br />
Auftragsvergabestellen der Region <strong>Berlin</strong>-Brandenburg.<br />
Damit gelten die von den öffentlichen<br />
Auftraggebern bei Vergabeverfahren zu<br />
fordernden auftragsunabhängigen Einzelnachweise<br />
über die Fachkunde, Leistungsfähigkeit<br />
und Zuverlässigkeit als<br />
Eintragungsvoraussetzung im Grundsatz<br />
als erbracht.<br />
Zurzeit sind im ULV 3.629 Firmen eingetragen;<br />
davon 2.676 aus <strong>Berlin</strong>.<br />
Im PQ VOB sind 6.736 Firmen eingetragen;<br />
davon 335 aus <strong>Berlin</strong>.<br />
Nachunternehmereinsatz<br />
In diesem Zusammenhang wird auf das<br />
Rundschreiben SenStadt VI A Nr.<br />
11/2009 (29. September 2009, mit Hinweisen<br />
Februar <strong>2012</strong>, siehe Anhang)<br />
„Eigenkontrolle des Nachunternehmereinsatzes<br />
durch die Baudienststellen“<br />
hingewiesen.<br />
Die Vergabestellen werden gebeten, im<br />
Fall der Feststellung eines nichterlaubten<br />
Nachunternehmereinsatzes in ihrem<br />
Zuständigkeitsbereich diese Information<br />
unverzüglich an die zentrale Stelle der<br />
Baudokumentation – SenStadtUm VI A 3<br />
–(VI A 38) zu melden. Damit ist eine<br />
Berücksichtigung insbesondere bei der<br />
„Präqualifikation“ möglich.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 19<br />
Probleme / Bitte<br />
Der Bereich SenStadtUm VI A 3 erstellt<br />
Statistiken und führt Register für den<br />
Geschäftsbereich des Landes <strong>Berlin</strong>.<br />
Dies erfolgt durch die Aufbereitung von<br />
Daten, die auf Grund nichtstatistischer<br />
Rechts- und Verwaltungsvorschriften<br />
oder auf sonstige Weise bei den Verwaltungsstellen<br />
<strong>Berlin</strong>s anfallen (Daten im<br />
Verwaltungsverzug, insbesondere Geschäfts-<br />
und Registerstatistiken) bzw.<br />
durch Abgabe von Eigenerklärungen und<br />
Meldungen Dritter.<br />
Fazit<br />
Unser Datenpool und Service ist nur so<br />
gut, wie die Summe ihrer Grundlagen<br />
und damit Ihrer Zuarbeit.<br />
TOP 5<br />
Neue Rundschreiben; Anweisung Bau<br />
Frau Menger (VI A 1) referiert die bisherigen<br />
neuen Rundschreiben des Hauses<br />
und stellt den Stand der Neufassung der<br />
ABau exemplarisch anhand des Inhaltsverzeichnisses<br />
dar.<br />
Frau Tschugg führt zur ABau aus:<br />
Formularserver<br />
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
und Umwelt hat einen eigenen Formularserver<br />
in Betrieb genommen. Als<br />
erste Anwendung wird die geltende<br />
ABau mit ihren kompletten Anlagen über<br />
diesen Server im Internet (Grenznetz) zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Die Umstellung war erforderlich<br />
– da Aufgrund lizenzrechtlicher Probleme<br />
das Speichern der PDF-Formulare<br />
der ABau mit einer Adobe Reader Version<br />
> 8 nicht möglich war,<br />
– im Vorgriff auf die Neufassung der<br />
ABau, für die die Bereitstellung von<br />
assistentengesteuerten Formularen<br />
geplant ist.<br />
Bereits im September 2011 wurden die<br />
Anlagen zu den Rundschreiben 04/2011<br />
(Rahmenverträge für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen)<br />
sowie 05/2011<br />
(Besondere Vertragsbedingungen) auf<br />
den Server gestellt. Im Dezember 2011<br />
erfolgte die Umstellung der geltenden<br />
ABau.<br />
Somit ist das Abspeichern der Formulare<br />
mit allen Adobe Reader-Versionen wieder<br />
gewährleistet. Andere Reader sind<br />
nicht zu verwenden.<br />
Frau Tschugg demonstriert das Öffnen<br />
und Speichern der PDF-Formulare und<br />
weist dabei auf einige technische Besonderheiten<br />
des Formularservers hin. Hinweise<br />
hierzu sind in der Anlage des<br />
Rundschreibens Nr. 6 / 2011 zur Umstellung<br />
der ABau auf den Formularserver<br />
enthalten.<br />
Zu Beginn der Umstellung gab es<br />
Probleme<br />
– die aus der unterschiedlichen IT-Infrastruktur<br />
resultierten und durch lokale<br />
Anpassungen in den Bezirken zu<br />
lösen waren;<br />
– mit der Handhabung einiger Formulare;<br />
da diese nicht für den Formularserver<br />
entwickelt wurden, waren (trotz<br />
breiter Tests im Vorfeld) in wenigen<br />
Fällen Nacharbeiten durch den Kulturbuchverlag<br />
erforderlich.<br />
Frau Tschugg bittet, bestehende Probleme<br />
zu melden und dankt all jenen, die<br />
bislang<br />
haben.<br />
davon Gebrauch gemacht<br />
SharePoint<br />
Frau Tschugg erläutert die Funktion des<br />
SharePoint als „virtuelles Büro“ für die<br />
Abstimmung der Entwurfstexte der Neufassung<br />
der ABau auf Fachebene. Teilnehmer<br />
sind die Abteilungen der Senatsverwaltung<br />
für Stadtentwicklung und<br />
Umwelt sowie bezirkliche Hochbau-,<br />
Tiefbau- und Grünflächenämter. In den<br />
SharePoint werden die Entwurfstexte der<br />
ABau (gestaffelt nach Teilen) eingestellt.<br />
Aktuelle/ angekündigte Veröffentlichungen:<br />
bis 15.02. <strong>2012</strong><br />
Evaluation des Wirtschaftlichkeitsleitfadens<br />
2007<br />
20.02.-29.03.<strong>2012</strong><br />
ABau Teil V – Vergabe- und Vertragshandbuch<br />
für Bauleistungen<br />
19.03.-26.04.<strong>2012</strong><br />
ABau Teil IV – Vergabe- und Vertragshandbuch<br />
für freiberufliche Leistungen<br />
Frau Tschugg lädt alle Baudienststellen<br />
ein, sich aktiv an die Neufassung der<br />
ABau zu beteiligen. Der externe Nutzerkreis<br />
ABau auf dem SharePoint ist für<br />
weitere Mitglieder offen. Nutzerkennung<br />
und Passwort sind über Frau Tschugg zu<br />
beantragen.<br />
Frau Gandyra (VI A 15) ergänzt:<br />
Die Evaluierung des Leitfadens für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
ist mangels<br />
Beteiligung zu wiederholen. Sie wurde<br />
nach Anforderung durch den Rechnungshof<br />
im Mai 2010 erstmals durchge-<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
führt. Alle Hochbau-, Tiefbau- und Grünflächenämter<br />
sowie die Abteilungen von<br />
SenStadt werden bis zum 17.02.2010<br />
um Stellungnahme gebeten.<br />
Frau Stephan (VI A 17) erläutert,<br />
ob die Wertgrenzen aus § 3 Abs. 3 Nr. 1<br />
VOB/A als Begründung zum Abweichen<br />
vom Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung<br />
herangezogen werden können:<br />
Nach Nummer 7 AV § 55 LHO <strong>Berlin</strong> und<br />
§ 3 Absatz 2 VOB/A 2009 und § 3 Absatz<br />
2 VOL/A müssen öffentliche Auftraggeber<br />
grundsätzlich die Öffentliche Ausschreibung<br />
wählen und dürfen nur davon<br />
abweichen, wenn die Voraussetzungen<br />
nach dem jeweiligen § 3 der VOB/A und<br />
der VOL/A vorliegen. Hierbei ist der<br />
Gesamtauftragswert anlog § 1a Abs. 1<br />
Nr. 1VOB/A nicht mehr maßgebend. Bis<br />
zu den in § 3 Abs. 3 VOB/A genannten<br />
Auftragswerten kann aus Gründen der<br />
Verhältnismäßigkeit eine Beschränkte<br />
Ausschreibung im Frage kommen. In<br />
jedem Fall ist zu prüfen, ob auch unterhalb<br />
der in § 3 Absatz 3 VOB/A genannten<br />
Auftragswerte eine Öffentliche Ausschreibung<br />
geboten ist. Die Beschränkte<br />
Ausschreibung und die Freihändige Vergabe<br />
stellen Ausnahmetatbestände dar<br />
und dürfen nicht dazu verwendet werden,<br />
den Grundsatz der Öffentlichen<br />
Ausschreibung zu umgehen. Das Ergebnis<br />
ist zu dokumentieren.<br />
Mit dieser Auslegung ist eine Änderung<br />
der bisherigen bei VI A vorhandenen<br />
Sichtweise verbunden. Die vorgenannte<br />
Lesart orientiert sich an dem Text des<br />
VHB des Bundes. Laut einer Länderumfrage<br />
vertritt die Mehrzahl der Länder<br />
diese Meinung, der sich VI A nunmehr<br />
anschließt.<br />
TOP 6<br />
Aus der Beratungspraxis;<br />
Verschiedenes<br />
Herr Klemesch (VI A 16) führt aus:<br />
Manipulation von Angeboten nach § 16<br />
Abs. 1 Nr. 3 VOB/A in Verbindung mit § 15<br />
Abs. 2 VOB/A.<br />
Bisher mussten nach § 21 Abs. 1 Nr. 2<br />
VOB/A 2006 die Angebote alle Preise<br />
und Erklärungen enthalten, deren Nichtvorlage<br />
führte nach § 25 Abs. 1 Nr. 1b<br />
VOB/A ohne Ermessensspielraum zum<br />
Ausschluss, ein Nachreichen war nicht<br />
möglich.<br />
Neu geregelt wurde mit dem § 16 Abs. 1<br />
Nr. 3 VOB/A 2009 dass der der Auftraggeber<br />
innerhalb von 6 Kalendertagen die<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 19
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 20<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
fehlenden Nachweise und Erklärungen<br />
nachfordern muss, ansonsten droht<br />
zwingender Angebotsausschluss.<br />
Nicht verwechseln mit § 15 Abs. 2 VOB/A<br />
– Aufklärung des Angebotsinhalts –<br />
Dadurch dass ein Bieter zumindest eine<br />
mit dem Angebot geforderte notwendige<br />
Erklärung, bzw. einen Nachweis (ggf.<br />
sogar bewusst) nicht abgegeben hat,<br />
sind neue Manipulationsmöglichkeiten<br />
entstanden:<br />
– nach Absprache mit einem bekannten<br />
Mitbieter gibt der günstigste Bieter<br />
nach Submission die fehlenden Erklärungen<br />
/ Nachweis nicht ab und wird<br />
ausgeschlossen, der Nächstplatzierte<br />
beauftragt und die Differenz von beiden<br />
als Gewinn geteilt<br />
– ein Bieter bietet deutlich günstiger an<br />
als die Konkurrenz. Ein vorsorglich<br />
nicht beigefügter und nicht nachgereichter<br />
Nachweis führt zum Ausschluss.<br />
Die Gründe können u. a. sein:<br />
– ein erkannter Kalkulationsirrtum des<br />
Bieters, nach Angebotsabgabe<br />
–<br />
erfolgte Preissteigerungen, anderweitige<br />
lukrativere Aufträge u. ä.<br />
ein Bieter gibt mehrerer Hauptangebote<br />
ab. Der betreffende Bieter könnte<br />
dann in Kenntnis des Submissionsergebnisses<br />
das Angebot benennen,<br />
welches er in der Wertung belässt.<br />
Dazu Entscheidung OLG Düsseldorf<br />
mit Beschluss vom 09.03.2011 (VII<br />
Verg.-Nr. 52/10):<br />
unter:<br />
http://www.vergabeblog.de/2011-05-<br />
18/olg-dusseldorf-zur-zulassigkeit-mehrerer-hauptangebote-beschluss-vom-09-<br />
03-2011-vii-verg-5210/<br />
20 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Um dem vorzubeugen sollte Folgendes<br />
beachtet werden:<br />
– mit dem Angebot abzugebende Erklärungen/Nachweise<br />
möglichst gering<br />
halten<br />
– bestimmte Angaben erst gesondert<br />
nachreichen lassen<br />
– nur im Ausnahmefall Leitfabrikate vorgeben,<br />
aber mit dem Zusatz „oder<br />
gleichwertig“ und Angabe des vorgesehenen<br />
Produkts/Fabrikats<br />
– Bietererklärung, dass bei fehlenden<br />
Angaben das Leitfabrikat angeboten<br />
wird.<br />
Der BGH hat bereits entschieden, dass,<br />
weigert sich ein Bieter trotz bindendem<br />
Angebot ernsthaft und endgültig den<br />
Auftrag vertragsgemäß zu erbringen,<br />
hierin eine Pflichtverletzung vorliegt.<br />
– Bei begründetem Verdacht möglicher<br />
Ausschluss nach § 16 Abs. 2 Buchst.<br />
c VOB/A wegen unlauteren Wettbewerbs<br />
und unterlaufen eines fairen<br />
und uneingeschränkten Wettbewerbs<br />
(konkreter Nachweis im Einzelfall)<br />
– Schadenersatzpflicht für die entstehenden<br />
Mehrkosten, wenn ein erstplatzierter<br />
Bieter trotz Aufforderung<br />
fehlende Erklärungen / Nachweise<br />
nicht nachreicht, obwohl ihm dies<br />
nach den Umständen des Einzelfalls<br />
möglich und zumutbar wäre.<br />
Wenn ein Bieter sich wiederholt weigert,<br />
Erklärungen/Nachweise auf Aufforderung<br />
hin nachzureichen, sollte für zukünftige<br />
Vergabeverfahren ein Ausschluss<br />
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A (Grundsätze)<br />
in Erwägung gezogen werden.<br />
Negative Preise im Angebot<br />
Nach den aktuellen Regelungen der<br />
ABau <strong>Berlin</strong>, Formblatt III 9H der, Punkt B<br />
– Ergänzungen für <strong>Berlin</strong>- sind Hauptangebote<br />
mit negativen Preisen von der<br />
Wertung auszuschließen.<br />
Dazu Entscheidung vom OLG Düsseldorf<br />
zum Thema negative Preise mit<br />
Beschluss vom 22.12.2010 – Verg 33/10.<br />
Demnach darf der Auftraggeber keine<br />
Vorgaben machen, die sich ausschließlich<br />
auf die Preishöhe beziehen. Der<br />
Beschluss ist unter:<br />
http://www.dstgbvis.de/home/rechtsprechung/olg_duesseldorf_zum_verbot_negativer_einheitspreise/index.html<br />
abrufbar. Diese Regelung wird zukünftig<br />
in die ABau übernommen.<br />
Definition des Begriffs Ausbaugewerke<br />
Im Gewerberecht gibt es keine allgemeingültige<br />
und konkrete Festlegung der<br />
Tätigkeiten, die zum Ausbaugewerbe<br />
zählen. Einfach gesagt ist alles, was nicht<br />
Bauhauptgewerk ist, Ausbaugewerk. Die<br />
Zuordnung der Berufe in der Handwerksordnung<br />
ist eine rein handwerksspezifische<br />
Klassifikation.<br />
Zur Vermeidung von Streitigkeiten sollte<br />
in den Bauverträgen vorab festgelegt<br />
werden, welche Zuordnung bei den einzelnen<br />
Gewerken zu treffen ist.<br />
Hinweise zum Thema sind unter<br />
http://www.vwb.bv.tum.de/files/Definition<br />
-Bauhauptgewerbe.pdf<br />
zu finden.<br />
Groth
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 21<br />
Etwa 80 km nordwestlich <strong>Berlin</strong>s – am<br />
Nordrand des Eberswalder Urstromtals –<br />
überwindet der Oder-Havel-Kanal, eine<br />
der wichtigsten Wasserstraßen Ostdeutschlands,<br />
einen Geländesprung von<br />
36 m. Das hierzu vor über 75 Jahren<br />
errichtete Schiffshebewerk Niederfinow<br />
erhält nun in unmittelbarer Nähe einen<br />
Nachfolger, während das Bestandsbauwerk<br />
als Industriedenkmal erhalten<br />
bleibt.<br />
Der Neubau mit insgesamt 133 m Länge<br />
und über 65 m Höhe wird analog zur<br />
Bestandskonstruktion als Senkrechthebewerk<br />
mit Gewichtsausgleich durch<br />
Gegengewichte ausgeführt. Dessen<br />
Haupttragwerk wird jedoch nicht wie bisher<br />
aus Stahl, sondern überwiegend in<br />
Stahlbeton errichtet. Dieses besteht im<br />
Wesentlichen aus der Trogwanne mit<br />
einer Sohle in etwa 9 m Tiefe unter<br />
Geländeniveau (Bilder 1 und 2), vier darin<br />
gegründeten Stahlbetontürmen (Pylonen)<br />
und je sechs Stahlbetonstützen an<br />
beiden Längsseiten mit etwa 55 m Höhe<br />
Bild 2: Sohle des neuen Schiffshebewerks Niederfinow<br />
Neues Schiffshebewerk Niederfinow<br />
Dr.-Ing. Ralf Gastmeyer<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
Bild 1: Baugrube des neuen Schiffshebewerks Niederfinow<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 21
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 22<br />
Baugeschehen / Stadtentwicklung<br />
über Terrain. Pylone und<br />
Trogwanne bilden durch ihre<br />
biegesteife Verbindung in der<br />
Hebewerksquerrichtung<br />
einen Halbrahmen, während<br />
die Stützen am Fußpunkt nur<br />
in Hebewerkslängsrichtung<br />
durch auf der Trogwannensohle<br />
angeordnete Wandschotte<br />
eingespannt sind.<br />
Am Kopfpunkt werden die<br />
beiden Stützenreihen in<br />
Hebewerkslängsrichtung<br />
durch etwa 125 m lange<br />
Stahlkastenträger mit jeweils<br />
zwei Pylonen gekoppelt. Die<br />
beiden Kastenträger nehmen<br />
die Lasten des wassergefüllten<br />
Troges und der Gegengewichte<br />
auf, die über rollengeführte<br />
Seile im Gleichgewicht<br />
gehalten werden.<br />
Allein der wassergefüllte<br />
Stahltrog des neuen Hebewerks,<br />
der über eine Länge<br />
von etwa 125 m und eine<br />
Breite von ungefähr 28 m verfügt,<br />
wiegt mehr als 9000 Tonnen. Er ist<br />
durch insgesamt 224 Seile mit 220<br />
Gegengewichten und 4 Seilgewichtsausgleichsketten<br />
aufgehängt. Das<br />
Antriebs- und Sicherungssystem des<br />
Troges befindet sich an den Pylonen und<br />
besteht im Wesentlichen aus vier Zahnrädern<br />
– sogenannten Ritzeln, die in<br />
Triebstockleitern an den Pylonwänden<br />
greifen, bzw. aus vier Spindeln (Drehriegeln),<br />
die sich in sogenannten Mutterbackensäulen<br />
mitdrehen und im Havariefall<br />
arretieren.<br />
Die Scheitelhaltung der Oder-Havel-<br />
Wasserstraße schließt an das Hebewerk<br />
mit einer ca. 65 m langen Kanalbrücke<br />
an, die ihre Lasten auf die westlichen<br />
Endstützen der Hebewerkskonstruktion<br />
und ein gesondertes Widerlagerbauwerk<br />
abgibt. Das Widerlager ist auf 28 Großbohrpfählen<br />
mit bis zu 30 m Länge<br />
gegründet.<br />
Die Trogwanne des neuen Hebewerks<br />
mit ihrer 2,40 m bis 3,00 m dicken Sohle<br />
und den bis zu 3,80 m starken Wänden<br />
sowie das Widerlager für die Kanalbrük-<br />
Bild 4: Ausführung der Stützen und Montage des Stahltrogs für das neue Schiffshebewerk<br />
22 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Bild 3:<br />
Trogwanne des neuen Schiffshebewerks<br />
(unterwasserseitiger Abschluss)<br />
ke sind mittlerweile fertiggestellt. Die in<br />
Kletterbauweise herzustellenden Stahlbetonstützen<br />
mit konstanter Dicke von<br />
1,40 m und veränderlicher Breite von<br />
4,20 m am Stützenfuß bis 8,30 m am<br />
Stützenkopf haben momentan eine Höhe<br />
von etwa 19 m erreicht (Bilder 3 und 4).<br />
Bei Ausführung der Stützen und der<br />
Pylone, welche die gesamte Trogantriebs-<br />
und Sicherungstechnik aufnehmen,<br />
muss besonderes Augenmerk auf<br />
die erforderliche Kompensation der bauzeitlich<br />
zunehmenden Schiefstellung<br />
infolge ungleichmäßiger Bauwerkssetzung<br />
und der im Endzustand eintretenden<br />
Krümmungen aufgrund exzentrischer<br />
Einleitung der Seilrollenträgerlasten<br />
sowie des Betonkriechens und<br />
Schwindens gerichtet werden. Die Kontrolle<br />
der im Bauzustand einzuhaltenden<br />
Verformungswerte und Anpassung der<br />
Schalungskoordinaten erfolgt im Rahmen<br />
eines umfangreichen Messprogramms,<br />
dessen Ergebnisse laufend mit<br />
den rechnerischen Verformungen abgeglichen<br />
werden.<br />
Die Inbetriebnahme des neuen Schiffshebewerks<br />
soll im Jahr 2016 erfolgen.<br />
Hiermit ist die Leistungsfähigkeit des<br />
Großschifffahrtswegs <strong>Berlin</strong>-Stettin auch<br />
zukünftig sichergestellt.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 23<br />
Wahl zur 10. Vertreterversammlung der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Bekanntmachung zur Briefwahl<br />
vom 14. März <strong>2012</strong><br />
Telefon: 797443-0<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Nach § 5 Abs. 1 der Wahlordnung (WO) vom 27. Oktober 1999 in der Fassung vom 25. Oktober 2006, genehmigt durch die<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am 18. Juni 2007 (ABl. S. 1989), lädt der Wahlvorstand zur Briefwahl der Vertreter zur<br />
10. Vertreterversammlung der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> ein.<br />
Das Wählerverzeichnis im Sinne des § 4 WO liegt vom 10. Juli <strong>2012</strong> bis 07. August <strong>2012</strong> in der Geschäftsstelle der <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong>, Gutsmuthsstraße 24, 12163 <strong>Berlin</strong> (Steglitz), von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr und freitags von<br />
9 bis 14 Uhr aus.<br />
Gleichzeitig kann dort auch die Wahlordnung eingesehen werden.<br />
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen:<br />
Wahlvorschläge gemäß § 6 WO zur 10. Vertreterversammlung, getrennt nach Fachgruppen sowie getrennt nach Pflichtmitgliedern<br />
und Freiwilligen Mitgliedern, sind ab sofort bis zum 23. Juli <strong>2012</strong> beim Wahlvorstand schriftlich einzureichen.<br />
Vorschlagsberechtigt sind nach § 6 Abs. 4 WO:<br />
a) die Fachgruppen der Kammer,<br />
b) die berufsständischen Ingenieurverbände<br />
c) Einzelbewerber - Wahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen von mindestens zehn Wahlberechtigten unter Angabe<br />
ihres Namens und ihrer Mitgliedsnummer unterschrieben sein.<br />
Von jedem/r Bewerber/in ist eine schriftliche Erklärung beizufügen, dass er/sie mit der Aufstellung im Wahlvorschlag einverstanden<br />
ist und im Falle der Wahl, diese annehmen wird.<br />
Die Wahlvorschlagsverzeichnisse, getrennt nach Art der Mitgliedschaft gemäß § 41 des <strong>Berlin</strong>er Architekten- und <strong>Baukammer</strong>gesetzes<br />
(A<strong>BK</strong>G) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 709), das zuletzt durch Gesetz vom 28.<br />
November 2009 (GVBl. S. 677) geändert worden ist, liegen vom 30. Juli <strong>2012</strong> bis 13. August <strong>2012</strong> zu den Geschäftszeiten in der<br />
Geschäftsstelle der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong>, Gutsmuthsstraße 24, 12163 <strong>Berlin</strong> (Steglitz) aus.<br />
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis sind schriftlich bis zum 07. August <strong>2012</strong>, gegen die Wahlvorschlagsverzeichnisse bis<br />
zum 13. August <strong>2012</strong> beim Wahlvorstand einzulegen. Der Wahlvorstand wird unverzüglich über den Einspruch entscheiden und<br />
seine Entscheidung dem Einsprechenden zustellen.<br />
Die Wahlbriefe werden ab 16. August <strong>2012</strong> an die Wahlberechtigten verschickt.<br />
Nach Wahlschluss am 22. Oktober <strong>2012</strong> um 15:00 Uhr (Ausschlussfrist) wird das Wahlergebnis in einer für alle Wahlberechtigten<br />
öffentlichen Sitzung des Wahlvorstandes am 25. Oktober <strong>2012</strong> ab 12:00 Uhr in der Geschäftsstelle der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong>,<br />
Gutsmuthsstraße 24, 12163 <strong>Berlin</strong> ermittelt. Verspätet eingehende Wahlbriefe dürfen bei der Stimmenauszählung nicht<br />
berücksichtigt werden.<br />
Dipl.-Ing. Axel Wipplinger Fachgruppe 4<br />
(Vorsitzender)<br />
Dipl.-Ing. (FH) Mario Zelasny Fachgruppe 2, 4, 5, 6<br />
(Stellvertreter)<br />
Dipl.-Ing. Heinz-Ch. Herzberg Fachgruppe 5, 6<br />
Dipl.-Ing. Sten Höpfner Fachgruppe 2<br />
Der Wahlvorstand<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Dipl.-Ing. Gerhard Hörnig Fachgruppe 3<br />
Dipl.-Ing. Thomas Reuthe Fachgruppe 1, 5<br />
Dipl.-Ing. (FH) Christian Willich Fachgruppe 1, 5, 6<br />
Dipl.-Geol. Andreas Zill Fachgruppe 1, 6<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 23
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 24<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Kurzfassung<br />
Stahlbetondeckenplatten mu?ssen unter<br />
den real auftretenden Beanspruchungen<br />
stets die bestimmungsgemäße Funktion<br />
und ein angemessenes Erscheinungsbild<br />
aufweisen. Der Nachweis der Begrenzung<br />
von Verformungen ist dabei ein<br />
wesentlicher Bestandteil zur Sicherstellung<br />
dieser grundlegenden Anforderungen<br />
an die Gebrauchstauglichkeit.<br />
Die Größe der Verformung von Stahlbetonbauteilen<br />
wird neben direkten<br />
Lasteinwirkungen maßgeblich durch das<br />
zeitabhängige Kriech- und Schwindverhalten<br />
von Beton beeinflusst. Einen entscheidenden<br />
Einfluss auf die anfängliche<br />
und nachträgliche Verformung hat<br />
zudem die Rissbildung im Bauteil, die<br />
wiederum von der stark schwankenden<br />
Betonzugfestigkeit abhängig ist. Eine<br />
explizite Verformungsberechnung steht<br />
zwar als mögliche Nachweisvariante zur<br />
Verfügung, diese setzt jedoch immer die<br />
Kenntnis bzw. Annahme zahlreicher Einflussfaktoren<br />
sowie der Material- und<br />
Querschnittskennwerte voraus. Da die<br />
Begrenzung der Durchbiegung in der<br />
Regel für die Querschnittsdimensionierung<br />
maßgebend ist, gestaltet sich der<br />
Nachweis der Verformungen über eine<br />
explizite Berechnung aufgrund umfangreicher<br />
Überlegungen hinsichtlich der<br />
komplexen Zusammenhänge und einer<br />
aufwendigen iterativen Vorgehensweise<br />
äußerst schwierig. Aus diesem Grund<br />
werden Stahlbetondeckenplatten in der<br />
Praxis über Schlankheitskriterien dimensioniert<br />
und so gleichzeitig eine vereinfachte<br />
Nachweisführung erbracht.<br />
Die Regelung zum Nachweis der Verformungen<br />
in der bisher gültigen, nationalen<br />
Stahlbetonbau-Norm, DIN 1045-<br />
1:2008 basiert auf Untersuchungen aus<br />
den 1960er Jahren und entspricht nicht<br />
den heutigen Gegebenheiten. Mit der<br />
neuen DIN EN 1992-1-1, als Ersatz für<br />
die DIN 1045-1 ergibt sich ein scheinbar<br />
24 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
<strong>Baukammer</strong>-Preis 2011<br />
1. Preis in der Gruppe der Masterarbeiten und Diplom-Arbeiten (TUB) für seine Master-Arbeit:<br />
„Untersuchungen zur Durchbiegung von<br />
Stahlbetondeckenplatten und Bewertung der vereinfachten<br />
Biegeschlankheitsnachweise verschiedener Ansätze“<br />
Verfasser: Adrian Grabara M.Eng.<br />
1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Andreas Fischer · 2. Gutachter: Prof. Dipl.-Ing. Frank Prietz<br />
v.l.n.r.: Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft, Adrian Grabara, Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
genauerer Nachweis unter Berücksichtigung<br />
zusätzlicher wichtiger Einflussparameter.<br />
Daneben existieren weitere<br />
Nachweisvorschläge zur Begrenzung<br />
der Verformungen über Schlankheitskriterien,<br />
für die eine weiterführende Untersuchung<br />
sinnvoll erscheint.<br />
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden<br />
die bestehenden Regelungen und<br />
Nachweisverfahren zur Begrenzung der<br />
Verformungen zusammengestellt und<br />
kritisch miteinander verglichen. Zur<br />
Beurteilung der Sicherheit, Zuverlässigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit der vorhandenen<br />
Biegeschlankheitsnachweise wurden<br />
dabei umfangreiche nichtlineare<br />
Untersuchungen zu der Durchbiegung<br />
von Stahlbetondeckenplatten an ebenen<br />
Stabwerken und räumlichen Plattenmodellen<br />
unter Berücksichtigung von Kriechen<br />
und Schwinden und der Mitwirkung<br />
von Beton auf Zug (tension stiffening)<br />
sowie unter Variation verschiedener Einflussparameter<br />
durchgeführt.<br />
Auf Grundlage der gewonnenen Daten<br />
konnten eine Beurteilung der Eignung<br />
einzelner Verfahren und deren Anwendungsgrenzen<br />
erarbeitet und Anregungen<br />
zur weiteren Optimierung gegeben<br />
werden. Um die Zuverlässigkeit der Auswertung<br />
zu steigern, wurden zudem<br />
nichtlineare Untersuchungen zur Erfassung<br />
der Auswirkungen von abweichenden<br />
Material- und Systemparametern<br />
auf die zu erwartende Größe der Verformungen<br />
angestellt.<br />
Die Eignung der im Rahmen dieser Arbeit<br />
angesetzten Material- und Rechenmodelle<br />
wurde dabei durch verschiedene<br />
Nachrechnungen zu Bauteilkurz- und<br />
Langzeitversuchen sowie zu ausgewählten<br />
Studien bestätigt.<br />
Neben der Bewertung der Biegeschlank-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 25<br />
heitsnachweise ermöglichten<br />
die Untersuchungen außerdem<br />
eine Beurteilung der Einflussmöglichkeiten<br />
des Planers hinsichtlich<br />
gezielter konstruktiver<br />
und betontechnologischer Vorgaben<br />
für eine indirekte Begrenzung<br />
der Verformungen.<br />
In der nachfolgenden Abbildung<br />
1 sind exemplarisch die erforderlichen<br />
Nutzhöhen aus den<br />
Anforderungen der einzelnen<br />
Biegeschlankheitsnachweise<br />
und der nichtlinearen Berechnungen<br />
für einachsig gespannte,<br />
gelenkig gelagerte Einfeldplatten<br />
dargestellt.<br />
Die Nutzhöhen nach DIN 1045-1<br />
liegen vor allem bei geringen<br />
Betongüten deutlich auf der unsicheren<br />
Seite. Über den Biegeschlankheitsansatz<br />
nach DIN EN 1992-1-1 lässt sich<br />
unter der vereinfachten Annahme eines<br />
Bewehrungsgrades von 0,5 % in vielen<br />
Fällen eine sichere Begrenzung des Dek-<br />
kendurchhangs erzielen. Der Einfluss der<br />
Betonfestigkeit wird allerdings nur ungenau<br />
erfasst. Dies führt insbesondere bei<br />
niedrigen Betongüten und geringen<br />
Spannweiten zu sehr unwirtschaftlichen<br />
Ergebnissen. Das Nachweisverfahren<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
nach A. Fischer wiederum liefert<br />
für unterschiedliche Bedingungen<br />
sichere und wirtschaftliche<br />
Nutzhöhen zugleich.<br />
Die Abbildung 2 zeigt die erforderlichen<br />
Nutzhöhen bei erhöhten<br />
Anforderungen an die<br />
Durchbiegung für zweiachsig<br />
gespannte, quadratische Dekkenplatten<br />
mit allseitig gelenkiger<br />
Lagerung. Der deutliche<br />
Einfluss eines zweiachsigen<br />
Lastabtrages bleibt auch nach<br />
DIN EN 1992-1-1 vollständig<br />
unberücksichtigt. Eine wirtschaftliche<br />
Dimensionierung<br />
der Deckendicke ist in diesem<br />
Fall nur beschränkt realisierbar.<br />
Es zeigt sich wiederholt, dass<br />
die Schlankheitskriterien nach DIN EN<br />
1992-1-1 nur eingeschränkt den hohen<br />
Anforderungen an die heutige Normgeneration<br />
gerecht werden.<br />
Preis der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> <strong>2012</strong><br />
für besonders gute Abschlussarbeiten auf dem Gebiet des Bauingenieur- und Vermessungswesens<br />
an den <strong>Berlin</strong>er Hochschulen und der Technischen Universität <strong>Berlin</strong>.<br />
Mit dem Preis der <strong>Baukammer</strong> soll die Vielseitigkeit des Bauingenieurwesens anhand von herausragenden und<br />
sich durch besondere Kreativität auszeichnenden Abschlussarbeiten gezeigt werden.<br />
Die Abschlussarbeiten aus dem Jahr <strong>2012</strong> müssen bis zum 31.01.2013 eingereicht werden.<br />
Nähere Informationen:<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> · Gutsmuthsstr. 24 · 12163 <strong>Berlin</strong> · Tel.: (030) 79 74 43-0 · www.baukammerberlin.de<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 25
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 26<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
2. Preis in der Gruppe der Masterarbeiten und Diplom-Arbeiten (TUB) für seine Master-Arbeit:<br />
Zusammenfassung<br />
Verschiedene technische Entwicklungen<br />
der jüngsten Vergangenheit begünstigen<br />
die Entwicklung von Anwendungen auf<br />
dem Gebiet der Augmented Reality. Hierbei<br />
kommt der Entwicklung von Handheld<br />
Displays und den im Rahmen von<br />
INSPIRE1 im Aufbau befindlichen Geodateninfrastrukturen<br />
eine besonde- re<br />
Bedeutung zu. Gegenstand einer Masterarbeit<br />
im Studiengang Geodatenerfassung<br />
und -visualisierung [Kreuziger<br />
2011] war es, ein Augmented Reality-<br />
System Prototypen zu entwickeln, mit<br />
dem sich Geodaten direkt vor Ort auf<br />
einem Tablet-PC gemeinsam mit einem<br />
Live-Video-Bild in einer 3D-Egoperspek-<br />
26 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Einsatzmöglichkeiten der „Augmented Reality“<br />
für geodätische Zwecke<br />
Prototypentwicklung eines AR-Systems<br />
zur Visualisierung von Geodaten<br />
Verfasser: Ulf Kreuziger M.Sc. (Kurzfassung)<br />
1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Klaus Hehl · 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Werner Stempfhuber<br />
tive des Anwenders visualisieren lassen<br />
(vlg. Abbildung 1).<br />
2 Einleitung, Motivation und Ziel<br />
Heutige Tablet-PCs verfügen regelmäßig<br />
über eine nach vorne gerichtete Kamera<br />
und ein berührungsempfindliches Display,<br />
auf dem das Bild der Frontkamera<br />
als Live-Video-Bild dargestellt werden<br />
kann.<br />
Wenn es nun gelänge, beliebige georeferenzierte<br />
Daten mit dem Live-Video-Bild<br />
gemeinsam darzustellen, könnte man die<br />
Realität, in Form des Video-Bildes, entsprechend<br />
um beliebige virtuelle Objekte<br />
erweitern. Daraus würden sich für verschiedenste<br />
Branchen unterschiedliche<br />
Abbildung 1: Augmented Reality Applikation mit Datensicht in 3D-Egoperspektive<br />
Anwendungen ergeben, die sich alle auf<br />
dasselbe Grundprinzip zurückführen lassen.<br />
Beispielsweise könnten Vermesser<br />
Grenzsteine und Grundstücksgrenzen<br />
darstellen oder Architekten neu entworfene<br />
Bauwerke direkt vor Ort in das Echtzeitbild<br />
einblenden. Neben den selbst<br />
produzierten Daten stehen darüber hinaus<br />
über die im Rahmen von INSPIRE<br />
entstehenden Geodateninfrastrukturen<br />
eine Vielzahl von Geodaten (Bauplanungsgrenzen,<br />
Windeignungsgebiete,<br />
Naturschutzgebiete, Biotope, etc.) mit<br />
einheitlichen Normungen öffentlich und<br />
teilweise kostenlos über das Internet zur<br />
Verfügung. Damit könnten Benutzer bei<br />
Gebietserkundungen vorhandene geore-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 27<br />
ferenzierte Daten in die Anwendung<br />
laden und anzeigen.<br />
„Eine Motivation zur Entwicklung eines<br />
Augmented Reality-Systems war es, die<br />
derzeitigen Bearbeitungsmethoden der<br />
Bodenordnung durch Schaffung eines<br />
neuen Außendienstwerkzeuges für die<br />
Erkundung und Planungsüberprüfung<br />
weiter zu entwickeln.<br />
In der aktuellen Bearbeitungsweise von<br />
Bodenordnungsverfahren werden zu<br />
Beginn und im Verlauf eines Verfahrens<br />
örtliche Gebietserkundungen lediglich<br />
unter Zuhilfenahme von Karten und Plänen<br />
durchgeführt, um sich einen Eindruck<br />
der Gegebenheiten vor Ort zu verschaffen.<br />
Hierbei steht der jeweilige,<br />
regelmäßig nicht ortskundige Bearbeiter<br />
vor der Schwierigkeit, sich präzise und<br />
zielgerichtet im Gelände zu orientieren,<br />
um dann die in den Karten eingezeichneten<br />
Objekte (Freileitungen, Biotope, etc.)<br />
den in der Natur vorgefundenen Gegenständen<br />
zuzuordnen. Darüber hinaus<br />
lassen sich andere Objekte nicht direkt in<br />
der Natur erkennen, z.B. unterirdische<br />
Leitungen oder Grenzen von Windeignungsgebieten.<br />
Im Ergebnis einer Bodenordnung entsteht<br />
unter anderem auch eine gänzlich<br />
neue Flurstücksstruktur des Gebietes.<br />
Hierzu werden die neuen Flurstücke den<br />
Bodeneigentümern vor Ort angezeigt.<br />
Dies erfolgt durch Absteckung und<br />
Signalisierung der Grenzpunkte mit den<br />
bekannten Methoden der Vermessung<br />
(GNSS/terrestrische Vermessung). Mittels<br />
geeigneter Kartenausschnitte können<br />
die in der Karte dargestellten Grenzpunkte<br />
den örtlich abgesteckten Grenzpunkten<br />
zugeordnet und den Bodeneigentümern<br />
die Grenzverläufe vor Ort<br />
erklärt werden. Jedoch fällt dabei das<br />
Auffinden der markierten Grenzpunkte<br />
nicht immer leicht und auch die Grenzverläufe<br />
sind teilweise schwer nachvollziehbar,<br />
da eine direkte Sicht zwischen<br />
den einzelnen Grenzpunkten in der Natur<br />
aufgrund weiter Strecken oder bewegter<br />
Topographie nicht immer möglich ist.<br />
Für beide der vorgenannten Anwendungsfälle<br />
kann ein Instrument, dass die<br />
Realität mit virtuellen Elementen anzureichern<br />
vermag, die praktische Arbeit sehr<br />
unterstützen. Ein entsprechendes System<br />
müsste sich durch ein geringes<br />
Gewicht, transportable, ausdauernde<br />
und witterungsunabhängige Technik<br />
auszeichnen, um über mehrere Stunden<br />
und bei jedem Wetter im Gelände eingesetzt<br />
werden zu können. Zudem sollte es<br />
mehrbenutzerfähig sein, um anhand der<br />
visualisierten Ergebnisse konstruktive<br />
Diskussionen direkt vor Ort führen zu<br />
können.“ [Kreuziger u. Hehl <strong>2012</strong>]<br />
Der vorliegende Artikel geht zunächst auf<br />
die Definition und die allgemeinen<br />
Bestandteile eines Augmented Reality-<br />
Systems ein und beschreibt danach,<br />
welche konkreten Bestandteile das entwickelte<br />
Prototyp-System hat. Später<br />
wird benannt, was das System bereits<br />
jetzt leisten kann und an welchen Stellen<br />
die Weiterentwicklung ansetzt.<br />
3 Augmented Reality<br />
und AR-Systeme<br />
Die Augmented Reality (AR, dt. Erweiterte<br />
Realität) ist eine Form der Mensch-<br />
Technik-Interaktion. Hierbei werden dem<br />
Anwender verschiedenartige Informationen<br />
in sein Sichtfeld eingeblendet, z.B.<br />
über Handheld Displays oder über<br />
Datenbrillen. Die Einblendung der Information<br />
erfolgt hierbei kontextabhängig<br />
[Bill u. Zehner 2001]. Ebenfalls kann<br />
durch die Anreicherung der unmittelbaren<br />
Realität mit zusätzlichen Informationen,<br />
die die natürlichen Sinnesorgane<br />
des Menschen ergänzen, von Erweiterung<br />
der Realität gesprochen werden. AR<br />
ist folglich nicht allein auf visuelle Interaktion<br />
bezogen, sondern kann auch die<br />
Sinne Hören, Riechen, Schmecken,<br />
Tasten einbeziehen. [Azuma u. a. 2001]<br />
Aus technischer Sicht müssen AR-<br />
Systeme folgende Eigenschaften besitzen:<br />
• sie kombinieren reale und virtuelle<br />
Objekte in einer realen Umwelt,<br />
• sie laufen interaktiv und in Echtzeit<br />
und<br />
• sie stellen reale und virtuelle Objekte<br />
in Bezug zueinander (3D-Registrierung)<br />
[Azuma 1997, Azuma u. a. 2001].<br />
UmAR in einen globalen Kontext einzuordnen,<br />
kann man sich dem Modell des<br />
Realitäts-Virtualitäts-Kontinuums (engl.<br />
Reality-Virtuality-Continuum) bedienen.<br />
Darin wird der Bereich zwischen realer<br />
Welt und virtueller Welt als Gemischte<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Realität (engl. Mixed Reality) bezeichnet<br />
[Milgram u. Kishino 1994]. Wie der Abbildung<br />
2 entnommen werden kann, ist die<br />
Erweiterte Realität in diesem Bereich,<br />
jedoch näher in Richtung „Realität“ und<br />
weiter entfernt der „Virtualität“ einzuordnen.<br />
Erste technische Entwicklungen im Kontext<br />
der Erweiterten Realität fanden<br />
bereits in den 60er Jahren statt. 1968<br />
entwickelte der Amerikaner Ivan Sutherland<br />
das wohl erste Head-Mounted-Display<br />
[Bimber u. Raskar 2005]. Vor allem<br />
die fortgeschrittene Hardwareentwicklung<br />
tragbarer Computer (Handhelds) in<br />
jüngster Zeit haben der AR einen neuen<br />
Aufwind gegeben. Von einem großen<br />
Anbieter von Marktforschungsergebnissen<br />
(Gartner, Inc.) wird nunmehr<br />
geschätzt, dass AR in den kommenden 5<br />
bis 10 Jahren vollständig in der Gesellschaft<br />
bzw. im Alltag etabliert sein wird.<br />
Aktuell ist bereits jetzt zu beobachten,<br />
dass auf dem Mobil- und Smartphonemarkt<br />
im Rahmen der ortsbezogenen<br />
Anwendungen (engl. location-aware<br />
Apps) große Aktivitäten stattfinden [Fenn<br />
2010].<br />
4 Allgemeine Bestandteile<br />
eines AR-Systems<br />
Um die oben aufgeführten Eigenschaften<br />
von AR-Systemen zu erfüllen, sind verschiedene<br />
Bestandteile erforderlich, die<br />
sich in drei wesentliche Bereiche einteilen<br />
lassen [Tönnis 2010]:<br />
• Tracking,<br />
• Darstellung und<br />
• Interaktion.<br />
Hierbei bezeichnet man den Prozess der<br />
Lagebestimmung des Betrachters oder<br />
von Objekten als Tracking [Tönnis 2010]<br />
und die Zweiwege-Kommunikation zwischen<br />
Computer und Benutzer als Interaktion<br />
[Bill u. Zehner 2001]. Die Darstellung<br />
wiederum ist an das anzusprechende<br />
Sinnesorgan gebunden und kann z.B.<br />
akustisch, visuell oder haptisch erfolgen.<br />
Als Apparat zur Bündelung der Bestandteile<br />
dient im Allgemeinen ein Rechner,<br />
Abbildung 2: Reality-Virtuality Continuum [Milgram u. Kishino 1994]<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 27
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 28<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Abbildung 3: Low Cost Kompassmodul mit Beschleunigungs- und Magnetfeldsensor<br />
der auch über eine Rendering 2 -Funktionalität<br />
verfügt.<br />
5 Entwicklung des Prototypen<br />
Die primäre Zielstellung der Masterarbeit<br />
war es, mit auf dem Markt erhältlichen<br />
Komponenten ein einsatzfähiges AR-<br />
System aufzubauen und fehlende Softwarekomponenten<br />
selbst zu entwickeln<br />
Durch das Labor für „Geodätische Mess-<br />
technik“ des Fachbereichs wurde der<br />
Outdoor-Tablet-PCs Trimble Yuma (vgl.<br />
Abbildung 1) beschafft und für die Entwicklung<br />
zur Verfügung gestellt. Er vereint<br />
in sich wichtige Hardwarebestandteile,<br />
wie<br />
• einen CMOS-Kamerasensor,<br />
• einen GPS-Sensor und<br />
• ein berührungsempflindliches Display.<br />
Abbildung 4: Augmented Reality mittels video see-through Prinzip<br />
Abbildung 5:<br />
Hauptoberfläche der AR-Anwendung (unten), Oberfläche „Daten/Verbinden“<br />
(oben rechts), Oberfläche „Tools/Einstellungen“ (oben links)<br />
28 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Da der Trimble Yuma nicht über interne<br />
Richtungssensoren verfügt, werden zur<br />
Bestimmung der Orientierungswinkel<br />
externe Sensoren notwendig.<br />
Für das vorliegende System wurde ein<br />
Low Cost Kompass-Modul mit<br />
• einem dreiachsigen Beschleunigungsund<br />
• einem dreiachsigen Magnetfeldsensor<br />
verwendet. Hierbei wurde es erforderlich,<br />
die Platine in einem geeigneten<br />
Gehäuse zu verbauen (vgl. Abbildung 3)<br />
und am Tablet-PC zu befestigen. Bedingt<br />
durch die verwendeten Sensoren beruht<br />
das entwickelte AR-System auf den Prinzipien<br />
Laufzeitmessung, Inertialsensorik<br />
und Direkter Feldabtastung. Es stellt<br />
somit ein Hybrid-Tracking-System dar.<br />
Hierbei wird die Möglichkeit der visuellen<br />
Darstellung mit einem Handheld Display<br />
genutzt, wobei die Überlagerung der virtuellen<br />
Objekte mit einem Live-Video-<br />
Bild nach dem video see-through Prinzip<br />
erfolgt (vgl. Abbildung 4).<br />
Insgesamt wurde bei der Aufstellung der<br />
Systemarchitektur darauf geachtet, den<br />
Softwarebestandteil des Systems unabhängig<br />
von der Hardware (Sensorik,<br />
Tablet-PC) zu entwickeln, um die Applikation<br />
auf verschiedenen Plattformen<br />
einsetzen und von zukünftigen technischen<br />
Hardwareweiterentwicklungen<br />
profitieren zu können.<br />
Gemeinsam mit den vorgenannten (austauschbaren)<br />
Hardware-Komponenten<br />
bilden die nachstehenden<br />
Softwarekomponenten das derzeitige<br />
AR-System:<br />
• eine Anwendungsoberfläche (Eigenprogrammierung)<br />
• ein OCX-Steuerelement3 / X3D-Viewer<br />
(BS Contact, Bitmanagement<br />
GmbH) sowie<br />
• Programm-Klassen für die Sensorda-<br />
1 Infrastructure for Spatial Information in<br />
Europe; Akronym für die Richtlinie<br />
2007/2/EG des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur<br />
Gemeinschaft<br />
in der Europäischen<br />
2 Bezeichnung für die Umsetzung einer real<br />
dreidimensionalen Szenerie in eine zweidimensionale<br />
Darstellung durch Projektion<br />
der 3-D-Objektdarstellung in die 2-D-Bildschirmdarstellung.[Bill<br />
u. Zehner 2001,<br />
S.225]<br />
3 engl. OCX-Control, Objekt Linking and<br />
Embedding custom control<br />
4 www.vlf-brandenburg.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 29<br />
tenverarbeitung (Eigenprogrammierung)<br />
und<br />
• Programm-Klassen für die Geodatenverarbeitung<br />
(Eigenprogrammierung).<br />
Die Anwendungsoberfläche wurde programmiert,<br />
um Soft- und Hardware<br />
zusammenzuführen, das System zu<br />
bedienen und um Einstellungen am<br />
System vorzunehmen (vgl. Abbildung 5).<br />
Die Entwicklung der Oberfläche erfolgte<br />
hierbei mit der Software Microsoft Visual<br />
Studio 2010 im .NET Framework.<br />
6 Auszug aus den Feld- und<br />
Laborversuchen<br />
Um erste Erfahrungen mit der Erweiterten<br />
Realität sowie der Sensorik zu sammeln<br />
und die Auswirkungen der getätigten<br />
Programmierungen bewerten zu können,<br />
standen<br />
• zwei Bodenordnungsgebiete im ländlichen<br />
Raum mit umfangreichen Grafikdaten,<br />
• verschiedenen Lagefestpunkte,<br />
• ein dreidimensionales Testfeld für<br />
photogrammetrische Zwecke,<br />
• ein nichtmagnetischer Messpfeiler<br />
und<br />
• ein Innenlabor<br />
zur Verfügung.<br />
Im Labor und auf dem Messpfeiler wurden<br />
u.a. Versuche mit Magnetfeldsensor<br />
des Kompassmoduls durchgeführt. Der<br />
verwendete Tablet-PC Trimble Yuma verfügt<br />
über einen Erweiterungsschacht, in<br />
dem das Kompassmodul mit den Abmaßen<br />
2.5 x 2.5 x 0.8 cm eingebaut werden<br />
Abbildung 6: Versuche mit dem Magnetfeldsensor<br />
könnte. Im Rahmen<br />
einer Versuchsreihe<br />
wurde jedoch festgestellt,<br />
dass der<br />
Magnetfeldsensor<br />
des Kompassmoduls<br />
fehlerhafte<br />
Messwerte ausgibt<br />
und an Trägheit<br />
zunimmt, je näher<br />
es sich am Tablet-<br />
PC befindet. Als<br />
Hauptursachen<br />
werden die magnetischeStifthalterung<br />
und die beiden<br />
großen Akkumulatoren<br />
vermutet.<br />
Diesbezüglich wurden<br />
Versuche<br />
unternommen, bis<br />
auf welche Entfernung<br />
das Kompassmodul<br />
an den<br />
Tablet-PC herangeführt<br />
werden kann.<br />
Hierzu wurde auch<br />
die mögliche Verwendung<br />
einer magnetischen Abschirmfolie<br />
getestet (vgl. Abbildung 6). Aus verschiedenen<br />
Magnetfeldversuchen wurde<br />
abgeleitet, dass sich die Effekte mittels<br />
Kalibrierung minimieren lassen und der<br />
Magnetfeldsensor ohne Abschirmung in<br />
einem Minimalabstand von ca. 30 cm<br />
vom Tablet-PC verwendet werden kann.<br />
Die Ergebnisse aller Labor- und Feldversuche<br />
bezüglich der verwendeten Sensorik<br />
und zum AR-System allgemein<br />
sowie Aussagen zu den erreichbaren<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Abbildung 7: AR-System Prototyp<br />
Genauigkeiten des Systems werden in<br />
der Masterarbeit ausführlich beschrieben.<br />
7 Stand und zukünftige<br />
Weiterentwicklung<br />
Im Rahmen der Masterarbeit ist ein einsatzfähiges<br />
Prototyp-AR-System (vgl.<br />
Abbildung 7) entstanden, dessen Funktionstüchtigkeit<br />
gegeben ist, das als ausführbare<br />
Windows-Anwendungsdatei<br />
(*.exe) zur Verfügung steht und auf beliebigen<br />
Tablet-PCs einsetzbar ist. Mit dem<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 29
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 30<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
derzeitigen Entwicklungsstand des<br />
Systems ist es dem Anwender möglich,<br />
Geodaten im X3D-Format von einem<br />
lokalen Datenträger oder aus dem Internet<br />
zu laden und anzuzeigen. Ebenfalls<br />
ist eine Datenkonvertierung digitaler Vektordaten<br />
anderer Formate in das X3D-<br />
Format mit den programmierten Werkzeugen<br />
des Systems möglich.<br />
Es gilt nun das System in der Praxis zu<br />
erproben und schrittweise weiterzuentwickeln.<br />
Zukünftig sollen Online-Datenabfragen<br />
an die Geodateninfrastrukturen<br />
(z.B. GDI-BE/BB) unter Nutzung der<br />
bereitgestellten Services (z.B.Web Feature<br />
Services) mit automatischer Konvertierung<br />
und Anzeige der Daten direkt vor<br />
Ort ermöglicht werden. Ebenfalls soll das<br />
System mit anderen Sensoren getestet<br />
„Von der Komposition zum Detail sorgfältig<br />
und mit dem Anspruch einer ganzheitlichen<br />
Qualität gestaltet, werden Ingenieurbauten<br />
vielmehr zu Ingenieurbaukunst.“<br />
Stephan Engelsmann, Stuttgart<br />
Es wird sehr gerne übersehen, dass sich<br />
die Baukunst in einer Reihe von Punkten<br />
erheblich von anderen Künsten unterscheidet.<br />
Bauwerke haben stets eine<br />
Funktion und in der Regel einen anderen<br />
Maßstab als Kunstwerke. Es ist der Maßstab,<br />
der ein Nachdenken über Statik,<br />
Tragverhalten und Fertigung unabdingbar<br />
macht: ein sehr einfacher Zusammenhang,<br />
der die Baukunst untrennbar<br />
mit den Ingenieurwissenschaften verknüpft.<br />
30 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
und ggf. erweitert werden, z.B. präzise<br />
Low Budget GNSS-Empfänger und kreiselgestützte<br />
Orientierungsaufnehmer.<br />
Darüber hinaus bildet die Einbeziehung<br />
von Geländemodellen zur dreidimensionalen<br />
Datenaufbereitung und Höhenbestimmung<br />
einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt.<br />
Als Partner für die Erprobung und Weiterentwicklung<br />
des AR-Systems konnte der<br />
Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung<br />
Brandenburg 4 gewonnen<br />
werden.<br />
Literatur<br />
[Azuma u. a. 2001]<br />
AZUMA, Ronald ; BAILLOT, Yohan ; BEHRIN-<br />
GER, Reinhold ; FEINER, Steven ; JULIER,<br />
Simon ; MACINTYRE, Blair: Recent Advances<br />
Baukultur ist … Ingenieurbaukunst<br />
Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann<br />
© Staatl. Akademie der<br />
Bildenden Künste Stuttgart<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Udo Kraft,<br />
Ulf Kreuziger,<br />
Dr.-Ing.<br />
Jens Karstedt<br />
Die Schöpfer von<br />
Baukunst sind<br />
Architekten und<br />
Bauingenieure<br />
gleichermaßen.<br />
Die Beiträge der<br />
beiden Disziplinen<br />
sind von der<br />
Bauaufgabe<br />
abhängig. Unter<br />
Ingenieurbauten<br />
verstehen wir die<br />
Bauwerke, die in<br />
der Regel von Bauingenieuren entwikkelt,<br />
entworfen, konstruiert und bemessen<br />
werden. Unter Ingenieurbaukultur<br />
subsummieren wir sehr vielfältige Bauaufgaben,<br />
beispielsweise Infrastruktur<br />
und Verkehrswege. Straßen, Schienenwege<br />
und Wasserwege verbinden Men-<br />
in Augmented Reality. In: IEEE ComputerGraphics<br />
21 No. 6 (2001), S. 34–47<br />
[Azuma 1997]<br />
AZUMA, Ronald T.: A Survey of Augmented<br />
Reality. In: Presence 6 No. 4 (1997), S. 355–<br />
385<br />
[Bill u. Zehner 2001]<br />
BILL, Ralf ; ZEHNER, Marco L.: Lexikon der<br />
Geoinformatik. Heidelberg : Herbert Wichmann,<br />
2001<br />
[Bimber u. Raskar 2005]<br />
BIMBER, Oliver ; RASKAR, Ramesh: Spatial<br />
Augmented Reality: Merging Real and Virtual<br />
Worlds. Wellesley : A K Peters, Ltd., 2005<br />
[Fenn 2010]<br />
FENN, Jackie: Hype Cycle for Emerging Technologies,<br />
2010. Stamfort, USA : Gartner Corporate<br />
Marketing, 2010<br />
[Kreuziger 2011]<br />
KREUZIGER, Ulf: Einsatzmöglichkeiten der<br />
Augmented Reality für geodätische Zwecke.<br />
<strong>Berlin</strong>, Technische Fachhochschule <strong>Berlin</strong> -<br />
University of Applied Sciences, Masterarbeit,<br />
2011<br />
[Kreuziger u. Hehl <strong>2012</strong>]<br />
KREUZIGER, Ulf ; HEHL, Klaus: Entwicklung<br />
einer AR-Applikation für die Planung und<br />
Bodenordnung. In: zfv - Zeitschrift für Geodäsie,<br />
Geoinformation und Landmanagement<br />
(<strong>2012</strong>). – (im Druck)<br />
[Milgram u. Kishino 1994]<br />
MILGRAM, Paul ; KISHINO, Fumio: A Taxonomy<br />
of Mixeld Reality Visual Displays. In: SPIE<br />
2351 (1994), S. 282–292<br />
[Tönnis 2010]<br />
TÖNNIS, Markus: Augmented Reality: Einblikke<br />
in die Erweiterte Realität (Informatik im<br />
Fokus). Heidelberg : Springer, 2010<br />
schen und Kulturen. Eine funktionierende<br />
Infrastruktur ist die Voraussetzung für<br />
Mobilität und somit eine zentrale Grundlage<br />
einer globalisierten Gesellschaft.<br />
Teil der Verkehrswege sind die Infrastrukturbauwerke:<br />
insbesondere Brücken und<br />
Tunnel. Infrastrukturbauwerke sind aber<br />
auch die Knotenpunkte der Verkehrswege<br />
wie Bahnhöfe, Häfen und Flughäfen.<br />
Es gilt einerseits, Hindernisse zu überwinden.<br />
Aber es gilt genauso, Verkehrsbauwerke<br />
in einen urbanen oder landschaftsarchitektonischen<br />
Kontext zu<br />
integrieren, dies in vielen Fällen in interdisziplinärer<br />
Arbeitsgemeinschaft mit<br />
Stadtplanern oder Landschaftsarchitekten.<br />
Ingenieurbaukultur ist auch die Energie-<br />
Architektur. Darunter verstehen wir alle
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 31<br />
Bauwerke, die der Erzeugung beziehungsweise<br />
dem Transport von Energie<br />
dienen, beispielsweise Wasserkraftwerke,<br />
Windkraftanlagen und Solarkraftwerke,<br />
Hochspannungsmasten, aber auch<br />
Talsperren und Offshore-Plattformen.<br />
Neben der Versorgung mit Energie und<br />
Strom ist auch die Versorgung des Menschen<br />
mit Wasser ein bedeutsamer Teil<br />
der Ingenieurbaukultur. Nicht immer sind<br />
diese Bauwerke so eindrucksvoll wie beispielsweise<br />
die römischen Aquädukte. In<br />
vielen Fällen sind sie unspektakulär, aber<br />
notwendig. Brunnen, Wassertürme,<br />
Wasserspeicher und selbstverständlich<br />
auch ein zuverlässig funktionierendes<br />
Rohrleitungsnetz gewährleisten die Wasserversorgung<br />
und an vielen Orten auch<br />
die Nahrungsmittelproduktion. Abwassersysteme<br />
und Kläranlagen sind nicht<br />
nur grundlegende Voraussetzungen des<br />
Umweltschutzes, sondern auch der<br />
menschlichen Hygiene und Gesundheit<br />
und übrigens eine der Ursachen für<br />
unsere seit dem späten 19. Jahrhundert<br />
zunehmende Lebenserwartung.<br />
Eine elementare Aufgabe der Baukultur<br />
ist auch der Schutz des Menschen vor<br />
der Natur, ein keinesfalls abgeschlossenes<br />
Kapitel der Menschheitsgeschichte:<br />
Bauingenieure können Erdbeben und<br />
Flutkatastrophen nicht verhindern, aber<br />
erdbebensicheres Bauen und Schutzbauwerke<br />
können sehr wohl deren<br />
furchtbare Folgen lindern. Ingenieurbaukunst<br />
umfasst aber auch eine Reihe von<br />
sehr vergnüglichen Konstruktionen: denken<br />
Sie an die Riesenräder und Achterbahnen<br />
der Volksfeste und Vergnügungsparks.<br />
Phantastische, tollkühne<br />
Ingenieurstrukturen!<br />
Nicht zuletzt leisten Ingenieure einen<br />
unverzichtbaren Beitrag in der Planung<br />
von Gebäuden, in diesem Fall an der Sei-<br />
Stephan Engelsmann<br />
Prof. Dr.-Ing. Bauingenieur<br />
geb. 1964 in Augsburg. Bauingenieurstudium,<br />
TU München. Wissenschaftl.<br />
Assistent bei Jörg Schlaich<br />
und Kurt Schäfer, Universität Stuttgart.<br />
Dissertation über integrale<br />
Betonbrücken. Architekturstudium,<br />
University of Bath. 1999 bis 2007<br />
Werner Sobek Ingenieure. Seit 2002<br />
Professor für Konstruktives Entwerfen<br />
und Tragwerkslehre, Staatl. Akademie<br />
der Bildenden Künste Stuttgart. 2007<br />
Engelsmann Peters Beratende Ingenieure.<br />
1 Energie-Architektur: nachhaltig und<br />
ästhetisch. Windenergieanlage Nordex<br />
N90 © Nordex SE<br />
2 Aquädukt von Segovia, ein Beispiel für<br />
die hoch entwickelte Ingenieurbaukunst<br />
in römischer Zeit © Jörg Radestock<br />
te von Architekten. Es gibt heute kein<br />
anspruchsvolles Gebäude, das ohne<br />
Tragwerksplaner, Ingenieure für Energieeffizienz<br />
oder Ingenieure für Gebäudetechnologie<br />
errichtet wird. In vielen Fällen<br />
sind es die Beiträge der Ingenieure –<br />
vom strukturoptimierten und filigranen<br />
Tragwerk über die hochleistungsfähige<br />
Fassade bis zum innovativen und nachhaltigen<br />
Energiekonzept –, die ein Bauwerk<br />
aus der grauen Gebäudemasse<br />
hervorheben und einzigartig machen.<br />
Es kann zusammenfassend ohne Übertreibung<br />
festgestellt werden, dass ohne<br />
génie civil keine moderne Gesellschaft<br />
funktioniert! Bei der Erfüllung dieser vielfältigen<br />
Aufgaben dienen Ingenieure im<br />
aristokratischen Sinne des Wortes: sie<br />
stellen ihr Wissen und ihre Intelligenz der<br />
Gesellschaft zur Verfügung und leisten<br />
so einen überragenden Beitrag zur<br />
menschlichen Kultur. Voraussetzung ist<br />
ein hohes Maß an Verantwortung, denn<br />
die meisten Menschen nehmen funktionsfähige<br />
ingenieurtechnische Systeme<br />
für selbstverständlich.<br />
Ingenieurbauten sind aber nicht nur funktional,<br />
sondern auch gestalterisch hochanspruchsvolle<br />
Bauwerke, landschaftsprägend<br />
und raumbildend, und aus diesem<br />
Grund wie Gebäude Teil der gebauten<br />
Umwelt. Ingenieurbauwerke geringschätzig<br />
als Zweckbauten zu bezeichnen,<br />
wird ihrer funktionalen und<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
ästhetischen Bedeutung in einer modernen,<br />
globalisierten Gesellschaft nicht<br />
gerecht. Von der Komposition bis zum<br />
Detail sorgfältig und mit dem Anspruch<br />
einer ganzheitlichen Qualität gestaltet,<br />
werden Ingenieurbauten vielmehr zu<br />
Ingenieurbaukunst. Robert Maillarts Salginatobelbrücke<br />
ist genauso ästhetisch<br />
wie Le Corbusiers Notre-Dame-du-Haut<br />
de Ronchamp und die Talsperre von Verzasca<br />
ist nicht weniger erhaben als die<br />
Pyramiden von Gizeh. Der Ingenieurbau<br />
ist eine Kunstform, die parallel zu und<br />
trotzdem unabhängig von der Architektur<br />
und anderen Künsten besteht!<br />
Ingenieure sind die genialen und kreativen<br />
Erfinder und Schöpfer dieser Kunstform,<br />
die nicht nur, aber auch von technischen<br />
Entwicklungen und Innovation<br />
abhängig ist. Sie gestalten die Zukunft,<br />
aber sie begreifen sich nicht als Egozen-<br />
3 Meisterwerk der Ingenieurbaukunst:<br />
Robert Maillarts Salginatobelbrücke bei<br />
Schiers. © Karl Telleen<br />
4 Erhaben und funktional:<br />
Überlauf der<br />
Talsperre von Verzasca.<br />
Foto:<br />
mit freundlicher<br />
Genehmigung S.<br />
Engelsmann<br />
triker, deren einziges Anliegen es ist, sich<br />
selbst zu verwirklichen: einer der Gründe,<br />
warum Ingenieurleistungen in vielen<br />
Fällen und ungerechtfertigt namenlos<br />
bleiben. Es ist zu wünschen, dass die<br />
Menschen eines Tages den Beitrag der<br />
Ingenieure zur Baukunst besser verstehen<br />
und begreifen, dass sich Baukultur<br />
nicht in Schönheit erschöpft. Es ist viel<br />
anspruchsvoller, die Schönheit mit der<br />
Funktion zu verbinden und die Welt der<br />
Technik mit der Welt des Geistes zu vereinen!<br />
www.bundesstiftung-baukultur.de<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 31
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 32<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Bachelor-/Master-Ausbildung muss akademisch bleiben!<br />
Nicht-Akademischer «Bachelor<br />
Professional» wird abgelehnt<br />
Die IfKom – Ingenieure für Kommunikation<br />
– stehen den akademischen Bildungsgraden,<br />
die nach den Beschlüssen<br />
von Bologna eingeführt wurden, aufgeschlossen<br />
gegenüber. Bachelor und<br />
Master stehen auch in dem Bereich der<br />
Ingenieurwissenschaften neben dem<br />
hoch anerkannten Diplom-Ingenieur für<br />
eine national wie international anerkannte<br />
akademische Hochschulausbildung.<br />
Bachelor und Master der Ingenieurwissenschaften<br />
sind mit ihrer Hochschulausbildung<br />
nach Auffassung der IfKom<br />
den Ingenieuren gleich zu stellen. Dieser<br />
Europa bedroht die<br />
Ingenieurpromotion<br />
In Europa findet derzeit eine Diskussion<br />
zu Promotionsformaten statt. Demnach<br />
wird eine Zweiteilung der Promotionsformate<br />
(third cycle) in einen PhD<br />
und ein Engineering Doctorate vorgeschlagen.<br />
Während der PhD als Einstieg<br />
in die wissenschaftliche Karriere<br />
gesehen wird, soll das Engineering<br />
Doctorate als industriegetrieben betrachtet<br />
werden.<br />
Der Fakultätentag der Ingenieurwissenschaften<br />
und der Informatik an Universitäten<br />
e.V. (4ING) befürchtet nun<br />
eine überbordende Bürokratie, die zu<br />
einer Verringerung der Qualität von<br />
Wissenschaft und zu einer Absenkung<br />
der Qualifikation von promovierten<br />
Ingenieuren führen wird.<br />
Es sei Tatsache, so 4ING in einer Pressemeldung,<br />
dass das deutsche Format<br />
der Ingenieurpromotion, sowohl<br />
zur Ausbildung des Führungsnachwuchses<br />
der Wirtschaft als auch als<br />
Vorbereitung für eine wissenschaftliche<br />
Karriere, hervorragend funktioniere.<br />
Die deutschen Ingenieure und Technischen<br />
Universitäten könnten mit<br />
einem Verweis auf die wirtschaftliche<br />
Kraft Deutschlands stolz auf das eigene<br />
System referenzieren und benötigten<br />
die von Europa vorgetragenen verschulten,<br />
bürokratisch überwachten<br />
und ausdifferenzierten Systeme nicht.<br />
32 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Quelle:<br />
zbi nachrichten 1-12<br />
Sachverhalt muss in allen einschlägigen<br />
Gesetzen auch so geregelt werden.<br />
Demgegenüber lehnen die IfKom die Vermischung<br />
akademischer Grade mit langjährig<br />
bewährten handwerklichen Ausbildungsqualifikationen<br />
ab. So wäre etwa<br />
die Bezeichnung «Bachelor professional»<br />
für Meister oder Fachwirte irreführend.<br />
Die bisher gegebene Transparenz<br />
zwischen handwerklicher und akademischer<br />
Bildung mit ihren jeweiligen Ausprägungen<br />
ginge praktisch verloren. Dies<br />
kann jedoch nicht Sinn von Neuregelungen<br />
auf nationaler und europäischer<br />
Ebene sein.<br />
Ebenso wie die IfKom hatte sich auch der<br />
Verband Deutscher Vermessungsingenieure<br />
(VDV) gegen die Einführung eines<br />
«Bachelor Professional» bzw. «Master<br />
Professional» als einen neuen Abschluss<br />
in der beruflichen Weiterbildung ausgesprochen.<br />
Die Bezeichnung eines Ausbildungsabschlusses,<br />
mit der Wortkombination<br />
Bachelor oder Master, der ohne<br />
akademische Aus- oder Fortbildung<br />
erworben werden kann, wird strikt abgelehnt.<br />
„Ein solcher Titel wertet die Berufsbildung<br />
nicht auf, sondern sorgt dafür,<br />
dass der Bachelor-Grad nichts mehr<br />
aussagt. Ist es bereits jetzt mit Schwierigkeiten<br />
verbunden, die an den deutschen<br />
Hochschulen angebotenen<br />
Bachelor-Abschlüsse objektiv zu verglei-<br />
Dass die HOAI-Reform 2013 mehr und<br />
mehr in die entscheidende Phase geht,<br />
demonstrierten die engagierten Diskussionsbeiträge<br />
und die einhellige Auffassung<br />
der mehr als 70 Vertreter aus den 43<br />
Mitgliedsorganisationen des AHO, die<br />
erneut die schnellstmögliche Umsetzung<br />
der HOAI-Novellierung bis 2013 und<br />
zudem eine umgehende Grundsatzentscheidung<br />
über die Rückführung der<br />
Planungsleistungen Umweltverträglichkeitsstudie,<br />
Thermische Bauphysik,<br />
Schallschutz und Raumakustik, Bodenmechanik,<br />
Erd- und Grundbau, Vermessungstechnische<br />
Leistungen (Teile VI, X-<br />
III HOAI 1996) in das verbindliche Preisrecht<br />
der HOAI gefordert haben. Durchweg<br />
positiv wurde die nach einigen Ver-<br />
AHO-Mitgliederversammlung:<br />
chen, würde ein zusätzlicher Handwerk-<br />
Bachelor die Verwirrung noch verstärken“,<br />
sagte VDV-Präsident Wilfried Grunau.<br />
„Hochwertige Qualifikationen in der Bildung<br />
und Ausbildung sind entscheidend<br />
für die Zukunftsfähigkeit des Standortes<br />
Deutschland. Dafür brauchen wir eine<br />
Vielfalt unterschiedlicher Angebote mit<br />
klar differenzierten Profilen. Wir sprechen<br />
uns aber ganz entschieden gegen den<br />
Wunsch der Wirtschaftsminister aus, die<br />
Abschlüsse »Bachelor/Master Professional»<br />
für Meister und Techniker einzuführen.<br />
Der Titel verwirrt und führt zu mangelnder<br />
Akzeptanz des Bachelor-Grades insgesamt“,<br />
so Grunau. „Das deutsche Handwerk<br />
und die berufliche Aus- und Weiterbildung<br />
genießen grenzüberschreitend<br />
einen sehr guten Ruf. Der VDV unterstützt<br />
deshalb die Bemühungen des<br />
deutschen Handwerks, den im deutschsprachigen<br />
Raum hoch angesehenen<br />
Meistertitel und die dahinter stehende<br />
anspruchsvolle berufliche Ausbildung<br />
auch auf EU-Ebene zu der geforderten<br />
Anerkennung zu bringen. Ein „Bachelor<br />
Professional“ ist dafür nicht notwendig<br />
und kontraproduktiv“.<br />
(IfKom/VDV)<br />
HOAI-Reform 2013 im Fokus der Diskussion<br />
zögerungen erfolgte Beauftragung des<br />
Honorargutachtens durch das BMWi (s.<br />
Ausgabe 1/<strong>2012</strong>) aufgenommen. Große<br />
Sorge bereitet hingegen der immer enger<br />
werdende Zeitplan, der keinen Puffer für<br />
mögliche weitere Verzögerungen mehr<br />
beinhaltet. Folgerichtig hat die Mitgliederversammlung<br />
des AHO einstimmig<br />
und mit Nachdruck eine unverzügliche<br />
Grundsatzentscheidung zur Rückführung<br />
der Planungsleistungen der Teile VI,<br />
X-XIII HOAI 1996 in das verbindliche<br />
Preisrecht gefordert. Eine weitere Vertagung<br />
dieser zentralen Entscheidung ist<br />
keinesfalls hinnehmbar, fasste der AHO-<br />
Vorsitzende Ernst Ebert das einhellige<br />
Votum zusammen. Gemeinsam mit Bundesingenieurkammer<br />
und Bundesarchi-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 33<br />
Ing. Ernst Ebert, Vors. AHO<br />
tektenkammer soll diese zentrale Frage<br />
in einer Resolution gegenüber dem<br />
BMWi und der Politik artikuliert werden.<br />
Aber auch die vom Bundesrat geforderte<br />
Überprüfung der Honorarstruktur stand<br />
im Mittelpunkt der Diskussion, denn die<br />
seit 1996 erstmalig erfolgte pauschale<br />
Anhebung aller Honorarsätze um 10% im<br />
Jahre 2009 hat sich vielfach nicht im gleichen<br />
Maße ausgezahlt, sondern hat im<br />
Gegenteil durch grundlegende Änderungen<br />
einzelner Tatbestände der HOAI (z.B.<br />
Bauen im Bestand) an vielen Stellen zu<br />
teilweise erheblichen Honorarminderungen<br />
geführt. Daher ist es notwendig, die<br />
Honorar mindernden Tatbestände zu<br />
korrigieren und die wirtschaftliche<br />
Dr. Peter Traichel<br />
Herbert Barton, Hauptgeschäftsführer des BDB,<br />
und Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
Anpassung der Honorartafeln<br />
sicherzustellen, die<br />
sowohl der komplexen Entwicklung<br />
des Planungsgeschehens<br />
als auch der wirtschaftlichen<br />
Situation in<br />
den Architektur- und Ingenieurbüros<br />
Rechnung trägt.<br />
AHO beauftragt<br />
Gutachten<br />
zur Entwicklung der<br />
Planungsprozesse 1992 –<br />
<strong>2012</strong><br />
Zur Verdeutlichung der<br />
erheblichen Veränderungen<br />
im Planungsgeschehen<br />
und des gestiegenen<br />
Planungsaufwandes in<br />
den letzten beiden Jahrzehnten<br />
wurde durch Herrn<br />
Dr. Klingenberger (TU<br />
Darmstadt) die Konzeption<br />
des vom AHO beauftragten<br />
Forschungsauftrages dargestellt<br />
(www.aho.de). Die<br />
generellen Veränderungen<br />
des Planungsablaufes im<br />
Hinblick auf Komplexität,<br />
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz,<br />
normative und<br />
rechtliche Rahmenbedingungen<br />
etc. sind im Prüfungsauftrag des<br />
BMWi-Honorargutachtens nicht enthalten.<br />
Das AHO-Gutachten, das diese Lükke<br />
schließen soll, wird spätestens zum<br />
30.09.<strong>2012</strong> vorliegen, damit die Ergebnisse<br />
noch in die laufende Honoraruntersuchung<br />
im BMWi eingebracht werden<br />
können.<br />
Überprüfung des Architekten- und<br />
Ingenieurvertragsrechts<br />
Trotz der intensiven Beschäftigung mit<br />
der Novellierung der HOAI 2009 hat sich<br />
der AHO auch sehr intensiv in die laufende<br />
Diskussion zur Überprüfung des<br />
Bauvertragsrechts im Bundesministerium<br />
der Justiz (BMJ) eingebracht.<br />
In seinem Gastvortrag<br />
informierte der Leiter<br />
der Unterarbeitsgruppe<br />
Architekten- und Ingenieurvertragsrecht<br />
im<br />
BMJ, Dr. Gerhard Schomburg,<br />
die Mitgliedsorganisationen<br />
des AHO über den<br />
aktuellen Sachstand der<br />
Beratungen zur Schaffung<br />
spezieller Regelungen des<br />
Architekten- und Inge-<br />
nieurvertragsrechts im<br />
BGB. Er erläuterte den<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Für die <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong>: Dr.-Ing. Jens Karstedt,<br />
Dipl.-Ing. Dieter Enseleit,<br />
Stand der Diskussionen zur rechtlichen<br />
Qualifizierung des Architekten- und Ingenieurvertrags,<br />
des Bedarfs an Sonderregelungen<br />
für den Architekten- und<br />
Ingenieurvertrag, der Einbeziehung von<br />
Fragen des Verbraucherschutzes, insbesondere<br />
ein besonderes Kündigungsrecht,<br />
Fragen der Teilabnahme und des<br />
Ing. Ernst Ebert im Gespräch<br />
mit Dipl.-Ing. Dieter Enseleit<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 33
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 15:39 Uhr Seite 34<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Dipl.-Volkswirt Herbert Barton (links), Dipl.-Ing. Ulrich Kammeyer Dipl.-Ing. Wieland Sommer (Präsident der Brandenburgischen<br />
Ingenieurkammer), Dr. Peter Traichel, Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
Beginns der Mängelgewährleistungsfrist<br />
sowie die angesichts der erheblichen<br />
wirtschaftlichen Risiken sehr drängende<br />
Frage der Gesamtschuldnerischen Haftung<br />
der Architekten und Ingenieure mit<br />
den bauausführenden Unternehmen.<br />
Besonderen Diskussionsbedarf haben<br />
die skizzierten Überlegungen zur Einführung<br />
eines besonderen Kündigungsrechts<br />
von Auftraggeber und Auftragnehmer<br />
in einer relativ frühen Phase des Vertrages<br />
(Konzeptfindungsphase) erzeugt.<br />
In zahlreichen Wortbeiträgen wurde<br />
deutlich, dass eine solche Lösung eher<br />
eine Verschlechterung des Status quo für<br />
Architektur- und Ingenieurbüros darstellen<br />
würde, nicht zuletzt durch eine<br />
zunehmende Vertragsunsicherheit und<br />
unkalkulierbare Personalvorhaltekosten.<br />
Die Teilnehmer machten deutlich, dass<br />
bestehende Vertragsgestaltungen (Stufen-<br />
bzw. Optionsverträge) in der Praxis<br />
zu befriedigenden Lösungen geführt<br />
haben. Daher bestehe keine Regelungsnotwendigkeit.<br />
34 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Dr. Schomburg konnte zu dem besonders<br />
interessierenden Aspekt der<br />
Gesamtschuldnerische Haftung leider<br />
noch keine Patentlösung verkünden,<br />
wies aber auf die verschiedenen<br />
Lösungsansätze hin, mit denen sich die<br />
Arbeitsgruppe im BMJ bislang befasst<br />
hat:<br />
• Völlige Abschaffung der Gesamtschuldnerischen<br />
Haftung der am Bau<br />
Beteiligten<br />
• Absicherung des Bestellers durch<br />
eine vom Bauunternehmen abzuschließende<br />
Versicherung oder eine<br />
vom Bauunternehmer zu stellenden<br />
Sicherheit<br />
• Absicherung durch eine vom Besteller<br />
abzuschließende Objektversicherung<br />
• Einschränkung der Gesamtschuldnerischen<br />
Haftung durch eine Regelung<br />
der Rangfolge der Anspruchnahme/Vorrang<br />
der Nacherfüllung<br />
Die bislang ergebnisoffen geführte<br />
Diskussion wird nunmehr in der Hauptarbeitsgruppe<br />
Bauvertragsrecht im BMJ<br />
fortgeführt. Angesichts der noch sehr<br />
frühen Phase gesetzgeberischen Überlegungen<br />
sei derzeit offen, ob eine Gesetzgebungsinitiative<br />
noch in dieser Legislaturperiode<br />
bis 2013 realistisch ist.<br />
Immerhin kündigte Dr. Schomburg die<br />
Vorlage des Abschlussberichts der<br />
Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht für das<br />
Jahr <strong>2012</strong> an. In der lebhaften und intensiven<br />
Diskussion wurden dem Vertreter<br />
des BMJ weitere praxisrelevante Themen<br />
auf den Weg gegeben, z.B. Möglichkeiten<br />
der außergerichtlichen Streitbeilegung,<br />
Rechtsfolgen der Einführung<br />
von Eurocodes oder auch Nichtbewertung<br />
des Angebotspreises im VOF-Vergabeverfahren.<br />
Wiedereintritt der Ingenieurkammer<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
in den AHO<br />
Ein sehr erfreuliches Resultat der<br />
diesjährigen AHO-Mitgliederversammlung<br />
ist der Wiedereintritt<br />
der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern<br />
in den AHO.<br />
Herr Dipl.-Ing. Rolf Schmidt<br />
begründete den Antrag der Ingenieurkammer,<br />
der einstimmig<br />
angenommen worden ist. Damit<br />
sind wieder alle Ingenieurkammern<br />
im AHO vereint und stärken<br />
dessen Kompetenz auf bundespolitischer<br />
Ebene zur Wahrung<br />
der Honorar- und Wettbewerbsinteressen<br />
der Ingenieure<br />
und Architekten. Der AHO-Vorsitzende<br />
Ernst Ebert dankte für das<br />
Vertrauen in die Arbeit des AHO<br />
und kündigte eine vertrauensvolle<br />
Zusammenarbeit an.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:45 Uhr Seite 35<br />
I. Allgemeine Hinweise zum 4-<br />
Augen-Prinzip nach der ENEV-<br />
Durchführungs-Verordnung <strong>Berlin</strong><br />
(ENEV-DV BLN)<br />
Allgemeine Hinweise<br />
Das Erfordernis zur Überprüfung von<br />
Nachweisen über die Einhaltung der<br />
EnEV (EnEV-Nachweise) und von<br />
Energieausweisen ergibt sich aus der<br />
EnEV-Durchführungsverordnung<br />
<strong>Berlin</strong> (EnEV-DV Bln) 1 :<br />
Bei allen Neubauten – Wohngebäuden<br />
mit mehr als zwei Wohneinheiten,<br />
Nichtwohngebäuden – und bei<br />
Änderungen von Bestandsgebäuden,<br />
für die nach der Energieeinsparverordnung<br />
(EnEV) wahlweise oder<br />
pflichtgemäß eine gesamtgebäudebezogene<br />
Energiebilanzierung durchgeführt<br />
wird, muss der Bauherr (BH)<br />
nach § 1 EnEV-DV Bln<br />
– Nachweise über die Erfüllung der<br />
Anforderungen der EnEV (EnEV-<br />
Nachweise),<br />
– die nachweisgerechte und für die<br />
Einhaltung der EnEV relevante<br />
Bau- und anlagentechnische Ausführung<br />
und<br />
– die auf der Grundlage der EnEV-<br />
Nachweise ausgestellten Energieausweise<br />
durch eine/n Prüfsachverständige/n<br />
für energetische<br />
Gebäudeplanung (im folgenden<br />
Text als PSVeGP bezeichnet) stichpunktartig<br />
auf Richtigkeit und Vollständigkeit<br />
überprüfen lassen (s. a.<br />
Hinweise zur EnEV-Durchführungsverordnung).<br />
Allgemeine Grundsätze<br />
für die Überprüfung<br />
1. Die Plausibilitätskontrolle der<br />
PSVeGP beschränkt sich auf die Einhaltung<br />
der Anforderungen der EnEV.<br />
Die Überprüfung darüber hinaus<br />
gehender Anforderungen z. B. der<br />
Unterschreitungsquoten öffentlicher<br />
Bauherren zur Erfüllung einer Vorbildfunktion<br />
oder für die Erfüllung von<br />
Fördervoraussetzungen ist nicht<br />
Gegenstand der Überprüfung durch<br />
PSVeGP im Sinne der EnEV-DV Bln.<br />
2. PSVeGP müssen ihre Aufgaben persönlich,<br />
unparteiisch, unabhängig<br />
und weisungsfrei erfüllen. Sie dürfen<br />
bei Vorhaben, an denen sie planend<br />
oder bauausführend beteiligt sind,<br />
nicht prüfend tätig werden.<br />
3. Die Überprüfung der EnEV-Nachweise,<br />
der Bauausführung und der Energieausweise<br />
erfolgt unabhängig von<br />
bauordnungsrechtlichen Anzeigeoder<br />
Genehmigungsverfahren gegenüber<br />
dem und im Auftrag des verantwortlichen<br />
Bauherren. Andere baurechtliche<br />
oder nach anderen Vorschriften<br />
geforderte Überprüfungen<br />
bleiben unberührt.<br />
4. Der PSVeGP überprüft die EnEV-<br />
Nachweise und die Energieausweise<br />
stichpunktartig auf Richtigkeit und<br />
Vollständigkeit sowie die Bauausführung<br />
in Stichproben. Aufwand, Umfang<br />
und Dichte der Überprüfungen<br />
hängen wesentlich ab von dem<br />
Gebäudetyp, der Komplexität des<br />
Vorhabens und der Einzelmaßnahmen,<br />
dem verwendeten Berechnungsverfahren<br />
sowie der Qualität<br />
und der Nachvollziehbarkeit der zu<br />
Grunde liegenden Unterlagen und<br />
Dokumente.<br />
5. Art und Umfang der zur Prüfung einzureichenden<br />
Unterlagen sind vom<br />
PSVeGP vorhabenspezifisch rechtzeitig<br />
in der Planungsphase bzw. vor<br />
jeder Prüfphase festzulegen.<br />
6. Der Bauherr bzw. der Betreiber sind<br />
dafür verantwortlich, dem PSVeGP<br />
alle für die Überprüfungen erforderlichen<br />
Zeichnungen, Unterlagen, Kontakt-<br />
und sonstige Daten rechtzeitig<br />
bereit stellen.<br />
7 Im Rahmen seiner Überprüfung weist<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Merkblatt für die Aufgaben der Prüfsachverständigen<br />
für energetische Gebäudeplanung<br />
1 Verordnung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung<br />
in <strong>Berlin</strong> (EnEV-<br />
Durchführungsverordnung <strong>Berlin</strong> – EnEV-<br />
DV Bln) vom 18.12.2009 (GVBl. S. 889),<br />
geändert durch Verordnung vom 17.<br />
Dezember 2010 (GVBl. S. 665)<br />
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt<br />
Stand 16.03. <strong>2012</strong><br />
der PSVeGP auf offensichtliche<br />
Unstimmigkeiten, Unrichtigkeiten<br />
und Unvollständigkeiten hin:<br />
a. Hat ein PSVeGP Bedenken gegenüber<br />
der Vollständigkeit oder Prüffähigkeit<br />
von Unterlagen oder<br />
gegenüber der Richtigkeit oder<br />
Nachvollziehbarkeit von EnEV -<br />
Nachweisen, Bauausführungen<br />
oder Energieausweisen übermittelt<br />
der PSVeGP diese dem Bauherren<br />
bzw. dem Eigentümer<br />
unverzüglich.<br />
b. Der Bauherr ist dazu angehalten,<br />
die Bedenken des PSVeGP durch<br />
Ergänzungen von Unterlagen oder<br />
Angaben, Änderungen der Planung<br />
oder ggf. andere gleichwertige<br />
Lösungsvorschläge auszuräumen.<br />
Eventuelle Anpassungen der<br />
EnEV-Nachweise sind vom Bauherren<br />
eigenverantwortlich zu veranlassen.<br />
c. Kommt es bezüglich des EnEV-<br />
Nachweises zu keiner Einigung<br />
zwischen dem verant- wortlichen<br />
Bauherren/ Eigentümer und dem<br />
PSVeGP, wird der Sachstand<br />
ebenfalls in einem Bericht dokumentiert<br />
und dem Bauherren übergeben.<br />
Der PSVeGP informiert<br />
darüber unverzüglich die zuständige<br />
Bauaufsichtsbehörde.<br />
8. Für die Bestätigungen der Richtigkeit<br />
und Vollständigkeit der EnEV-Nachweise<br />
bzw. der Energieausweise<br />
sowie für die Abfassung der Überprüfungsberichte<br />
stehen im Formularservice<br />
auf der Internetseite der<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
und Umwelt die Formulare bauaufsicht156,<br />
bauaufsicht157 und<br />
bauaufsicht158 zur Verfügung. Der<br />
Bauaufsichtsbehörde sind die Bestätigungen<br />
auf Verlangen vorzulegen.<br />
Alle Überprüfungsschritte sind in den<br />
Formularen bzw. Ergänzungen zu<br />
den Formularen vom PSVeGP nachvollziehbar<br />
zu dokumentieren. Die<br />
Bestätigungen für die Beantragung<br />
von Ausnahmen und Befreiungen<br />
erfolgt formlos.<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 35
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 36<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
II. Ablauf einer Überprüfung<br />
Schema<br />
PHASEN DER ÜBERPRÜFUNG DER EINHALTUNG VON EnEV-ANFORDERUNGEN<br />
Phase I<br />
Vor Baubeginn<br />
Phase II<br />
ab Baubeginn<br />
Phase III<br />
nach Baufertigstellung<br />
36 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Überprüfung der EnEV-Nachweise auf Richtigkeit und Vollständigkeit:<br />
Übereinstimmung der Planung mit den EnEV-Anforderungen?<br />
ja nein<br />
Bestätigung der EnEV-Nachweise<br />
Formular bauaufsicht 156<br />
Stichprobenkontrolle der Bauausführung<br />
Übereinstimmung der Ausführung mit den EnEV-Nachweisen?<br />
Überprüfungsbericht<br />
Formular bauaufsicht 157<br />
Hinweise, Nachweise anpassen (BH)*<br />
ja nein<br />
Ausführung EnEV-Nachweise<br />
anpassen (BH)* anpassen (BH)*<br />
Abgleich der Nachweise aus der Phase I mit den ggf. aktualisierten<br />
EnEV-Nachweisen und dem Überprüfungsbericht<br />
ggf. aktualisierte Nachweisbestätigung<br />
Formular bauaufsicht 156<br />
Überprüfung des Energieausweises auf Richtigkeit und Vollständigkeit<br />
Übereinstimmung der Daten mit denen der bestätigten EnEV-Nachweisen?<br />
ja nein*<br />
Bestätigung des Energieausweises<br />
bauaufsicht 158<br />
* Können eine oder mehrere Bestätigungen vom PSVeGP wegen Abweichungen von der EnEV, die eine Ordnungswidrigkeit oder die<br />
Nichteinhaltung der EnEV zur Folge haben können, trotz Hinweise nicht ordnungsgemäß ausgestellt werden, informiert der PSVeGP unverzüglich<br />
die zuständige Bauaufsichtsbehörde darüber.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 37<br />
Die EnEV-Nachweise sind keine bautechnischen<br />
Nachweise im Sinne der<br />
BauO Bln. Sie müssen jedoch entsprechend<br />
der EnEV-DV Bln durch einen<br />
PSVeGP geprüft werden. Die geprüften<br />
EnEV-Nachweise - einschließlich der<br />
energetischen Berechnungen, Auflistungen<br />
der zugrunde gelegten Baustoff- und<br />
Anlagenkennwerte sowie Hinweisen auf<br />
die Wärmebrückenminimierung, Luftdichtheit<br />
und Anlagentechnik - müssen<br />
an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.<br />
Grundlagen für die Überprüfung der<br />
EnEV-Nachweise<br />
(Grundsätze und Umfang der Überprüfung<br />
der EnEV-Nachweise, Anforderungen<br />
an Inhalte und erforderliche Unterlagen)<br />
1. Für die Überprüfung sind dem<br />
PSVeGP alle erforderlichen Daten,<br />
Unterlagen rechtzeitig bereit zu stellen.<br />
Der Bauherr muss dem PSVeGP<br />
auch die Kontaktdaten des Entwurfsverfassers,<br />
des Nachweiserstellers<br />
sowie gegebenenfalls weiterer beteiligter<br />
Fachplaner benennen.<br />
2. Der zu prüfende EnEV-Nachweis soll<br />
den für die Ausführung vorgesehenen<br />
Planungsstand aufweisen und entsprechend<br />
datiert und vom Bauherren<br />
gekennzeichnet sein. Planungszwischenstände<br />
sind nicht Gegenstand<br />
der Überprüfung.<br />
3. Das Ergebnis der Überprüfung ist im<br />
Formular bauaufsicht156 zu dokumentieren<br />
und ggf. zu erläutern. Die<br />
(vorläufige) Bestätigung des EnEV-<br />
Nachweises einschließlich möglicher<br />
Hinweise und Erläuterungen sind<br />
dem Bauherren vor Baubeginn auszuhändigen.<br />
4. Die EnEV-Nachweise sind unter<br />
Berücksichtigung der in der Anlage<br />
enthaltenen, nicht abschließenden<br />
Checkliste bekannter Fehlerquellen<br />
zu überprüfen. Die Überprüfung der<br />
EnEV-Nachweise erfolgt optional<br />
bzw. nach Erfordernis<br />
– durch Validitätsprüfung von relevanten<br />
Eingabedaten bzw. den<br />
Abgleich der relevanten Eingabedaten<br />
mit den in den EnEV-Nachweisen<br />
(bzw. die im Energieausweis)<br />
angegebenen Ergebnisse<br />
und<br />
– nach Erfordernis – z.B. bei auffälligen<br />
Abweichungen, die auf eine<br />
Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 27<br />
EnEV hinführen können – durch<br />
eine gezielte Überprüfung von<br />
relevanten Rechnungswegen.<br />
5. Der PSVeGP überprüft stichprobenhaft<br />
auf Richtigkeit, Vollständigkeit<br />
und Nachvollziehbarkeit (Ausführung<br />
Referenzgebäude):<br />
– geometrische Eingabedaten: Kubatur-,<br />
Flächen- und Leitungslängenermittlung<br />
– Zonierungen, Wahl der Nutzungsprofile,<br />
– Zulässigkeit von Vereinfachungen,<br />
thermische Konditionierungen, etc.<br />
– U-Werte der relevanten Bauteile<br />
der Gebäudehülle (Bauteilkatalog):Wärmeübergangswiderstände,<br />
Wärmeleitfähigkeit, Zuschläge<br />
für Befestigungsmittel o. ä., opake<br />
und transparente Bauteile, Fundamente,<br />
etc.<br />
– Wärmebrückennachweise:<br />
- pauschaler Wärmebrückenzuschlag<br />
ΔUWB = 0,10 bzw. 0,15<br />
W/(m2K) für die gesamte wärmeübertragendeUmfassungsfläche,<br />
d. h. keine rechnerische<br />
Überprüfung erforderlich<br />
- reduzierter pauschaler Wärmebrückenzuschlag<br />
ΔUWB = 0,05<br />
W/(m2K) für die gesamte übertragende<br />
Umfassungsfläche<br />
über Anwendung der Planungsbeispielen<br />
nach DIN 4108 Bbl. 2,<br />
d. h. Überprüfung der Gleichwertigkeitsnachweise<br />
in Stichproben(Konstruktionsprinzipien,Wärmedurchlasswiderstände,<br />
Referenzwerte vergleichender<br />
Berechnungen, Bauteilaufbauten,..)<br />
- genaue Berechnung der Wärmebrücken<br />
nach den anerkannten<br />
Regeln der Technik, d. h.<br />
Überprüfung von Regeldetails<br />
der relevanten Anschlüsse und<br />
von rechnerische Einzelnachweisen.<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Zeitpunkt: vor Baubeginn<br />
– Stichprobenartige Prüfung der vorgelegten energieeinsparrechtlichen<br />
Nachweisberechnung vor Baubeginn<br />
– Überprüfung von formellen, geometrischen, baulichen und anlagentechnischen<br />
Nachweisparametern in einem Umfang, wie er nach Ermessen des PSVeGP für<br />
die Bestätigung der Vollständigkeit und Richtigkeit im konkreten Einzelfall<br />
fachlich erforderlich und angemessen ist<br />
– Erstellen des Prüfbescheids unter Verwendung des Formulars bauaufsicht156<br />
zur Vorlage auf der Baustelle und zur Aufbewahrung beim Bauherrn.<br />
- Nachweis des sommerlichen<br />
Wärmeschutzes<br />
- anlagentechnische Eingabedaten:<br />
Heiz-, Kühl-, Lüftungs-,<br />
Warmwasserkreise, Beleuchtung<br />
entsprechend der Gebäudetypologie,Primärenergiefaktoren,<br />
...<br />
6. Die Unterlagen müssen prüffähig sein<br />
und dafür die erforderlichen und<br />
nachvollziehbare Angaben, Kenngrößen,<br />
zeichnerischen Darstellungen<br />
und sonstige Informationen in<br />
Abstimmung mit dem PSVeGP enthalten.<br />
Die Unterlagen müssen eine<br />
eindeutige Beurteilung der energetisch<br />
relevanten Anlagen- und Bauteile<br />
ermöglichen (I. A. Maßstab mindestens<br />
1:100). Die Form der Darstellungen,<br />
Detaillierungsgrade, u. a.<br />
sind im Einzelfall mit dem PSVeGP<br />
abzustimmen. Die Unterlagen müssen<br />
den aktuellen Planungsstand<br />
aufweisen, Planungsänderungen<br />
sind dem PSVeGP unverzüglich mitzuteilen.<br />
Vorbehaltlich einer vorhabenbezogenen<br />
Abstimmung mit dem PSVeGP<br />
sind insbesondere folgende Unterlagen<br />
und Angaben erforderlich:<br />
a) aktuelle, vollständige Plansätze<br />
mit der Darstellung des Gebäudes<br />
mit<br />
- Lageplan,<br />
- Grundrissen, Schnitten, Ansichten,<br />
Aufsichten (Maßstab =<br />
1:100), in denen die verschiedenen<br />
Bauteile der Gebäudehülle<br />
und die Zonen eindeutig<br />
bezeichnet sind,<br />
- Details,<br />
- bei bestehenden Gebäuden:<br />
Kennzeichnung der Erneuerungs-,<br />
Umbau- oder Erweiterungsbauteilen<br />
entsprechend<br />
§§ 9 Absatz1 Satz 2 oder Absatz<br />
4 und 5 EnEV;<br />
b) Bau-, Konstruktionsbeschreibun-<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 37
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 38<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
gen mit Auflistung der verschiedenen<br />
Bauteile der Gebäudehülle mit<br />
Angaben zu Materialien und Wärmedurchgangskoeffizienten(Bauteilkatalog);<br />
c) Angaben zu Nutzungen und Zahl<br />
der Nutzeinheiten;<br />
d) Brutto-Grundfläche, Höhe des<br />
Gebäudes, nachvollziehbare<br />
Kubatur- und Flächenermittlung<br />
der Gebäudehülle,<br />
e) Anlagenbeschreibung der energetisch<br />
relevanten Gebäudetechnik<br />
mit<br />
- den vorgesehenen thermodynamischen<br />
Konditionierungen,<br />
- der Wahl der Energieversorgung,<br />
- Angaben zur Nutzung erneuerbarer<br />
Energien (i.V.m. dem<br />
EEWärmeG);<br />
f) aktuelle, vollständige Darstellung<br />
der Anlagentechnik und Versorgungskreise<br />
in Grund- rissen,<br />
Schnitten und Schemata mit<br />
Angabe der Zonierung von Nutzungsbereichen.<br />
g) digitale EnEV-Nachweise des<br />
(Fach-)Planers (Papier/ digital in<br />
Abstimmung mit dem PSVeGP)<br />
mit Angaben zu der verwendeten<br />
Software (inkl. Version).<br />
h) Angaben zum gewählten Berechnungs-<br />
und Nachweisverfahren<br />
und Auflistung ggf. getroffener<br />
Vereinfachungen einschließlich<br />
prüfbare Angaben der Berechnungsschritte"<br />
i) Angabe der Art und Nachweisführung<br />
bei Änderungen im Bestand:<br />
Änderung i.S.d. § 9 Absatz 1 Satz<br />
2 (140%-Regel), Erweiterungen ><br />
50 m2 neu hinzukommender Nutzfläche<br />
(§ 9 Absatz 5);<br />
j) Zusammenstellung der Eingangsparameter<br />
der Berechnungen<br />
(inkl. Angaben zu Sonnenschutz,<br />
Luftdichtheit etc.);<br />
k) bei zonierten Gebäuden zusätzlich:<br />
eine Auflistung der unterschiedlichen<br />
Nutzungsbereiche<br />
mit Nummerierung und Flächenangaben<br />
und Angabe der Nutzungsprofile,<br />
ein Plansatz mit Markierung<br />
der Zonen und Vermaßung<br />
ihrer Grenzflächen;<br />
l) Die Rechtmäßigkeit von Abweichungen<br />
von der EnEV aufgrund<br />
einer erteilten Ausnahme oder<br />
38 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Befreiung nach § 24 Absatz 2 und<br />
§ 25 EnEV muss der Bauherr durch<br />
Vorlage der behördlichen Bescheids<br />
belegen.<br />
PHASE II -<br />
ÜBERPRÜFUNG<br />
DER BAUAUSFÜHRUNG<br />
nach Baubeginn bis Fertigstellung<br />
– Stichprobenartige Überprüfung<br />
(Sichtkontrolle) der nachweisgerechten<br />
Ausführung energetisch<br />
relevanter Bau- und Anlagenteile<br />
in einem für die Bestätigung der<br />
Bauausführung fachlich erforderlichen<br />
und angemessenen Umfang<br />
(vorhaben bezogene Ermessensentscheidung<br />
des PSVeGP).<br />
– Mitteilung relevanter Abweichungen<br />
sowie Bestätigung der nachweiskonformen<br />
Bauausführung<br />
gegenüber dem Bauherrn in<br />
einem Bericht über die Überprüfung<br />
der Bauausführung nach § 1<br />
Satz 1 Nr. 2 EnEV-DV Bln (Überprüfungsbericht)<br />
unter Verwendung<br />
des Formular bauaufsicht157.<br />
Grundlagen für die<br />
Überprüfung der Bauausführung<br />
Der PSVeGP überprüft die Ausführung<br />
der energetischen Maßnahmen über die<br />
gesamte Dauer der Bauausführung. Dies<br />
umfasst das gesamte Bauwerk von der<br />
Herstellung des unteren Gebäudeabschlusses<br />
bis zur Fertigstellung der<br />
Gebäudehülle und den Einbau anlagentechnischer<br />
Teile.. Die Verantwortung für<br />
die Übereinstimmung der Bauausführung<br />
mit den zugrundeliegenden EnEV-<br />
Nachweisen obliegt – im Rahmen ihrer<br />
Wirkungskreise – dem Bauherren und<br />
den zur Einhaltung der EnEV verpflichteten<br />
Fachunternehmen."<br />
1. Der PSVeGP überprüft durch stichprobenhafte<br />
Sichtkontrollen die Ausführung<br />
aller für die Einhaltung der<br />
EnEV relevanten Maßnahmen über<br />
die gesamte Dauer der Bauausführung.<br />
Der Umfang und die Dichte der<br />
Stichproben sind abhängig von<br />
– der Komplexität des Vorhabens<br />
– der Zuverlässigkeit des ausführenden<br />
Unternehmens<br />
– der Vergleichbarkeit von Einzelmaßnahmen<br />
(gleiche Wandauf-<br />
bauten, Fenstertypen, Anlagen,<br />
etc.)<br />
2. Dem PSVeGP müssen Namen und<br />
Kontaktdaten der Bauleitung bzw. die<br />
Fachbauleitung (Bau- und Anlagentechnik)<br />
durch den Bauherren<br />
benannt werden.<br />
3. Die relevanten Bau- und Anlagenteile<br />
sind in funktionsgerechtem und<br />
unverbautem frei einsehbarem Einbauzustand<br />
zu überprüfen, bevor<br />
später auszuführende Arbeiten die<br />
Sicht einschränken. Dafür ist der<br />
PSVeGP rechtzeitig durch den Bauherrn<br />
zu benachrichtigen über<br />
– den Bau- bzw. Ausführungsbeginn,<br />
– die Ausführung wesentlicher energetisch<br />
relevanter und insbesondere<br />
später nicht mehr zugänglicher<br />
Anlagen- und Bauteile,<br />
– die Fertigstellung energetisch relevanter<br />
und funktionsgerecht eingebauter<br />
Bau- und Anlagenteile.<br />
4. Der PSVeGP legt in gleicher Weise<br />
rechtzeitig die zu überprüfende<br />
Stichprobe fest. Die Stichprobe soll<br />
eine klar definierte (Bau-) Maßnahme<br />
(Einbau eines Fensters, Ausführung<br />
eines Wandtyps/ Dämmmaßnahmen,<br />
Einbau der heizungstechnischen<br />
Anlage bzw. Anlagenteile, Dämmung<br />
der Leitungen, o. ä.) umfassen. Gleiche<br />
Gebäudeeinheiten (z.B. Wohn-/<br />
Bürogeschosse, Nutzungseinheiten,<br />
...) können entsprechend vergleichbarer<br />
Merkmale (Nutzung, Größe/<br />
Volumen, Ausstattung, u.a.) zu Typen<br />
zusammenfasst werden.<br />
5. Der PSVeGP überprüft stichprobenhaft<br />
insbesondere<br />
– die Übereinstimmung des wärmeschutztechnischen<br />
Aufbaus und<br />
die Eigenschaften der wärmeübertragenden<br />
Hüllflächenbauteile mit<br />
dem EnEV-Nachweis und die<br />
Übereinstimmung der relevanten<br />
Anlagentechnik mit dem EnEV-<br />
Nachweis u.a. auf Grundlage von<br />
Produktnachweisen, -zulassungen,<br />
sonstige Datenblättern der<br />
verwendeten Bauprodukte und<br />
Haustechnikkomponenten<br />
– die Bauausführung hinsichtlich<br />
der Anforderungen an eine luftdichte<br />
Bauweise<br />
– die Übereinstimmung der relevanten<br />
Anlagentechnik mit dem EnEV-<br />
Nachweis<br />
– das Vorliegen von Produktnach-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 39<br />
weisen bzw. -datenblättern der<br />
verwendeten EnEV- relevanten<br />
Bauprodukte und Haustechnikkomponenten<br />
6. Die Ergebnisse der Überprüfung sind<br />
in einem Überprüfungsbericht zusammen<br />
zu fassen<br />
(Formular bauaufsicht157).<br />
Phase III –<br />
ABSCHLUSSPRÜFUNG UND<br />
ENERGIEAUSWEISPRÜFUNG"<br />
Zeitpunkt: nach Baufertigstellung<br />
– Abgleich der vorläufigen Nachweisbestätigung<br />
aus Phase I mit<br />
den Ergebnissen aus Phase II bzw.<br />
Feststellung von Abweichungen<br />
nach Fertigstellung aller energetisch<br />
relevanten Bau- und Anlagenteile.<br />
Überprüfung der ggf.<br />
überarbeiteten bzw. angepassten<br />
EnEV-Nachweise und abschließende<br />
Bestätigung der EnEV-<br />
Nachweise.<br />
– Stichprobenhafte Überprüfung<br />
der Vollständigkeit und Richtigkeit<br />
der Angaben im Energieausweis in<br />
Bezug auf die in der abschließenden<br />
Nachweisbestätigung geprüften<br />
EnEV- Nachweise und auf den<br />
Überprüfungsbericht.<br />
– Bestätigung des Energieausweises<br />
unter Verwendung des Formular<br />
bauaufsicht158.<br />
1. Die Bestätigung des Energieausweises<br />
erfolgt erst nach Durchlauf der<br />
vorausgegangenen<br />
"Phasen bzw. auf Grundlage der ggf.<br />
aktualisierten Bestätigung der EnEV-<br />
Nachweise. Die Angaben im Energieausweis<br />
müssen den nach Baufertigstellung<br />
gegebenenfalls angepassten<br />
bzw. geänderten EnEV-Nachweisen<br />
entsprechen."<br />
2. Der PSVeGP bestätigt dazu die Übereinstimmung<br />
der energetischen<br />
Kennwerte des Energieausweises mit<br />
denen des abschließend bestätigten<br />
EnEV-Nachweises unter besonderer<br />
Beachtung möglicher Änderungen<br />
oder Abweichungen während der<br />
Bauausführung oder von Ausnahmen<br />
und Befreiungen nach § 24 Abs.2<br />
bzw. § 25 EnEV. Die Rechtmäßigkeit<br />
einer Ausnahme oder Befreiung ist zu<br />
belegen (s. o.)<br />
3. Die in EnEV-Nachweisen nach § 6<br />
Absatz 1, Satz 3 rechnerisch berücksichtigte<br />
Luftdichtheit des Gebäudes<br />
auf Grundlage einer Dichtheitsprüfung<br />
nach DIN EN 13 829 : 2001-02<br />
ist durch die Vorlage des Prüfberichts<br />
über deren Durchführung zu belegen.<br />
III. BESTÄTIGUNGEN FÜR ANTRÄGE<br />
AUF AUSNAHMEN UND BEFREI-<br />
UNGEN NACH § 24 ABSATZ 2 UND<br />
§ 25 EnEV<br />
Allgemeines<br />
Verantwortlicher Antragsteller für Anträge<br />
auf Ausnahmen und Befreiungen ist<br />
der Bauherr bzw. der Eigentümer.<br />
PSVeGP bestätigen das Vorliegen der<br />
Voraussetzungen für eine Ausnahme<br />
oder Befreiung auf Grundlage einer<br />
sachlich und fachlich nachvollziehbaren,<br />
prüfbaren und projektbezogenen<br />
Begründung des Bauherren.<br />
Dafür muss der Bauherr dem PSVeGP<br />
entsprechende baufachlich-konzeptionelle<br />
Nachweise (§ 24 Absatz 2 EnEV)<br />
oder Berechnungen über eine wirtschaftliche<br />
Unzumutbarkeit (§ 25 EnEV) einschließlich<br />
aller für die Bewertung der<br />
Ausnahme- oder Befreiungsgründe<br />
erforderlichen Daten, Unterlagen und<br />
Informationen vorlegen. Die Bestätigung<br />
des PSVeGP über das Vorliegen der Voraussetzungen<br />
erfolgt schriftlich und<br />
formlos gegenüber dem Bauherren.<br />
Nicht nachvollziehbare, nicht prüffähige<br />
oder nicht schlüssige Begründungen<br />
sind ebenfalls schriftlich zu dokumentieren.<br />
Die Dokumentation ist dem Bauherren<br />
auszuhändigen.<br />
Ausnahmen nach § 24 Absatz 2 EnEV<br />
Eine Bewertung einer Ausnahme hängt<br />
von der Art der Innovation ab und kann<br />
nur im Einzelfall beurteilt werden. Kriterien<br />
zur Bewertung i. S. d. EnEV können<br />
Vergleiche von Energiekennwerten, Effizienzkennwerten,CO2-Einsparpotentiale<br />
zu bekannten Systemen, Bauarten,<br />
Energieträgern, o. ä. sein. Beurteilungsgrundlage<br />
für den PSVeGP sind<br />
a) eine ausführliche und nachvollziehbare<br />
Beschreibungen des alternativen<br />
Lösungsvorschlags in Bezug auf<br />
die Ziele der EnEV (Reduzierung von<br />
Wärme-/ Kälteverlusten, optimierte<br />
Anlagentechnik, Reduzierung der Primärenergiebedarfe),<br />
b) technische Datenblätter, Prüf-, Forschungsberichte,<br />
Simulationen<br />
c) sonstige Unterlagen und Nachweise<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Alternative Lösungsansätze, die von den<br />
der EnEV zugrunde gelegten, Berechnungsgrundlagen,<br />
Technischen Regeln,<br />
Normen, etc. nicht bewertet werden können,<br />
sind vom Bauherren ggf. unter Einbindung<br />
des Fachplaners konzeptionelltechnisch<br />
schlüssig und fachlich nachvollziehbar<br />
darzulegen.<br />
Nachweispflichten nach § 23 EnEV bleiben<br />
davon unberührt, mögliche Überschneidungen<br />
mit § 23 EnEV insbesondere<br />
Absatz 3 sind zu beachten. Mögliche<br />
zusätzliche produktbezogene Nachweise<br />
sind vom Hersteller im Rahmen<br />
eines Produkt- bzw. Verwendbarkeitsnachweises<br />
nach den einschlägigen<br />
Rechtsvorschriften zu führen.<br />
Befreiungen nach § 25 EnEV<br />
Die zuständige Bauaufsicht kann von<br />
(einzelnen oder allen) Anforderungen der<br />
EnEV befreien, wenn die Anforderungen<br />
im Einzelfall wegen besonderer Umstände<br />
durch einen unangemessenen Aufwand<br />
oder in sonstiger Weise zu einer<br />
unbilligen Härte führen. Eine unbillige<br />
Härte liegt insbesondere dann vor, wenn<br />
– die erforderlichen Aufwendungen<br />
innerhalb der üblichen Nutzungsdauer<br />
(Neubau) bzw. innerhalb einer<br />
angemessenen Frist (bestehende<br />
Gebäude) durch die eintretenden Einsparungen<br />
nicht erwirtschaftet werden<br />
können (§ 25 Absatz 1 EnEV),<br />
– ein Eigentümer/ Bauherr zum gleichen<br />
Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen<br />
Zusammenhang mehrere<br />
Pflichten nach dieser Verordnung<br />
oder zusätzlich nach anderen öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften aus<br />
Gründen der Energieeinsparung zu<br />
erfüllen hat und die dadurch resultierende<br />
persönliche wirtschaftliche<br />
Belastung nicht zumutbar ist (§ 25<br />
Absatz 2 EnEV),<br />
Für die Bewertung einer unbilligen Härte<br />
nach § 25 Absatz 1 EnEV muss der Bauherr<br />
bzw. der Eigentümer die Aufwendungen<br />
(anfallende Gesamtkosten) der<br />
energetischen Maßnahme den zu erwartenden<br />
Einsparungen zum Zeitpunkt X<br />
(übliche Nutzungsdauer, angemessene<br />
Frist) gegenüberstellen (Bilanzierung).<br />
Die Bilanzierung wird u. a. beeinflusst<br />
durch die<br />
a. (Anfangs-)Investitionskosten/ Kredite:<br />
Laufzeiten, Zins- und Tilgungssätze,<br />
b. Instandhaltungskosten (Betrieb, Versicherung,<br />
etc. insbes. bei Anlagen)<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 39
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 40<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
c. zu erwartenden Nutzungsdauern<br />
(Neubau) bzw. Restnutzungsdauern<br />
(Bestand) eines Gebäudes (Bauteile,<br />
Anlagen, Mittel Gesamtgebäude),<br />
d. zu erwartende Energiepreissteigerung,<br />
e. zu erwartenden Inflationsraten:<br />
Schätzungen auf Grundlage verfügbarer<br />
Daten von Wirtschaftsinstituten<br />
f. eingesparte Energiekosten (Primär-/<br />
Verbrauchsenergie)<br />
g. zu erwartender Wertsteigerungen der<br />
Immobilie<br />
h. Einnahmen durch Modernisierungsumlagen<br />
(EnEV-begründete Modernisierung)<br />
bei nicht selbstgenutzten<br />
Gebäuden o. ä.<br />
IV. ANLAGE:<br />
BEKANNTE FEHLERQUELLEN<br />
1 in EnEV-Nachweisen:<br />
1.1 Bezug auf überholte Fassungen<br />
der EnEV oder DIN-Normen<br />
1.2 unzulässige Änderung des Referenzgebäudes<br />
1.3 unzulässige Änderung der festen<br />
Randparameter zu Klimastandort,<br />
Luftwechselrate, internen Wärmegewinnen,<br />
Nachtabschaltung etc.<br />
1.4 Lücken bei der Flächenermittlung<br />
der Gebäudehülle<br />
1.5 Lücken bei der Erfassung der<br />
Kubatur<br />
1.6 Lücken bei der Definition der thermischen<br />
Systemgrenze<br />
1.7 Wärmebrückenzuschlag falsch /<br />
nicht nachgewiesen<br />
1.8 fehlender Nachweis des sommerlichen<br />
Wärmeschutzes<br />
1.9 bei der U-Wert-Berechnung: falscheWärmeübergangswiderstände<br />
und fehlende Berücksichtigung<br />
von Luftspalten und Befestigungen<br />
40 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
1.10 fehlerhafte Wahl der Temperaturkorrekturfaktoren<br />
1.11 fehlerhafte Erfassung der Flächen<br />
(Rohbaubezug), Ausrichtung und<br />
Verschattung von Fenstern<br />
1.12 Wahl des falschen Berechnungsverfahren<br />
für Nichtwohngebäude<br />
1.13 Fehler bei der Zuordnung, Nummerierung<br />
und Flächenerfassung der<br />
Zonen nach Nutzungsbereichen<br />
1.14 unzulässige Wahl eines Einzonenmodells<br />
1.15 unzutreffende Wahl der Nutzungsprofile<br />
1.16 unzulässige Änderung der Nutzungsprofile<br />
1.17 fehlende oder fehlerhafte Erfassung<br />
der Zonen-Grenzflächen<br />
1.18 unzutreffende Eingaben zu Anordnung,<br />
Länge und Dämmung der<br />
Rohrleitungen<br />
1.19 unzutreffende Eingaben zu Aufstellort<br />
und Art von Wärmeerzeuger<br />
und Speicher<br />
1.20 fehlender Nachweis bei individuellen<br />
Ansatz des KWK-Anteils bei<br />
Fernwärme<br />
1.21 Widerspruch zwischen Temperaturen<br />
und Heizsystemen<br />
1.22 fehlende Berücksichtigung der Zirkulationsleitung<br />
des TWW-Netzes<br />
1.23 fehlende Berücksichtigung des<br />
elektr. Nachheizregisters bei Lüftungsanlagen<br />
1.24 fehlende oder fehlerhafte Angaben<br />
zum Wärmerückgewinnungsgrad<br />
1.25 fehlende Berücksichtigung der<br />
Feuchteregulierung<br />
1.26 Tageslichtversorgung unzutreffend<br />
/ nicht nachgewiesen<br />
1.27 u.v.m.<br />
2 bei der Bauausführung:<br />
2.1 Abweichungen von vorgegebenen<br />
Materialkennwerten, Konstruktionen<br />
und Komponenten<br />
2.2 nicht versenkte / thermisch<br />
getrennte Verdübelung der Dämmung<br />
2.3 offene oder mit Kleber verfüllte<br />
Stossfugen zwischen Dämmplatten<br />
2.4 durch offene Klebefugen hinterlüftete<br />
Dämmung<br />
2.5 U-Wert der Fenster nicht nachgewiesen<br />
2.6 ungeplante Wärmebrücken<br />
2.7 nicht luftdichter Anschluss von<br />
Fenstern und Türen<br />
2.8 Lücken, Beschädigungen oder<br />
mangelhafte Befestigung der Luftdichtheitsfolie<br />
2.9 unzureichende Dämmung von<br />
Rohrleitungen und Armaturen<br />
2.10 fehlender hydraulischer Abgleich<br />
2.11 abweichende Einstellung der<br />
Steuerung (Heizkurve, Systemtemperaturen...)<br />
2.12 fehlende oder unzureichende<br />
Fachunternehmererklärungen<br />
2.13 fehlende oder fehlerhaft eingebaute<br />
Nachströmöffnungen für Abluftanlagen<br />
2.14 u.v.m<br />
3. beim Energieausweis:<br />
3.1 geänderte Ausführung nicht<br />
3.2<br />
berücksichtigt (Dämmstoffe, Fenster,<br />
An-lagenkomponenten,...)<br />
Änderungen nicht nachvollziehbar<br />
ausgewiesen<br />
3.3 Änderungen berücksichtigt, aber<br />
EnEV-Kennwerte nicht eingehalten<br />
3.4 Luftdichtheitsmessung vorausgesetzt<br />
oder wegen WRG erforderlich,<br />
aber nicht nachgewiesen<br />
3.5 Fehlerhafter Bezug auf gültige Fassung<br />
der EnEV<br />
3.6 gemeinsamer Ausweis für<br />
gemischt genutzte Gebäude
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 41<br />
Die KlimaSchutzPartner des Jahres <strong>2012</strong><br />
stehen fest. Der renommierte Klimaschutzpreis<br />
der <strong>Berlin</strong>er Wirtschaft wurde<br />
am 23. Mai im Rahmen der <strong>Berlin</strong>er<br />
Energietage bei einer Festveranstaltung<br />
vor mehr als 200 Gästen verliehen. Die<br />
Auszeichnung des Bündnisses der KlimaSchutzPartner<br />
prämierte praxisnahe<br />
<strong>Berlin</strong>er Klimaschutzprojekte in den<br />
Kategorien „Erfolgreich realisierte Projekte“,<br />
„Erfolgversprechende und innovative<br />
Planungen“ sowie „Anerkennungspreis<br />
für öffentliche Einrichtungen“.<br />
Die Laudatoren in diesem Jahr<br />
waren Christian Gaebler, Staatssekretär<br />
für Verkehr und<br />
Umwelt, Dr. Jens Karstedt,<br />
Präsident der<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> und<br />
Stephan Schwarz, Präsident<br />
der Handwerkskammer<br />
<strong>Berlin</strong>.<br />
Der Wettbewerb „Klima-<br />
SchutzPartner des Jahres“<br />
steht seit 2002 für<br />
<strong>Berlin</strong>er Leuchtturmprojekte<br />
in den Bereichen<br />
Klimaschutz und Energieeffizienz.<br />
Jährlich bewerben sich zahlreiche<br />
<strong>Berlin</strong>er Projekte aus unterschiedlichen<br />
Branchen und Bereichen mit innovativen<br />
Ideen und Vorhaben.<br />
In der Kategorie A für „Erfolgreiche Projekte“<br />
wurde die ECOPLAN GmbH für die<br />
energetische Sanierung einer Wohnanlage<br />
geehrt, durch die eine CO 2 -Reduktion<br />
von 84% erreicht wird. Neben den energetischen<br />
Anforderungen bildete der<br />
Erhalt des ursprünglichen Gebäudecharakters<br />
einen besonderen Schwerpunkt.<br />
Für „Erfolgreiche und innovative<br />
Planungen“ in der Kategorie<br />
B wurden die Deimel<br />
Oelschläger Architekten für<br />
die Umsetzung des ersten 7geschossigenNullemissionshauses<br />
ausgezeichnet. Das<br />
Projekt überzeugte die Jury durch seine<br />
außerordentlich hohe Energieeffizienz<br />
und weist bereits heute den Weg in die<br />
Zukunft. Den „Anerkennungspreis für<br />
öffentliche Einrichtungen“ in der Kategorie<br />
C erhielt die <strong>Berlin</strong>er Stadtreinigung<br />
mit einem innovativen Hybrid-Entsorgungsfahrzeug.<br />
Ein wasserstoffbetriebenes<br />
Brennstoffzellensystem ermöglicht<br />
deutlich reduzierte Lärm- und Abgasemissionen<br />
sowie Kraftstoffeinsparungen<br />
von ca. 30%.<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
KlimaSchutzPartner des Jahres <strong>2012</strong> ausgezeichnet<br />
Dr.-Ing. Jens Karstedt<br />
Der deutschen Wirtschaft fehlen<br />
immer mehr Ingenieure. Im Vergleich<br />
zu 2010 hat sich im vergangenen Jahr<br />
die Situation noch einmal drastisch<br />
verschärft: Im Jahresdurchschnitt<br />
2011 konnten 72.000 offene Ingenieurstellen<br />
nicht besetzt werden. Der<br />
durch die Nichtbesetzung entstandene<br />
Wertschöpfungsverlust für die<br />
deutsche Wirtschaft beträgt knapp<br />
Mitte hinten Dr.-Ing. Jens Karstedt, rechts daneben Dipl.-Ing. Markus Wolfsdorf<br />
mit den Preisträgern<br />
Geschäftsmodell Deutschland in Gefahr<br />
acht Milliarden Euro. Dies zeigt die<br />
aktuelle Studie ‚Ingenieure auf einen<br />
Blick 2011/12‘, die der VDI und das<br />
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
(IW) auf der Hannover Messe präsentierten.<br />
„Die aktuellen Zahlen sind alarmierend<br />
und der Abwärtstrend setzt sich auch in<br />
diesem Jahr fort“, erklärt VDI-Direktor Dr.<br />
Die Bewerbungen sind während der <strong>Berlin</strong>er<br />
Energietage als Posterpräsentation<br />
ausgestellt und werden in Kürze auf der<br />
Internetseite www.klimaschutzpartnerberlin.de<br />
veröffentlicht. Das Bündnis<br />
„KlimaSchutzPartner <strong>Berlin</strong>“ ist ein<br />
Zusammenschluss von Architektenkammer<br />
<strong>Berlin</strong>, Bauindustrieverband <strong>Berlin</strong>-<br />
Brandenburg e.V., <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong>,<br />
Bund der <strong>Berlin</strong>er Haus- und Grundbesitzervereine<br />
e.V., BFW <strong>Berlin</strong>-Brandenburg<br />
e.V., Handwerkskammer <strong>Berlin</strong>,<br />
IHK <strong>Berlin</strong>, Investitionsbank <strong>Berlin</strong>, TSB-<br />
Innovationsagentur <strong>Berlin</strong> GmbH und<br />
Verband <strong>Berlin</strong>-Brandenburgischer Wohnungsbauunternehmen<br />
e.V. Der Preis<br />
„KlimaSchutzPartner des Jahres“ wird<br />
auch unterstützt durch die Vattenfall<br />
Europe AG.<br />
8 Mrd. Euro Wertschöpfungsverlust durch fehlende Ingenieure<br />
Willi Fuchs. „Der aktuelle VDI/IW-Ingenieurmonitor<br />
für März <strong>2012</strong> weist aus,<br />
dass in Deutschland derzeit 110.400<br />
offene Ingenieurstellen existieren. Das ist<br />
der höchste Wert seit Beginn der Erhebung<br />
im August 2000.“<br />
Ingenieurmangel massive Bedrohung<br />
für Geschäftsmodell Deutschland<br />
Wie wichtig Ingenieure für den Motor des<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 41
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 42<br />
<strong>Baukammer</strong> / Berufspolitik / Bildung<br />
Technologie- und Innovationsstandorts<br />
Deutschland sind, zeigt der wirtschaftliche<br />
Wertschöpfungsbeitrag dieser<br />
Berufsgruppe. „Im Jahr 2011 betrug er<br />
mindestens 178 Milliarden Euro“, so IW-<br />
Geschäftsführer Dr. Hans-Peter Klös. In<br />
den Branchen mit der höchsten Ingenieurdichte<br />
– technische Forschungsund<br />
Entwicklungs-Dienstleistungen,<br />
Elektroindustrie, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik<br />
sowie IT und Telekommunikation<br />
– werden im Jahr rund 73 Milliarden<br />
Euro in die Entstehung von Innovationen<br />
investiert. Dies entspricht 60 Prozent<br />
der gesamten Innovationsaufwendungen<br />
Deutschlands.<br />
Der Erfolg der wichtigen Ingenieurbranchen<br />
zeigt sich auch bei den Exporten.<br />
Sie erreichten im Jahr 2011 zusammengenommen<br />
ein Volumen an Güterexporten<br />
und Dienstleistungseinnahmen aus<br />
dem Ausland in Höhe von 562 Milliarden<br />
Euro. Dies entspricht einem Anteil an den<br />
gesamten Ausfuhren und der Dienstleistungseinnahmen<br />
aus dem Ausland in<br />
Höhe von 44,8 Prozent. „Die Zahlen<br />
sprechen für sich. Wenn wir die Ingenieurlücke<br />
nicht schließen können, wird<br />
der weiter fortschreitende Fachkräfteengpass<br />
zu einer massiven Bedrohung<br />
Ehrung<br />
Frau Karola Althaus, Präventionsexpertin der Berufsgenossenschaft<br />
der Bauwirtschaft, hat im Auftrag des<br />
Vorstandes Herrn Dipl.-Ing. (FH) Marco Ilgeroth „in<br />
Anerkennung seiner Verdienste um die Arbeitssicherheit<br />
und den Gesundheitsschutz“ geehrt und gedankt.<br />
Herr Ilgeroth hat bereits an der Technischen<br />
Fachhochschule <strong>Berlin</strong><br />
(heute: Beuth Hochschule für Technik<br />
<strong>Berlin</strong>) regelmäßig und erfolgreich<br />
an den Veranstaltungen über Sicherheitstechnik<br />
teilgenommen und so<br />
den Einstieg für die Zusatzausbildung<br />
als Fachkraft für Arbeitssicherheit<br />
erreicht, die er dann bei der Tiefbau-Berufsgenossenschaft<br />
schon<br />
als Student zum Abschluss brachte.<br />
Danach folgte die Zertifizierung als<br />
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator<br />
(SiGeKo).<br />
Diese Aufgabe nimmt er u. a. seit mehr als 10 Jahren für zahlreiche<br />
Projekte in der gesamten Bundesrepublik wahr.<br />
Auch wir gratulieren ihm ganz herzlich zu dieser Ehrung und<br />
Anerkennung – verbunden mit den besten Wünschen für eine<br />
erfolgreiche Zukunft.<br />
Prof. Dipl.-Ing. Günter Hanschke<br />
42 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
des Geschäftsmodell Deutschlands führen“,<br />
macht Klös deutlich.<br />
Bildungsaufsteiger mit<br />
besten Chancen im Ingenieurberuf<br />
Deutschland fehlt es am Ingenieurnachwuchs:<br />
In keinem anderen Land Europas<br />
sind so viele ältere Ingenieure am<br />
Arbeitsmarkt wie in Deutschland. 21 Prozent,<br />
also jeder fünfte erwerbstätige<br />
Ingenieur, kommen aus dem Alterssegment<br />
55+. Folglich werden in den kommenden<br />
Jahren in großem Ausmaß Ingenieure<br />
aus dem aktiven Erwerbsleben<br />
ausscheiden. Potenziale für kommende<br />
Ingenieurgenerationen können insbesondere<br />
bei Kindern und Jugendlichen,<br />
deren Eltern keine Akademiker sind, liegen.<br />
In keinem anderen Fach haben so<br />
viele Hochschulabsolventen Eltern ohne<br />
akademische Abschlüsse, Ingenieure<br />
sind damit die Bildungsaufsteiger par<br />
exellence.<br />
Technische Bildung<br />
in Lernprogrammen der Schulen<br />
verankern<br />
Doch trotz steigender Absolventenzahlen<br />
wird Deutschlands Bedarf an hochqualifizierten<br />
Ingenieuren langfristig nicht<br />
gedeckt und die Ingenieurlücke nicht<br />
geschlossen werden. „An der demografischen<br />
Entwicklung können wir nichts<br />
ändern. Wir müssen aber dafür sorgen,<br />
dass technische Bildung in den Lehrprogrammen<br />
der Schulen verankert wird.<br />
Ohne diesen Schritt ist die technische<br />
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />
unseres Landes dauerhaft nicht mehr zu<br />
halten“, warnt Fuchs.<br />
Über den VDI<br />
Der VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.<br />
ist Sprecher der Ingenieure und der Technik.<br />
Mit seinen fast 150.00 Mitgliedern ist<br />
der VDI der größte technisch-wissenschaftliche<br />
Verein Europas. Als gemeinnützige<br />
und unabhängige Organisation<br />
ist er zentraler Ansprechpartner für technische,<br />
berufliche und politische Fragen.<br />
Sein starkes Netzwerk unterstützt den<br />
Austausch zwischen Industrie, Wissenschaft,<br />
Gesellschaft, Politik und Ingenieuren.<br />
Der VDI gestaltet Lösungen für<br />
relevante Zukunftsfragen mit dem Ziel,<br />
den Standort Deutschland nachhaltig zu<br />
stärken.<br />
Quelle: Verein Deutscher Ingenieure<br />
Neue Bezeichnung der Fachgruppe 6<br />
Nach einer Satzungsänderung betreut die Fachgruppe 6 mit<br />
ihren Mitgliedern u. a. nachfolgende Gebiete:<br />
Brandsicherheit, Geotechnik, Projektsteuerung, Sicherheits-<br />
und Umwelttechnik sowie andere Fachrichtungen
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 43<br />
Am 20. April <strong>2012</strong> wurde die König-Ludwig-Brücke<br />
in Kempten mit einem Festakt<br />
als „Historisches Wahrzeichen der<br />
Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet.<br />
Die 1852 eingeweihte König-Ludwig-<br />
Brücke über die Iller ist ein einzigartiges<br />
Denkmal des frühen Eisenbahnzeitalters.<br />
Sie ist weltweit eine der ältesten erhaltenen<br />
hölzernen Eisenbahnbrücken. Der<br />
fünf Meter hohe hölzerne Träger aus Gitterwerk<br />
wurde nach dem Howschen<br />
System konstruiert. Er ruht auf zwei ca.<br />
25 Meter hohen Natursteinpfeilern. Die<br />
Lichtweiten der drei Brückenabschnitte<br />
über die Iller betragen (von West nach<br />
Ost) ca. 35 m, 52 m und 26 m.<br />
In Bayern ist die König-Ludwig-Brücke<br />
das zweite und bundesweit das elfte<br />
Bauwerk, welches mit dem von der Bundesingenieurkammer<br />
verliehenen Titel<br />
geehrt wird. Damit steht sie in einer Reihe<br />
mit so bedeutenden Ingenieurbauwerken<br />
wie dem Schiffshebewerk Niederfinow,<br />
dem Stuttgarter Fernsehturm<br />
und der Fleischbrücke Nürnberg.<br />
Die heute als Fuß- und Radwegbrücke<br />
genutzte König-Ludwig-Brücke war<br />
außerdem eines der ersten Bauwerke in<br />
König-Ludwig-Brücke in Kempten<br />
wurde Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst<br />
Deutschland, dessen Tragelemente nicht<br />
empirisch, sondern auf Grundlage theoretischer<br />
Überlegungen bemessen wurde.<br />
Die nahezu im Originalzustand erhaltene<br />
Brücke markiert damit auch den<br />
Übergang von der empirischen zur theoretisch<br />
begründeten Konstruktion. Ohne<br />
Übertreibung ist sie als weltweit einzigartiges<br />
Monument der Bautechnik anzusehen.<br />
Der Festakt an der König-Ludwig-Brück<br />
begann um 11:00 Uhr. Am Bauwerk wurde<br />
eine Ehrentafel enthüllt. Neben dem<br />
Oberbürgermeister der Stadt Kempten,<br />
Herrn Dr. Ulrich Netzer, sprachen die<br />
Präsidenten der Bundesingenieurkammer<br />
und der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau,<br />
Hans-Ullrich Kammeyer<br />
und Dr.-Ing. Heinrich Schroeter.<br />
Im Anschluss an den Festakt wurde um<br />
12:15 Uhr im Alten Kraftwerk die von der<br />
Bundesingenieurkammer herausgegebene<br />
neue Broschüre über die König-<br />
Ludwig-Brücke vorgestellt.<br />
Den Festvortrag hielt der Autor der Broschüre,<br />
Prof. Dr.-Ing. Stefan M. Holzer,<br />
der in seinem genau recherchierten Text<br />
neben bekannten auch viele unbekannte<br />
Fakten über Kemptens baukulturelles<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Kleinod zusammengetragen hat. Auf den<br />
insgesamt 94 Seiten der reich illustrierten<br />
Broschüre werden auf allgemeinverständliche<br />
Weise das interessante historische<br />
Umfeld und die Bedeutung der<br />
Brücke für die Geschichte des Bauingenieurwesens<br />
aufgezeigt. Dabei kommen<br />
auch die zeitgenössischen Ingenieure<br />
selbst zu Wort. Dem Leser wird ein überaus<br />
lebendiger Eindruck von dem regen<br />
inter-nationalen Gedankenaustausch,<br />
der die innovationsfreudige Zeit um die<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts charakterisierte,<br />
vermittelt.<br />
Die Publikation, die als Band 11 der<br />
Schriftenreihe zu den Historischen Wahrzeichen<br />
der Ingenieurbaukunst in<br />
Deutschland erschienen ist, kann zum<br />
Preis von 9,80 bei der Bundesingenieurkammer<br />
(Tel.: 030-25342900), im Internet<br />
unter www.bingk.de/order-hw oder im<br />
Buchhandel bestellt werden.<br />
Die Aktion „Historische Wahrzeichen der<br />
Ingenieurbaukunst in Deutschland“ wird<br />
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau<br />
und Stadtentwicklung im Rahmen der<br />
Initiative Baukultur und dem gleichnamigen<br />
Förderverein unterstützt.<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 43
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 44<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Im Namen des Senats von <strong>Berlin</strong> beantworte<br />
ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:<br />
Frage 1: In welchem Jahr wurde die<br />
Spandauer Freybrücke über die Havel<br />
errichtet und erstmals für die Überfahrung<br />
freigegeben?<br />
Antwort zu 1: Die Freybrücke wurde in<br />
den Jahren 1909/10 errichtet und<br />
anschließend dem Verkehr übergeben.<br />
Frage 2: Wie stark wurde die Brücke im<br />
Zweiten Weltkrieg zerstört? Kam ihr Wiederaufbau<br />
bautechnisch einem Neubau<br />
gleich oder wurden wesentliche Konstruktionselemente<br />
erhalten?<br />
Antwort zu 2: 1945 wurde die Brücke am<br />
südöstlichen Pfeiler neben der Havel<br />
gesprengt. Infolge der Sprengung stürzte<br />
das Hauptfeld der Brücke in die Havel<br />
und die beiden angrenzenden Randfelder<br />
wurden ebenfalls schwer beschädigt.<br />
Der Wiederaufbau in den Jahren 1949 –<br />
1951 ist nicht einem Neubau gleichzusetzen,<br />
da weitestgehend wesentliche<br />
Elemente der Ursprungskonstruktion<br />
nach Ausbau und Aufarbeitung wiederverwendet<br />
wurden. Zudem wurden<br />
durch die Sprengung unkontrollierte<br />
Belastungen in die Unterbauten der<br />
Brücke eingeleitet, die zu irreparablen<br />
Vorschädigungen der Brückengründung<br />
geführt haben.<br />
Frage 3: Wann und aufgrund welcher<br />
44 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
17. Wahlperiode<br />
Kleine Anfrage des Abgeordneten Daniel Buchholz (SPD) vom 21. Februar <strong>2012</strong><br />
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Februar <strong>2012</strong>) und Antwort<br />
Ausbau von Havel und Spree (II):<br />
Ist der vollständige Neubau der Freybrücke wirklich alternativlos<br />
und lässt sich ein Verkehrschaos vermeiden?<br />
konstruktiven bzw. gestalterischen<br />
Besonderheiten wurde die Brücke unter<br />
Denkmalschutz gestellt?<br />
Antwort zu 3: Die Freybrücke steht seit<br />
dem 28. September 1995 unter Denkmalschutz.<br />
Die historische und städtebauliche<br />
Bedeutung der Brücke liegt in<br />
ihrer Zugehörigkeit zur Heerstraße als<br />
einer der meistbedeutenden Straßenzüge<br />
<strong>Berlin</strong>s sowie in ihrer Wirkung in der<br />
Havel-Havellandschaft. Die künstlerische<br />
Bedeutung liegt in der erhaltenen<br />
Gesamtform und der technischen und<br />
künstlerischen Einzeldurchbildung (z. B.<br />
Geländer).<br />
Frage 4: Wann und mit welchem Ergebnis<br />
wurde das Planfeststellungsverfahren<br />
zum Neubau der Freybrücke im Rahmen<br />
des „Verkehrsprojekts Deutsche<br />
Einheit Nr. 17“ (Ausbau der Wasserstraßenverbindung<br />
Hannover-Magdeburg-<br />
<strong>Berlin</strong>) abgeschlossen?<br />
Antwort zu 4: Der Planfeststellungsbeschluss<br />
wurde am 01.07.2010 erlassen.<br />
Die Ergebnisse sind im Planfeststellungsbeschluss<br />
umfangreich dokumentiert<br />
und festgeschrieben und in der weiteren<br />
Planung umgesetzt worden. Das<br />
Planfeststellungsverfahren zur Freybrükke<br />
war ein selbständiges Verfahren im<br />
Rahmen des „Verkehrsprojekts Deutsche<br />
Einheit Nr. 17“ (VDE).<br />
Frage 5: Welche Gründe führten zu der<br />
Entscheidung für einen Neubau der Freybrücke?<br />
Sind diese<br />
in den letzten Jahren<br />
erneut überprüft<br />
worden (z.B. aktuelle<br />
Messungen der<br />
tatsächlichen<br />
Durchfahrtshöhe)?<br />
Welche alternativen<br />
Möglichkeiten z.B.<br />
einer Sanierung der<br />
denkmalgeschützten<br />
Brücke wurden<br />
im Vorfeld geprüft<br />
bzw. wie hoch<br />
wären die Kosten<br />
hierfür?<br />
Antwort zu 5: Eine Studie aus dem Jahr<br />
1999, in der Instandsetzungs- und Neubauvarianten<br />
untersucht wurden, hat<br />
ergeben, dass bei dem Alter der Konstruktion<br />
weitere Materialschäden mit<br />
damit verbundenen unkalkulierbaren<br />
Kosten zu erwarten sind. Bei einer Erhaltung<br />
und Instandsetzung der vorhandenen<br />
Brücke ist deshalb mit Kosten in<br />
Größenordnung eines Ersatzneubaus zu<br />
rechnen, ohne dass das Bauwerk die<br />
Wertigkeit eines Neubaus erreicht. Der<br />
notwendige Ersatzneubau ermöglicht die<br />
Anhebung der Brücke im Rahmen des<br />
VDE Nr. 17.<br />
Frage 6: Ist ein Erhalt einzelner denkmalgeschützter<br />
Elemente der Brücke<br />
geplant und wenn ja, welcher und wenn<br />
nein, warum nicht?<br />
Antwort zu 6: Obwohl keine Forderung<br />
des Denkmalschutzes hinsichtlich des<br />
Erhaltes historischer Elemente vorlagt,<br />
wurde untersucht, einzelne Teile wie z.B.<br />
das Geländer in die Neubauplanung zu<br />
integrieren. Dies ist jedoch aufgrund der<br />
geltenden Sicherheitsanforderungen zu<br />
Leit- und Schutzeinrichtungen nicht realisierbar.<br />
Frage 7: Mit welchen Kosten für das<br />
gesamte Neubauvorhaben Freybrücke<br />
inkl. Behelfsbrücke rechnet der <strong>Berlin</strong>er<br />
Senat und welcher Anteil daran wird u.a.<br />
als Vorteilsausgleich zu Lasten des <strong>Berlin</strong>er<br />
Haushaltes gehen?<br />
Antwort zu 7: Das Neubauvorhaben wurde<br />
mit ca. 33 Mio. € Gesamtkosten veranschlagt.<br />
Der Anteil für <strong>Berlin</strong> beträgt<br />
ca. 5,4 Mio. €.<br />
Frage 8: Zu welchem Zeitpunkt rechnet<br />
der Senat mit dem Beginn der Arbeiten<br />
für den vorgesehenen Bau einer Behelfsbrücke<br />
und den Abriss bzw. Neubau der<br />
Freybrücke? Für welchen Zeitraum wird<br />
der Verkehrsfluss zwischen Spandau<br />
und der City über die Heerstraße insgesamt<br />
beeinträchtigt sein?<br />
Antwort zu 8: Voraussichtlich im IV. Quartal<br />
<strong>2012</strong> wird mit der Errichtung dieser<br />
Behelfsbrücke begonnen werden. Die<br />
Fertigstellung des Brückenneubaus ein-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 45<br />
schließlich Rückbau der Behelfsbrücke<br />
wird nach gegenwärtiger Planung 2015<br />
sein.<br />
Frage 9: In welchem Maße wird die Verkehrsleistung<br />
der Heerstraße voraussichtlich<br />
während der Arbeiten an der<br />
Behelfsbrücke bzw. der Freybrücke eingeschränkt<br />
sein und welche Beeinträchtigung<br />
für den ÖPNV bzw. den privaten<br />
Verkehr wird erwartet?<br />
Antwort zu 9: Um eine adäquate Verkehrsabwicklung<br />
während der Bauzeit<br />
sicherzustellen, wird eine Umfahrung<br />
nördlich der bestehenden Brücke eingerichtet.<br />
Diese Behelfsbrücke erhält insgesamt<br />
vier Fahrstreifen: zwei stadteinwärtsführende<br />
und zwei stadtauswärtsführende<br />
Fahrspuren wie die vorhandene<br />
Bestandsbrücke. Dennoch können kurzfristige<br />
Beeinträchtigungen des Verkehrs<br />
aus der Bautätigkeit nicht ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Frage 10: Welche Verlagerungen der Verkehrsströme<br />
der Heerstraße erwartet der<br />
Senat während der Abriss- bzw. Neubauphase?<br />
Antwort zu 10: Keine wesentlichen und<br />
planmäßigen Verlagerungen der Ver-<br />
kehrsströme, außer über die Behelfsumfahrung.<br />
Frage 11: Wie soll nach aktuellem Planungsstand<br />
die Verkehrsabwicklung<br />
während der Arbeiten an der Freybrück<br />
erfolgen?<br />
a) Wie viele Fahrspuren werden auf der<br />
Heerstraße für jede Fahrtrichtung zur<br />
Verfügung stehen und wird die Spurenanzahl<br />
je Richtung entsprechend dem<br />
Verkehrsaufkommen anpassbar sein?<br />
b) Über welche Verkehrswege soll eine<br />
Umfahrung der Freybrücke bzw. der<br />
Heerstraße erfolgen? Wie und wo werden<br />
die Autofahrer hierüber in den<br />
Medien und vor Ort informiert?<br />
c) Welche Maßnahmen planen der Senat<br />
bzw. die BVG, um auch für den Zeitraum<br />
der Bauarbeiten eine attraktive ÖPNV-<br />
Verbindung von Spandau in die Innenstadt<br />
zu gewährleisten?<br />
d) Welche Möglichkeiten zur Unterstützung<br />
eines leistungsfähigen ÖPNV-<br />
Angebotes bietet die Einrichtung einer<br />
Busfahrspur auf der Behelfsbrücke und<br />
ist eine solche geplant, bzw. wenn nein,<br />
warum nicht?<br />
Fachlich fit mit Beuth: Wir haben die passende Literatur!<br />
Ab 1. Juli gelten die Eurocodes<br />
Bauaufsichtliche Einführung – keine Übergangsfrist<br />
Kommentare Normen-Handbücher<br />
Praxisbücher<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Antwort zu 11:<br />
a) Auf der Behelfsbrücke stehen wie auf<br />
dem Bestandsbauwerk 2 Fahrspuren für<br />
jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Eine<br />
Anpassung der Spurenanzahl im Umfahrungs-/Brückenbereich<br />
ist nicht vorgesehen.<br />
b) Über die Behelfsumfahrung. Informationen<br />
erfolgen über die übliche Pressemitteilung<br />
vor Baubeginn.<br />
c) Es sind keine über den Bestand hinausgehenden<br />
Maßnahmen geplant.<br />
d) Die Behelfsbrücke ist ca. 143 m lang.<br />
Die Errichtung einer Busfahrspur würde<br />
für den restlichen Verkehr eine 50% Einschränkung<br />
bedeuten, darum wird diese<br />
- wie im Bestand - nicht veranlasst.<br />
<strong>Berlin</strong>, den 18. April <strong>2012</strong><br />
In Vertretung<br />
Christian Gaebler<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
und Umwelt<br />
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am<br />
20. April <strong>2012</strong>)<br />
Über<br />
50<br />
Fachtitel<br />
≤≥<br />
Umfassende Informationen zu allen Publikationen unter: www.beuth.de/eurocode
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 46<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Friedrich II, König von Preußen und das Bildungssystem<br />
Wir begehen in diesem Jahr den 300.<br />
Geburtstag von Friedrich II König von<br />
Preußen (24.1.1712 bis 17.8.1786).<br />
Schnell waren wir uns im <strong>Baukammer</strong>ausschuss<br />
Denkmalschutz einig, dass<br />
wir anlässlich dieses Jubiläums zu ausgewählten<br />
„Friedrich Themen“ im <strong>Baukammer</strong>heft<br />
veröffentlichen wollen.<br />
Es gehört zu den allgemein bekannten<br />
Verdiensten Friedrichs, dass er das preußische<br />
Bildungssystem reformiert und<br />
hunderte von Schulen hat bauen lassen.<br />
Die sich nun anschließende Recherche<br />
gab jedoch Anlass, seine Verdienste differenziert<br />
zu betrachten.<br />
Als einer der wichtigsten Förderer des<br />
Schulwesens in deutschen Landen verordnete<br />
am 28. Oktober 1717 der preußische<br />
König Friedrich Wilhelm – also<br />
Friedrichs Vater – das „Edikt zur allgemeinen<br />
Schulpflicht“. „Wir vernehmen<br />
missfällig und wird verschiedentlich von<br />
denen Inspectoren und Predigern bey<br />
Uns geklaget, dass die Eltern, absonderlich<br />
auf dem Lande, in Schickung ihrer<br />
Kinder zur Schule sich sehr säumig erzeigen,<br />
und dadurch die arme Jugend in<br />
grosse Unwissenheit, so wohl was das<br />
lesen, schreiben und rechnen betrifft, als<br />
auch in denen zu ihrem Heyl und Seligkeit<br />
dienenden höchstnötigen Stücken auffwachsen<br />
laßen.“[A]<br />
46 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Dipl.-Ing. Sven Cordewinus<br />
Zu dieser Zeit (1717) gab es in Preußen<br />
nur 320 Dorfschulen. Am Ende der<br />
Regierungszeit König Friedrich Wilhelms<br />
im Jahr 1740 war die Anzahl der Schulen<br />
bereits auf 1480 angestiegen [A]. Es ist<br />
nicht davon auszugehen, dass es sich<br />
tatsächlich um mehr als 1000 Schulneubauten<br />
handelte. Obwohl der König das<br />
Baumaterial kostenlos zur Verfügung<br />
stellte, wurden im überwiegenden Teil<br />
der Landgemeinden vorhandene Räumlichkeiten<br />
für den Schulbetrieb genutzt.<br />
Eine effiziente und ordnungsgemäße<br />
Verwaltung, Steuererhebung und Militärorganisation<br />
ist nur möglich, wenn alle<br />
Beteiligten (Bürger, Bauern und Verwaltung)<br />
lesen und schreiben können. Daher<br />
sollte jedes Kind (nicht nur Jungen sondern<br />
auch Mädchen) am Ende der Schulzeit<br />
lesen und schreiben sowie den Katechismus<br />
auswendig können. (Katechismus:<br />
Handbuch zur Unterweisung in<br />
christlichen Fragen)<br />
Zu seinem Regierungsantritt 1740 konnte<br />
Friedrich II daran anknüpfen und die<br />
Bemühungen seines Vaters fortsetzen.<br />
In einem Edikt vom 13.10.1740 erließ er:<br />
„…wie in Preußen verschiedene Leute<br />
sich in dem Sinn kommen ließen, als ob<br />
es nunmehr bei dem Kirchen-, Universitäts-<br />
und Schulwesen wieder auf den<br />
alten unordentlichen Fuß komme - alle<br />
Abb 1 „Preußischer Schulmeister“ Johann Peter Hasenclever, Öl, 1846 [A]<br />
von seines in Gott ruhenden Herrn Vaters<br />
Majestät in Schulsachen erlassenen<br />
Befehle und Reglements, daß selbige in<br />
der völligen Kraft, Autorität und Verbindlichkeit<br />
sein und bleiben sollten.“ (1) S.<br />
10.<br />
In diesem Sinne ermahnte der König am<br />
29.10.1741 seine Adligen und erinnerte<br />
sie an die „Pflicht … sich der Schulen in<br />
ihren Dörfern mit Eifer anzunehmen“ Er<br />
befahl „… daß in der Zeit von einem halben<br />
Jahr die nötigen Schulen in den adligen<br />
Dörfern gebaut sein sollten“. (1) S.9<br />
Er ordnete strenge Kontrollen durch seine<br />
Amtshauptleute an, die entsprechende<br />
Nachweise zu fordern hatten. Es half<br />
nichts. Der Befehl wurde bis auf wenige<br />
Ausnahmen einfach ignoriert. Die Schlesischen<br />
Kriege (1740 - 42, 1744/45)<br />
erforderten andere Prioritäten.<br />
Die eingerichteten Schulen waren – wir<br />
würden heute sagen – „chronisch unterfinanziert“.<br />
Für den Betrieb der Schulen<br />
waren auf den Adelsgütern die Adligen<br />
und nur auf den landeseigenen Domänengütern<br />
der Staat verantwortlich.<br />
Die Bezahlung der Schuldiener (Lehrer)<br />
war schlecht und reichte nicht zum Überleben.<br />
Die Ausübung von Nebenerwerben<br />
war überlebensnotwendig und<br />
üblich. Die Schulmeister waren oftmals<br />
gleichzeitig Küster, Schneider und/oder<br />
sie züchteten Seidenraupen oder Ziegen<br />
(im Volksmund die „Beamtenkuh“). Die<br />
Unterkunft erfolgte meistens im Schulhaus<br />
– oft in Kombination als Schul- und<br />
Bethaus mit kleinem angegliedertem<br />
Stall. Das Gemälde des Johann Peter<br />
Haase von 1846 zeigt im Stil der Romantik<br />
wie man sich den Schulbetrieb im 18.<br />
Jahrhundert vorstellen muss.<br />
Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges<br />
(1756 – 63) widmete sich Friedrich<br />
wieder dem Schulsystem. Während des<br />
Krieges bemerkte er, dass die „sächsischen<br />
Bauern meißt gebildeter und<br />
gewandter wären als die brandenburgischen“<br />
(2) S. 497 und schrieb dies dem<br />
besseren Unterricht zu.<br />
In der Einleitung des General=Landschul=Reglement<br />
vom 12.8.1763 stellte<br />
Friedrich fest „Demnach Wir zu Unserem<br />
höchsten Missfallen selbst wahrgenommen,<br />
daß das Schulwesen und die Erziehung<br />
der Jugend auf dem Lande bisher in
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 47<br />
äußersten Verfall geraten und Insonderheit<br />
durch die Unerfahrenheit der mehresten<br />
Küster und Schulmeister die jungen<br />
Leute auf den Dörfern in Unwissenheit<br />
und Dummheit aufwachsen: so ist es<br />
unser so wohlbedachter als ernster Wille,<br />
daß das Schulwesen auf dem Lande in<br />
allen unseren Provinzen auf einen besseren<br />
Fuß als bishero gesetzet und verfasset<br />
werden soll…“ (1) S. 113<br />
Der allgemeine schlechte Bildungsstand<br />
der Schulmeister wurde zwar durch ihn in<br />
vielen seiner Schriften beklagt, gleichzeitig<br />
ist jedoch festzuhalten, dass auf<br />
Betreiben Friedrichs auch aus Kostengründen<br />
viele der Schulmeisterstellen<br />
mit ehemaligen meist invaliden Soldaten<br />
besetzt wurden. Für gut gebildete Schulmeister<br />
(Lehrer) bzw. deren Ausbildung<br />
stand nur sehr wenig Geld zur Verfügung.<br />
Auch wollte er es mit der Bildung natürlich<br />
nicht übertreiben. In einem Kabinettschreiben<br />
an den Etatsminister von<br />
Zedlitz vom 5.9.1779 formulierte er: „es<br />
ist auf dem platten Land genug, wen sie<br />
ein bisgen lesen und schreiben lernen,<br />
wissen sie aber zu viel, so laufen sie in die<br />
Städte und wollen Secretairs oder so was<br />
werden; deshalb muß man auf’m platten<br />
Lande den Unterricht so einrichten, dass<br />
sie das Nothwendige, was zu ihrem Wissen<br />
nöthig ist lernen, aber auch in der Art,<br />
dass die Leute nicht aus den Dörfern<br />
weglaufen, sondern hübsch da bleiben.“<br />
(1) S.170<br />
Uns mag heute verwundern, dass es keine<br />
konkreten Bauvorschriften für Schulgebäude<br />
gab. In einer Art Durchführungsverordnung<br />
zum General=Landschul=Reglement<br />
für die katholischen<br />
Länder fordert er „...bei der Erbauung<br />
neuer Schulhäuser soll darauf gehalten<br />
werden, daß für den Unterricht eine<br />
abgesonderte, lichte und nach der Zahl<br />
der Kinder proportionierte Schulstube<br />
vorhanden ist“ (1) S. 19.<br />
Die Realität wird wohl anders ausgesehen<br />
haben. Von den Neubauten abgesehen<br />
wurde der Schulbetrieb zu großen<br />
Teilen in vorhandenen Baulichkeiten<br />
abgehalten. Vom Grauen Kloster in <strong>Berlin</strong><br />
(eine der ältesten höheren Schulen <strong>Berlin</strong>s)<br />
ist aus dieser Zeit eine Eingabe des<br />
Direktors Büsching an den König zum<br />
Zustand der Schulräume überliefert. „Die<br />
Klassen des Gymnasiums zum grauen<br />
Kloster liegen fast sieben Fuß tief in der<br />
Erde, sind wahre Keller, dunkel und<br />
Abb 3 Schulgebäude Reckahn 1773, Foto: eigenes Archiv<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Abb 2 Schul- und Bethaus Wuschewier, Foto: Ziggybln-wikilo-vesmonuments, Wikipedia<br />
wegen des vielen Selphes für die Lehrer<br />
und Schüler höchst ungesund“ (1) S. 32<br />
Auch bei den wenigen Schulneubauten<br />
auf dem Lande hat sich an der Gestaltung<br />
und Einrichtung der Gebäude kaum<br />
etwas gegenüber der Amtszeit seines<br />
Vaters geändert. Sie waren meist einfache<br />
eingeschossige Fachwerkhäuser mit<br />
Lehmausfachung und Rieddächern und<br />
bestanden üblicherweise aus einem<br />
Schul- und Betsaal, einer Lehrerwohnung<br />
und dazugehörige Stallungen für<br />
Kleintiere und Bevorratung.<br />
Errichtet wurden sie bei den in Brandenburg<br />
vorherrschenden Angerdörfern in<br />
der Regel auf dem Anger – also dem<br />
gemeindeeigenem Zentrum des Dorfes -<br />
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche.<br />
Nur selten wurden Steinhäuser<br />
errichtet.<br />
Im Oderbruch östlich von <strong>Berlin</strong> wo nach<br />
der Trockenlegung 1747 bis 1763 eine<br />
Vielzahl von Gebäuden errichtet wurden<br />
gibt es in Wuschewier ein Schul- und<br />
Bethaus von 1764 welches im ursprünglichen<br />
Zustand erhalten geblieben ist.<br />
(siehe Abb. 2) Das Gebäude kann nach<br />
Voranmeldung beim Evangelischen<br />
Pfarramt Neutrebbin, Hauptstr. 77, Telefon:<br />
(033474) 3 05 für Gruppen besucht<br />
werden.<br />
Friedrich erkannte also schon frühzeitig<br />
die Notwendigkeit eines guten Bildungssystems.<br />
Es mangelte auch nicht an<br />
guten Vorsätzen und Einsichten. Leider<br />
fehlte ihm das nötige Geld seine guten<br />
Vorsätze gegen den häufigen Widerstand<br />
der adligen Grundbesitzer durchzusetzen.<br />
Es gab aber auch Grundbesit-<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 47
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 48<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
zer, die auf eigene Kosten in ihren Dörfern<br />
Schulen bauten und betrieben. So<br />
z.B. in Reckahn (südlich von Brandenburg/Havel).<br />
Hier errichtete 1773 Friedrich<br />
Ebert von Rochow für 900 Taler eine<br />
Schule und stattete diese mit einem<br />
„ausgebildeten, tüchtigen Lehrer“ (3)<br />
aus. In dem noch heute existierenden<br />
Gebäude befindet sich heute ein Schulmuseum,<br />
welche eine vollständige<br />
Schuleinrichtung um 1900 sowie viele<br />
interessante Bücher und Objekte zeigt.<br />
(Tel. 033835/ 608870, schulmuseum@tonline.de)<br />
Rückblickend bemerkte Friedrich am<br />
9.10.1772: „Je älter man wird, desto<br />
mehr wird man inne, wie sehr die Ver-<br />
Noch stehen sie und beleuchten Nacht<br />
für Nacht weite Teile des <strong>Berlin</strong>er Stadtgebietes<br />
mit ihrem klaren und natürlichen<br />
Licht: Die ca. 43.500 gasbetriebenen<br />
Straßenlaternen in ihren vier charakteristischen<br />
Grundtypen und zahlreichen<br />
Sonderformen, welche authentisch die<br />
Industrie- und Stilgeschichte vom ausgehenden<br />
19. Jahrhundert über die Neue<br />
Sachlichkeit bis zur Nachkriegsmoderne<br />
verkörpern. Ihre vollständige Beseitigung<br />
ist indes beschlossene Sache. Ab Juni<br />
<strong>2012</strong> soll ungeachtet der Proteste namhafter<br />
Kultur- und Denkmalschutzorganisationen<br />
und vieler Bürgerinnen und Bürger<br />
der systematische flächendeckende<br />
Abbau starten, beginnend mit der Anfang<br />
der 1950er Jahre in <strong>Berlin</strong> entwickelten<br />
sogen. Gas-Reihenleuchte.<br />
Im Februar <strong>2012</strong> hatte sich die europäische<br />
Kulturorganisation Europa Nostra in<br />
einem Schreiben an den Regierenden<br />
Bürgermeister von <strong>Berlin</strong>, Klaus Wowereit,<br />
gewandt und unter Verweis auf die<br />
herausragende historische Bedeutung<br />
der Gas-Straßenbeleuchtung ein Abbau-<br />
Moratorium und eine öffentliche Diskussion<br />
unter Einbeziehung von Kulturfachleuten<br />
gefordert. Gerade hinsichtlich der<br />
zunächst betroffenen Gas-Reihenleuchte<br />
weist Europa Nostra darauf hin, dass<br />
dieser Leuchtentyp allein durch die Tatsache,<br />
dass noch in der Zeit nach 1945<br />
eine Neuentwicklung gasbetriebener<br />
Straßenbeleuchtung erfolgte, historisch<br />
signifikant und daher schützenswert sei.<br />
In seiner Antwort, delegiert an Stadtent-<br />
48 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
nachlässigung der Jugenderziehung der<br />
bürgerlichen Gesellschaft schadet. Ich<br />
tue alles Mögliche, um diesem Übel<br />
abzuhelfen. Ich reformiere die Gymnasien,<br />
die Universitäten und selbst die<br />
Dorfschulen. Über 30 Jahre gehören<br />
dazu um Früchte zu sehen. Ich werde sie<br />
nicht genießen, aber ich werde mich darüber<br />
trösten in dem ich meinem Lande<br />
diesen bisher mangelnden Vorzug verschaffe.“<br />
(1) S.4<br />
So blieb noch fast 100 Jahre alles beim<br />
Alten. Erst nach der Reichsgründung<br />
1871 setzte mit dem Geld des gewonnenen<br />
Deutsch-Französischen Krieges und<br />
des darauf folgenden wirtschaftlichen<br />
Aufschwungs in Deutschland ein einzig-<br />
<strong>Berlin</strong>s unbequemes Denkmal:<br />
Der Abbau der Gasbeleuchtung beginnt.<br />
Dipl.-Ing. Bertold Kujath<br />
Typisch <strong>Berlin</strong>:<br />
Die Gas-Reihenleuchte, einer der vier<br />
<strong>Berlin</strong>er Grundtypen der Gasbeleuchtung,<br />
hier mit neun Glühkörpern<br />
wicklungssenator Michael Müller, sagte<br />
dieser die Erhaltung öffentlicher Gasbeleuchtung”<br />
in einer Auswahl hochkarätiger<br />
Denkmalbereiche als Teil der historischen<br />
Ausstattung des Stadtbildes” zu,<br />
wobei alle in <strong>Berlin</strong> eingesetzten Leuchtentypen<br />
berücksichtigt würden.<br />
Zwar wurde dem Landesdenkmalamt<br />
tatsächlich zugestanden, gemeinsam mit<br />
Vertretern des Fördervereins Gaslicht-<br />
Kultur eine Schutzliste zunächst für die<br />
unmittelbar betroffenen Gas-Reihenleuchten<br />
zu erarbeiten. Allerdings gab es<br />
derart restriktive zahlenmäßige Auflagen,<br />
dass eine angemessene Berücksichtigung<br />
denkmalsrelevanter Sachverhalte<br />
nicht möglich war. Selbst diese unter<br />
Auflagen entstandene Schutzliste wurde<br />
von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
nochmals um die Hälfte reduziert.<br />
Damit sind auch die Möglichkeiten<br />
artiges Schulbauprogramm ein, dessen<br />
Ergebnis noch heute unsere Schulgebäudelandschaft<br />
prägt.<br />
Quellen:<br />
(1) Dr. Meyer, Jürgen Bona (Herausgeber):<br />
„Friedrich des Großen Pädagogische<br />
Schriften und Äußerungen…,“ Hermann<br />
Beyer und Söhne, Langensalza 1885<br />
(2) Chauber, Theobald: „Friedrich der Grosse“,<br />
Scheibles Buchhandlung, Stuttgart<br />
1834<br />
(3) M. Alert, O.-G. Beckmann, „Museumsführer<br />
Reckahn“ Schmidt-Römhild Verlagsgesellschaft<br />
mbH Brandenburg (o.J.)<br />
Internetquellen:<br />
[A] http://www.preussen-chronik.de<br />
für spätere Schutzlisten der übrigen Gasleuchtentypen<br />
von vornherein begrenzt,<br />
da es um den Erhalt zusammenhängender<br />
Beleuchtungsensembles geht. Von<br />
stadtbildprägender Wirkung der Gasbeleuchtung<br />
bliebe auf diese Weise nichts<br />
mehr übrig.<br />
Das von den Kulturverbänden geforderte<br />
Moratorium gibt es nicht. Im Gegenteil:<br />
Auf einer Pressekonferenz am 14.5.<strong>2012</strong><br />
stellte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
konkrete Straßenlisten mit<br />
den Zeiträumen für den Gasleuchtenabbau<br />
vor. Danach soll ausgerechnet in<br />
Straßen mit der höchsten Priorität aus<br />
der ursprünglichen Schutzliste des Landesdenkmalsamtes<br />
begonnen werden,<br />
etwa am Haselhorster Damm, der kom-<br />
Neue Elektrolaterne (links) mit deutlich<br />
anderer Lichtfarbe als die Gaslaterne<br />
(rechts)
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 49<br />
Lebendige Geschichte:<br />
erstes Reihenleuchtenmodell noch mit<br />
Leitereisen vor historischem Gasbehälter<br />
Fotos:<br />
Bertold Kujath – Gaslicht-Kultur e.V.<br />
plett durch ein denkmalgeschütztes<br />
Siedlungsensemble verläuft. Und mit der<br />
Windscheidt- und Holtzendorffstraße<br />
wurden in zwei Straßen, die Bestandteil<br />
der bei in- und ausländischen Touristen<br />
sehr gefragten Gaslichttour des Vereins<br />
Gaslicht-Kultur sind, die Abrissarbeiten<br />
sogar noch um ein Jahr vorverlegt. Kultur-<br />
und Bürgervereine waren zu dieser<br />
Pressekonferenz übrigens nicht zugelassen.<br />
Um endlich den Gasbeleuchtungsabbau<br />
mit einer breiten Öffentlichkeit zu diskutieren,<br />
veranstalteten die Deutsche Stiftung<br />
Denkmalschutz und der Denkmalpflegeverein<br />
Denkmal an <strong>Berlin</strong> am<br />
21.05.<strong>2012</strong> eine Podiumsdiskussion, an<br />
der jeweils ein Vertreter der Senatsverwaltung<br />
für Stadtentwicklung, des Landesdenkmalamts<br />
<strong>Berlin</strong>, des Landesdenkmalrats<br />
<strong>Berlin</strong>, des Bürgervereins<br />
Frohnau und des Vereins Gaslicht-Kultur<br />
beteiligt waren. Hier wurde deutlich, dass<br />
im Regelfall weißes Licht aus Leuchtstoffröhren<br />
das traditionelle Gaslicht<br />
ersetzen soll. Denn die vielgerühmte LED<br />
Technologie wird aus Kostengründen nur<br />
in Einzelfällen eingesetzt. Hinsichtlich<br />
der ökologischen Begründung des Gasleuchten-Abbaus<br />
forderte der Vertreter<br />
des Landesdenkmalrates Nikolaus Bernau<br />
eine ökologische Gesamtbilanz, in<br />
die Ressourcenverbrauch und Emission<br />
von Neuproduktion und Baustellenverkehr<br />
ebenso einzubeziehen seien wie die<br />
Auswirkungen der weiteren Zunahme<br />
elektrischen Lichts. Was die Kostenberechnungen<br />
betrifft, so ist das Einsparpotenzial<br />
durch die Elektrifizierung ebenso<br />
wie ihre Amortisation strittig. Dass die<br />
Ersatzteilversorgung für Gasleuchten<br />
schwierig sei, wie behauptet, entbehrt<br />
jeder Grundlage. Die zurzeit laufende<br />
vollständige Rekonstruktion der historischen<br />
Gasbeleuchtung in der Prager<br />
Innenstadt erfolgt mit Bauteilen und<br />
technischem Knowhow einer Firma aus<br />
<strong>Berlin</strong>. Lediglich die Glühkörper müssen<br />
derzeit importiert werden, wobei eine<br />
solche Produktion durchaus auch wieder<br />
in <strong>Berlin</strong> angesiedelt werden kann - den<br />
entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt.<br />
Eine Produktion spezieller<br />
Bauteile nur für den Bedarf des Denkmalbereichs<br />
zu betreiben, sei durchaus<br />
üblich, so Nikolaus Bernau vom Landesdenkmalrat.<br />
Noch besitzt <strong>Berlin</strong> mit seiner Gas-Straßenbeleuchtung<br />
einen Schatz mit Potential<br />
zum Welterbe, den es hüten sollte<br />
und für dessen Weiterentwicklung, so<br />
Elisabeth Ziemer, stellvertretende Vorsitzende<br />
von Denkmal an <strong>Berlin</strong> e.V., auch<br />
Barbaren haben immer die Sachlogik auf<br />
ihrer Seite. Der <strong>Berlin</strong>er Senat hat<br />
beschlossen, die überkommenen Gaslaternen<br />
der Stadt sukzessive durch elektrische<br />
Lampen zu ersetzen – weil ihre<br />
Wartung weniger koste, weil auch Strom<br />
billiger sei als Gas, weil schließlich die<br />
Energieausbeute und also die Ökobilanz<br />
besser seien. Das Geld und die Umwelt,<br />
das sind die harten Argumente für die<br />
Politiker unserer Tage; mit Ästhetik, Tradition<br />
oder gar sentimentalen Werten<br />
kann man ihnen nicht kommen.<br />
Das sanfte Gaslicht, das sich in der Dämmerung<br />
mit feinem Sirren einschaltet und<br />
im Betrieb von jenem leisen Zischen<br />
begleitet wird, das in der Literatur des 19.<br />
Jahrhunderts so oft beschrieben wurde,<br />
ist der letzte Ausweis der untergegangenen<br />
Metropolenkultur Europas. Muss<br />
man <strong>Berlin</strong>er sein, um sein Verschwinden<br />
als Schaden für das Stadtbild, als Heimatverlust,<br />
als letzte brutale Modernisierung<br />
im Geiste einer technokratischen<br />
Zukunft zu empfinden? Schneeflocken,<br />
wenn sie im Gaslicht tanzen, verwandeln<br />
sich in goldenen Sternenstaub, Regentropfen<br />
bekommen einen Kometenschweif.<br />
Und die banalen Fassaden,<br />
denen Krieg und Nachkrieg den<br />
Schmuck geraubt haben, gewinnen noch<br />
einmal die Illusion von Pilastern, steiner-<br />
Lebendiges Licht<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
zu forschen lohne. Und dabei geht es<br />
nicht nur um einzigartige Laternen. Die<br />
Gas-Straßenbeleuchtung ist Bestandteil<br />
eines industrie-historischen Erbes, das<br />
bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht und<br />
aus dessen Frühzeit, als <strong>Berlin</strong> eines der<br />
Zentren der europäischen Gasversorgungsindustrie<br />
war, noch weitere gasindustrielle<br />
Einrichtungen wie Gasbehälter<br />
und Verwaltungsgebäude existieren. Die<br />
Vereine Denk-mal-an-<strong>Berlin</strong> und Gaslicht-Kultur<br />
haben deshalb eine Online-<br />
Petition gestartet, die von allen namhaften<br />
Kulturorganisationen wie Europa<br />
Nostra, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz<br />
oder auch der <strong>Baukammer</strong><br />
<strong>Berlin</strong> unterstützt wird. Die Petition richtet<br />
sich gegen den geplanten nahezu<br />
vollständigen Abriss der <strong>Berlin</strong>er Gas-<br />
Straßenbeleuchtung und kann unter<br />
www.Gaslicht-ist-<strong>Berlin</strong>.de unterzeichnet<br />
werden.<br />
Der <strong>Berlin</strong>er Senat will die Gaslaternen abbauen.<br />
Jens Jessen<br />
Foto: Traichel<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 49
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 50<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
nen Girlanden und Karyatiden. Als Kind<br />
konnte man sich den Spaß machen, mit<br />
dem Fuß gegen den Laternenmast zu<br />
treten; die Erschütterung löschte die<br />
Flamme. Es war etwas Verletzliches und<br />
Lebendiges um das Gaslicht, das dem<br />
nächtlichen Flaneur das Gefühl gab, er<br />
sei nicht allein.<br />
Das Barbarische an dem Technokratenbeschluss<br />
besteht in der Meinung, es<br />
gehe im Leben um Funktionalität allein.<br />
Im öffentlichen wie im privaten Leben<br />
geht es aber nicht darum, dass alles so<br />
perfekt und billig, so wartungsarm und<br />
schadstofffrei wie möglich funktioniert.<br />
Ein solches Leben ist kein menschliches<br />
Leben. Der Mensch selbst ist nicht per-<br />
• Herr Traichel, die <strong>Berlin</strong>er<br />
<strong>Baukammer</strong> ist gegen Pläne<br />
des Senats, die historischen<br />
Gaslaternen in der<br />
Hauptstadt abzureißen und<br />
durch Elektroleuchten zu<br />
ersetzen. Damit befindet sie<br />
sich in guter Gesellschaft<br />
mit Vereinen wie »Pro Gaslicht«<br />
und »Denk mal an<br />
<strong>Berlin</strong>«. Wird <strong>Berlin</strong> bei so<br />
viel Expertenschelte ein<br />
Licht aufgehen?<br />
Die <strong>Baukammer</strong> steht den Plänen des<br />
<strong>Berlin</strong>er Senats, die rund 44 000 Gaslaternen<br />
abzuschaffen, durchaus kritisch<br />
gegenüber. Wir halten diese Beleuchtung<br />
für einzigartig. Dass der Senat auf die Kritik<br />
nicht eingeht, mag daran liegen, dass<br />
ihm Argumente fehlen, den Abriss der<br />
Gasleuchten begründen zu können.<br />
• Weshalb sollten diese Straßenlaternen<br />
erhalten bleiben?<br />
Diese Fülle von verschiedenartigen Gasleuchten<br />
ist ein kulturelles Erbe der<br />
Stadt. Sie sind einzigartig in Deutschland<br />
und, so viel ich weiß, sogar in Europa.<br />
50 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Gaslicht aus in <strong>Berlin</strong>?<br />
Dr. Peter Traichel<br />
fekt, nicht billig, nicht wartungsarm und<br />
auch nicht schadstofffrei – und seine<br />
Stadt muss es auch nicht sein. Die Stadt<br />
muss ihm Heimat geben, und dazu<br />
gehört, dass sie nicht tüchtiger auftritt als<br />
er selbst. Sie soll ihn nicht übertrumpfen.<br />
Und wenn der Zufall es will, dass eine<br />
untüchtige Technik von gestern noch existiert,<br />
die dem Menschen schmeichelt,<br />
anstatt ihn zu demütigen, dann muss dieser<br />
Zufall als historischer Glücksfall<br />
erhalten werden. Sollen doch die Politiker<br />
an ihrer eigenen Wartungsarmut und<br />
Schadstofffreiheit arbeiten – aber ihre<br />
Technokratenfinger von unserem guten,<br />
alten, untüchtigen <strong>Berlin</strong> lassen!<br />
Obendrein erlangten sie vor<br />
kurzem eine neue Aktualität.<br />
Bis zur Umweltkatastrophe<br />
in Fukushima ging<br />
man ja davon aus, dass<br />
Strom immer und mehr<br />
oder weniger preiswert zu<br />
haben ist. Das hat sich mit<br />
Fukushima schlagartig<br />
geändert.<br />
Jetzt gibt es eine ganz neue<br />
Sichtweise. Ich glaube<br />
nicht, dass der Senat diese<br />
Sichtweise in seine Überlegungen einbezogen<br />
hat.<br />
Vielleicht will er sie auch nicht einbeziehen.<br />
Wir wollen vorbildlich sein, gehen<br />
weg vom Atomstrom, gehen weg vom<br />
Braunkohlestrom. Damit sind wir zwingend<br />
auf alternative Energien angewiesen.<br />
Für mich ist es unbegreiflich, nun<br />
den funktionierenden, mit dem Naturprodukt<br />
Gas betriebenen Laternenbestand<br />
abzureißen.<br />
• Die Stadt verweist auf enorme Einsparungen<br />
nach Umstellung auf Elektrifizierung.<br />
Ist das kein Argument?<br />
Ich kann nicht erkennen, wie sich diese<br />
Einsparungen errechnen. Die Umrüstung<br />
von Gas auf Strom soll rund 170 Millionen<br />
Euro kosten. Es gibt Berechnungen<br />
aus Düsseldorf und Frankfurt am Main,<br />
wonach beim Abriss 11 000 Euro Kosten<br />
pro Gaslaterne entstehen. <strong>Berlin</strong> geht<br />
meines Wissens von 3 000 bis 4 000 Euro<br />
aus. Das halte ich für sehr untersetzt.<br />
Obendrein müssten 2 750 Straßen in<br />
<strong>Berlin</strong> aufgerissen und neu verkabelt<br />
werden. In die alten Kandelaber können<br />
nicht einfach neue Leitungen gelegt werden.<br />
• Sie warnen als <strong>Baukammer</strong> davor, diese<br />
Gaslaternen als weltweit einmaliges<br />
kulturelles Erbe auf Spiel zu setzen. Es<br />
soll sogar geprüft werden, ob die historischen<br />
Leuchten ins UNESCO-Weltkulturerbe<br />
aufgenommen werden.<br />
Vor etwa zweieinhalb Jahren versuchte<br />
man in Düsseldorf einen Antrag zu stellen,<br />
die dortige Gasbeleuchtung als Weltkulturerbe<br />
zu klassifizieren. Dieser<br />
Antrag ist aber wohl in der Düsseldorfer<br />
Verwaltung versandet und nie weiter<br />
behandelt worden. Wir in <strong>Berlin</strong> sind mit<br />
diesem Thema ebenso vertraut wie die<br />
Stiftung Denkmalschutz. Es wird wohl in<br />
dieser Richtung daran gearbeitet.<br />
• Das dauert aber?<br />
Dass sich da kurzfristig etwas tut,<br />
bezweifle ich. Den ersten Schritt sollten<br />
aber wir in <strong>Berlin</strong> tun. Wir reden hier<br />
immer nur von den Kosten und gehen nie<br />
auf das kulturelle Erbe ein, das die Stadt<br />
übernommen hat. Seit 1826 gibt es in<br />
<strong>Berlin</strong> Gaslaternen, und die Stadt hat<br />
auch eine Verantwortung, diesen touristischen<br />
Magneten zu bewahren. Hier ist<br />
auch das Engagement des <strong>Berlin</strong>er Landesdenkmalamtes<br />
gefragt.<br />
Quelle:<br />
Neues Deutschland vom 13. April <strong>2012</strong>,<br />
Fragen: Andreas Heinz
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 51<br />
<strong>Berlin</strong>er Gaslaternenberechnung am Beispiel einer Gas-Reihenleuchte<br />
Stand: 16.05.<strong>2012</strong> – Verbrauchsvergleich<br />
Jahres-Verbrauch eines kWh/a CO2 in kg/a<br />
Einfamilienhauses, 100qm, schlecht gedämmt, 300kWh/qm/a<br />
Mehrfamilienhaus, 100qm, Altbau,<br />
30.000 7.410<br />
<strong>Berlin</strong>er Standard, energetisch unsaniert, 250kWh/qm/a 25.000 6.175<br />
Großwagen (SUV), Diesel, 15.000 km/a, 10 Liter/100km, 1.500 Liter/a<br />
Reihenmittelhaus, 100qm,<br />
17.700 4.372<br />
ungedämmter Durchschnitt in <strong>Berlin</strong>, neue Heizung, 160kWh/qm/a 16.000 3.952<br />
Einfamilienhaus, 100qm, nach EnEV, 100kWh/qm/a 10.000 2.470<br />
Kleinwagen, Benzin, 15.000 km/a, 6 Liter/100km, 900 Liter/a 9.990 2.468<br />
KfW-55-Haus, 100qm, 55kWh/qm/a 5.500 1.359<br />
Passivhaus, 100qm, 40kWh/qm/a 4.000 2.732<br />
Gas-Reihenleuchte <strong>Berlin</strong> (1400W Nennleistung) 6.745 1.666<br />
Elektro-Straßenleuchte (Standard, 130W Nennleistung) 1.480 1.011<br />
Elektro-Straßenleuchte (LED, 73W Nennleistung) 831 568<br />
Prinzipiell bewegt sich der Jahresverbrauch<br />
einer einzelnen Gasleuchte in der<br />
Größenordnung des Gesamtverbrauches<br />
eines freistehenden 100qm Einfamilienhauses<br />
nach KfW 55-Standard,<br />
sogar gut 10-20% darüber.<br />
Frage bei allem Erhaltungswillen sei an<br />
dieser Stelle, ob wirklich das Gaslicht<br />
Leserzuschrift<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
bezüglich unserer schönen Gaslaternen habe ich allem Erhaltungswillen zum Trotz eine<br />
Ökobilanz aufgestellt, wonach leider diese historische Beleuchtung nicht so gut<br />
abschneidet.<br />
Mit dem Rundschreiben VI D Nr. 39 /<br />
2011 vom 21. März 2011 sind bereits<br />
Informationen zur bauaufsichtlichen Einführung<br />
der Eurocodes gegeben worden.<br />
Seit dem 1. Quartal 2011 können die<br />
Eurocodes im Vorgriff auf die bauaufsichtliche<br />
Einführung im Sinne einer<br />
gleichwertigen Lösung gemäß § 3 Abs. 3<br />
BauO Bln abweichend von den bisher<br />
geltenden Technischen Baubestimmungen<br />
für die Planung, Bemessung und<br />
Ausführung von baulichen Anlagen<br />
angewendet werden.<br />
Mit der Neuausgabe der Ausführungs-<br />
das entscheidende erhaltenswerte Kriterium<br />
sei, oder ob vielmehr die Laterne für<br />
sich im Stadtbild geschützt werden sollte.<br />
Das Licht ließe sich sicherlich an moderne<br />
Technik formen und anpassen, die<br />
Laternentypen sind meiner Ansicht nach<br />
schützungsbedürftiger, weil diese für<br />
vorschriften Liste der Technischen Baubestimmungen<br />
(AV LTB), die am 1. Juli<br />
<strong>2012</strong> in Kraft tritt und mit der die Muster-<br />
Liste der Technischen Baubestimmungen<br />
- Fassung Dezember 2011 umgesetzt<br />
wird, werden die bisher bekannt<br />
gemachten „alten“ deutschen Planungs-<br />
, Bemessungs- und Ausführungsnormen<br />
durch die europäischen Normen – Eurocodes<br />
– ersetzt. Aufgrund des Beschlusses<br />
der zuständigen Fachkommission<br />
Bautechnik der Bauministerkonferenz<br />
werden - wie auch in den anderen Bundesländern<br />
- keine Übergangsfristen<br />
festgelegt.<br />
Denkmalschutz und -pflege / Recht<br />
sich einen historischen “Einrichtungsgegenstand”<br />
im Stadtbild darstellen und<br />
schwer durch moderne Formen ersetzbar<br />
wären.<br />
Folgende Aspekte sind aber auch zu<br />
berücksichtigen:<br />
Eine technische Umrüstung bestehender<br />
Gaslaternen auf Strom ist zwar generell<br />
nicht undenkbar, aber: – Der Charme<br />
des Stadtbildes geht durch nicht<br />
gewachsene Technik bei einer vollständigen<br />
Leuchtenerneuerung unweigerlich<br />
verloren<br />
– Gewohnte und lieben gelernte<br />
Beleuchtungsverhältnisse gehen<br />
–<br />
nicht nur verloren, sondern verändern<br />
das gesamte Stadtbild, insbesondere<br />
in den historischen Stadtvierteln der<br />
Gründerzeit<br />
Lichtverschmutzung der Atmosphäre<br />
durch zu viel Licht bzw. Ausleuchtung<br />
von modernen Leuchten ist zu bedenken<br />
– Bedrohung der innerstädtischen<br />
–<br />
Insektenlebensräume<br />
Die Touristen <strong>Berlin</strong>s lieben das<br />
(unperfekte) Erscheinungsbild als ein<br />
Gesamtbild, wozu immer schon die<br />
Laternen beigetragen haben.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Dipl.-Ing. Peter-Henning Bigge<br />
Beratender Ingenieur<br />
Rundschreiben VI D Nr. 42/<strong>2012</strong> (Ergänzung zu Rundschreiben 39/2011)<br />
Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes –<br />
maßgebliche Zeitpunkte<br />
Im Verfahren nach § 63 BauO Bln ist der<br />
Zeitpunkt des Bauausführung maßgebend:<br />
Ab dem 1. Juli <strong>2012</strong> sind die<br />
bekannt gemachten Eurocode-Normteile<br />
anzuwenden.<br />
In den Verfahren nach §§ 64, 65 BauO<br />
Bln müssen die Konstruktionen zum<br />
Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung<br />
den geltenden Technischen<br />
Baubestimmungen entsprechen, d.h. ab<br />
dem 1. Juli <strong>2012</strong> den Eurocodes.<br />
Es bestehen aus Sicht der Obersten<br />
Bauaufsicht des Landes <strong>Berlin</strong> aber<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 51
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 52<br />
Recht<br />
genauso wenig Bedenken, wenn ab dem<br />
1. Juli <strong>2012</strong> bereits vor den oben genannten<br />
Terminen (für die Verfahren gemäß §§<br />
63 bis 65 BauO Bln) geplante und<br />
bemessene Konstruktionen nach den<br />
bisher bekannt gemachten „alten“ deutschen<br />
Normen ausgeführt werden. Eine<br />
Begründung oder ein „Nachweis" über<br />
die Art der Abweichung von Technischen<br />
Baubestimmungen oder über die Einhaltung<br />
des vorgegebenen Anforderungsniveaus<br />
ist nicht formalisiert, ebenso wenig<br />
wird eine Abweichung von Technischen<br />
Baubestimmungen „zugelassen“. Das<br />
bedeutet, dass Entwurfsverfasser und<br />
Bauausführende im Rahmen ihres Wir-<br />
52 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
kungskreises die Verantwortung dafür<br />
tragen, ob mit einer anderen Lösung in<br />
gleichem Maße die bauordnungsrechtlichen<br />
Anforderungen erfüllt werden.<br />
Will der Entwurfsverfasser oder der von<br />
ihm herangezogene Fachplaner bei der<br />
Planung und Bemessung Abweichungen<br />
von Technischen Baubestimmungen in<br />
Anspruch nehmen, sind diese Abweichungen<br />
im bautechnischen Nachweis<br />
gemäß § 67 BauO Bln anzugeben und zu<br />
begründen.<br />
Muss der bautechnische Nachweis bauaufsichtlich<br />
geprüft werden, beurteilt der<br />
Prüfingenieur für Standsicherheit bzw.<br />
Brandschutz im Rahmen seiner Prüfung,<br />
ob mit der gewählten anderen technischen<br />
Lösung im gleichen Maße die allgemeinen<br />
Anforderungen des § 3 Abs.1<br />
in Verbindung mit § 12 BauO Bln bzw. §<br />
14 BauO Bln erfüllt werden.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Im Auftrag<br />
T. Meyer<br />
Quellenhinweis:<br />
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen<br />
/bauaufsicht/de/rundschreiben.shtml<br />
Die Folgen und Konsequenzen der Einführung der Eurocodes<br />
für Ingenieure<br />
A. Die<br />
Ausgangssituation<br />
Gemäß § 3 Abs. 3<br />
MBO (Musterbauordnung;<br />
vgl.<br />
§ 3 Abs. 3 BauO<br />
Bln) haben u.a.<br />
die am Bau Beteiligten<br />
Ingenieure<br />
(insb. Tragwerksplaner<br />
und Prüfingenieure)<br />
bei<br />
der Erstellung<br />
ihrer Planung die von der Obersten Bauaufsichtsbehörde<br />
durch öffentliche<br />
Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen<br />
eingeführten technischen<br />
Regeln zu beachten. Von den<br />
Technischen Baubestimmungen kann<br />
abgewichen werden, wenn mit einer<br />
anderen Lösung in gleichem Maße die<br />
allgemeinen Anforderungen an die<br />
öffentliche Sicherheit und Ordnung der<br />
Anlage nicht gefährdet wird (insb. im Hinblick<br />
auf Leben, Gesundheit und die<br />
natürlichen Lebensgrundlagen).<br />
In <strong>Berlin</strong> wird die Liste der Ausführungsvorschriften<br />
(AV LTB; aktuell i.d.F.v.<br />
23.02.2011) durch die Senatsverwaltung<br />
für Stadtentwicklung als Oberste Bauaufsicht<br />
erlassen.<br />
Bis zum 30.06.<strong>2012</strong> sind nach dieser<br />
Vorschrift für den Tragwerksplaner und<br />
den Prüfingenieur die dort aufgeführten<br />
DIN maßgeblich (bspw. DIN 1045: Tragwerke<br />
aus Beton). Will der Tragwerkspla-<br />
von RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt und RA Lars Christian Nerbel<br />
RA Prof. Dr. Hans<br />
Rudolf Sangenstedt<br />
RA<br />
Lars Christian Nerbel<br />
ner seine Planung<br />
erfolgreich zur Genehmigungführen,<br />
hat er die DIN<br />
1055 zu beachten.<br />
Andernfalls<br />
weicht er von den<br />
Technischen Baubestimmungen<br />
ab<br />
und hat den oben<br />
bereits dargestellten<br />
Nachweis nach<br />
§ 3 Abs. 3 S. 3<br />
BauO Bln zu füh-<br />
ren, was regelmäßig mit erheblichem Aufwand<br />
und Kosten verbunden ist.<br />
Erstmalig mit Schreiben vom 25.08.2010<br />
(zuletzt mit Rundschreiben VI D Nr.<br />
39/2011) kündigte die Oberste Bauaufsicht<br />
in <strong>Berlin</strong> an, zum Stichtag<br />
01.07.<strong>2012</strong> die so genannten Eurocodes<br />
als bauaufsichtlich verbindlich einzuführen.<br />
Ab dem 01.07.<strong>2012</strong> gelten<br />
dann nicht mehr die bekannten DIN als<br />
für die Ingenieure verbindliche Technische<br />
Baubestimmungen, sondern jene<br />
Eurocodes.<br />
B. Was sind „Eurocodes“?<br />
Eurocodes sind europaweit vereinheitliche<br />
Bemessungsregeln in Bauwesen.<br />
Mit diesen einheitlichen Bemessungsregeln<br />
sollen technische Handelshemmnisse<br />
innerhalb der EU abgebaut und die<br />
Dienstleistungsfreiheit in Europa gefördert<br />
werden.<br />
Die Eurocodes werden von der CEN<br />
(Comité Européen de Normalisation), der<br />
Europäischen Normungsorganisation<br />
entwickelt, deren Mitglied u.a. das Deutsche<br />
Institut für Normung e.V. (DIN) ist.<br />
Entwickelt wurden bis dato insgesamt<br />
folgende 10 Eurocodes:<br />
• Eurocode 0:<br />
Grundlagen der Tragwerksplanung<br />
(EN 1990)<br />
• Eurocode 1:<br />
Einwirkungen auf Tragwerke<br />
(EN 1991)<br />
• Eurocode 2:<br />
Bemessung und Konstruktion von<br />
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken<br />
(EN 1992)<br />
• Eurocode 3:<br />
Bemessung und Konstruktion von<br />
Stahlbauten (EN 1993)<br />
• Eurocode 4:<br />
Bemessung und Konstruktion von<br />
Verbundtragwerken aus Stahl und<br />
Beton (EN 1994)<br />
• Eurocode 5:<br />
Bemessung und Konstruktion von<br />
Holzbauten (EN 1995)<br />
• Eurocode 6:<br />
Bemessung und Konstruktion von<br />
Mauerwerksbauten (EN 1996)<br />
• Eurocode 7:<br />
Entwurf, Berechnung und<br />
Bemessung in der Geotechnik<br />
(EN 1997)<br />
• Eurocode 8:<br />
Auslegung von Bauwerken gegen<br />
Erdbeben (EN 1998)
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 53<br />
• Eurocode 9:<br />
Berechnung und Bemessung von Aluminiumkonstruktionen<br />
(EN 1999)<br />
Den 10 Eurocodes sind jeweils – so auch in Deutschland - 58<br />
nationale Anhänge zugeordnet. Diese Anhänge sollen sicherstellen,<br />
dass die Eurocodes in den Mitgliedsländern angewendet<br />
werden können.<br />
Die 10 Eurocodes nebst den 58 nationalen Anhängen werden im<br />
Sprachgebrauch Eurocodepakete genannt.<br />
Bereits im Jahre 2008 beschloss die CEN, dass die entwickelten<br />
Eurocodes bis zum März 2013 keine Überarbeitung erfolgen<br />
sollen, sodass eine Umsetzung der aktuell vorliegenden Eurocodes<br />
gewährleistet werden soll. Lediglich notwendige Änderungen<br />
und Berichtigungen dürfen bis zum März 2013 veröffentlich<br />
werden.<br />
C. Praxisprobleme in Bezug auf die Eurocodes<br />
Nahezu erwartungsgemäß existieren bereits vor dem Stichtag<br />
01.07.<strong>2012</strong>, an dem die Eurocodes zur Technischen Baubestimmung<br />
i.S.d. § 3 Abs. 3 BauO Bln werden, eine Vielzahl von Problemen<br />
und offenen Fragen, die bis dato ungelöst bzw. auf die<br />
der Gesetzgeber keine schlüssige Antwort zur Hand hat.<br />
I. Eurocodepakte noch unvollständig<br />
Dem CEN bzw. der DIN wird es nicht gelingen zum 01.07.<strong>2012</strong><br />
alle 58 nationalen Anhänge zu veröffentlichen und Ihnen damit<br />
allgemeine Gültigkeit zu verschaffen. Dies hat zur Konsequenz,<br />
dass die Eurocodes nicht als Gesamtpaket zum 01.07.<strong>2012</strong> zur<br />
Technischen Baubestimmung werden, sondern lediglich in Teilen.<br />
Eingeführt werden lediglich die Eurocodes 0 – 5 sowie 7 und 9.<br />
Die Eurocodes 6 (Mauerwerksbau) und 8 (Erdbeben) bzw. die<br />
jeweils zugehörigen nationalen Anhänge liegen noch nicht im so<br />
genannten Weißdruck (finale Version des Normenwerks) vor.<br />
Beide fehlenden Eurocodes (nebst nationaler Anhänge) sollen<br />
nach den Plänen des CEN in den nächsten Monaten im Weißdruck<br />
erscheinen und sodann, wie auch aktuell in Bezug auf die<br />
Eurocodes 0 -5, 7 und 9 geschehen, zunächst als gleichwertige<br />
Lösung i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 3 BauO Bln neben den bekannten<br />
DIN-Normen zur Anwendung kommen.<br />
Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Ingenieure zum Stichtag<br />
01.07.<strong>2012</strong> einem „Flickenteppich“ von europäischen (Eurocodes)<br />
und nationalen Normen (DIN-Normen) gegenübergestellt<br />
sehen, deren richtige Anwendung insbesondere für kleinere<br />
Büros im günstigsten Falle mit erheblichem Mehraufwand verbunden<br />
sein wird, im schlechtesten Falle ein mangelfreies Planen<br />
unmöglich macht.<br />
II. Eurocodes nicht ausgereift<br />
Die vom Ingenieur zum Stichtag 01.07.<strong>2012</strong> als Technische Baubestimmung<br />
zu beachtenden Eurocodes 0-5, 7 und 9 wurden<br />
offensichtlich „mit heißer Nadel“ gestrickt.<br />
Zwar wurden große Teile der Eurocodes und der zugehörigen<br />
nationalen Anhänge bereits vor mehreren Jahren als Weißdruck<br />
veröffentlicht. Allerdings mussten die Normgeber in der Folgezeit<br />
erkennen, dass die veröffentlichen Codepakete teilweise unverständlich<br />
und fehlerbehaftet waren, sodass eine große Anzahl<br />
von Änderungen und Berücksichtigen die notwendige Folge<br />
waren. Hervorzuheben ist hierbei exemplarisch der Warnvermerk<br />
des NA-Bau zum Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1:2005-12 –<br />
Technische Baubestimmungen<br />
auf DVD – Inklusive Eurocodes!<br />
Jetzt 14 Tage<br />
testen!<br />
Direkt bestellen! Per Fax: 0221 5497-130<br />
Technische Baubestimmungen<br />
auf DVD<br />
€ 429,– (netto)<br />
Updates: 4-mal jährlich<br />
à € 149,– (netto)<br />
Mehrplatzversion auf<br />
Anfrage erhältlich.<br />
���������������������������������������������������������������������������<br />
Verlagsgesellschaft<br />
Rudolf Müller GmbH & Co. KG<br />
Postfach 41 09 49 · 50869 Köln<br />
Telefon 0221 5497-120<br />
Fax 0221 5497-130<br />
service@rudolf-mueller.de<br />
www.rudolf-mueller.de<br />
Recht<br />
Die „Technischen Baubestimmungen“ auf DVD liefern Ihnen den<br />
kompletten Inhalt des Standardwerks von Gottsch/Hasenjäger<br />
in elektronischer Fassung:<br />
Über 1.300 aktuelle DIN-Normen, rund 300 Rechtstexte und über<br />
600 zurückgezogene Baunormen. Außerdem finden Sie auf der<br />
DVD alle Eurocodes und Nationalen Anhänge – rechtzeitig zur<br />
bauaufsichtlichen Einführung zum 1. Juli <strong>2012</strong>!<br />
Ihre Vorteile:<br />
���Komfortable Suchfunktionen sorgen für eine schnelle und<br />
kinderleichte Recherche, inklusive Volltextsuche.<br />
��Alle Normen sind als PDF im Original-DIN-Layout enthalten.<br />
���Im historischen Pool sind auch zurückgezogene DIN-Normen<br />
enthalten.<br />
Bestellen Sie jetzt die DVD „Technische Baubestimmungen“<br />
14 Tage zur Ansicht!<br />
Expl. Best.-Nr. Titel Preis<br />
02101 DVD „Technische Baubestimmungen“ € 429,–<br />
(netto)<br />
������������ ���� ��������� ������������� ������ ��������� ����� ����� ������� �������� �����<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������<br />
Geschäftsadresse:<br />
Name /Vorname des Firmenansprechpartners Firma<br />
Straße<br />
Geschäftstelefon��������������<br />
Alle gefetteten Angaben sind Pflichtangaben.<br />
Datum, Unterschrift<br />
PLZ/Ort<br />
Geschäfts-E-Mail<br />
❒ �������������������������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������<br />
Hinweise zum Datenschutz: ����������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������� �����������������������������������<br />
������������������������������������������������<br />
4621<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 53
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 54<br />
Recht<br />
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten),<br />
der zu erlassen war, da maßgebliche<br />
Werte zu günstig angesetzt wurden<br />
und hieraus konkrete Gefahren für Leib<br />
und Leben bei der Umsetzung der Norm<br />
drohten.<br />
Das DIN erstellte daraufhin ein „Berichtigtes<br />
Dokument“ mit Ausgabedatum<br />
2010-12, welches die bis dato vorliegenden<br />
Änderungen und Berichtigungen<br />
zusammenfasste. Seit dem ersten Quartal<br />
2011 in Teilen (bspw. Eurocode 2) als<br />
gleichwertige Lösung i.S.d. § 3 Abs. 3 S.<br />
3 BauO Bln von der Obersten Bauaufsichtsbehörde<br />
in <strong>Berlin</strong> anerkannt.<br />
Allerdings räumt auch die Senatsverwaltung<br />
für Stadtentwicklung in <strong>Berlin</strong><br />
zuletzt mit Rundschreiben VI D Nr. 39/11<br />
v. 21.03.2011 ein, dass einige nationale<br />
Anhänge (bspw. zum Eurocode 1) – erst<br />
kurz vor dem 01.07.<strong>2012</strong> Weißdruckstatus<br />
erreichen werden. Es erscheint<br />
durchaus wahrscheinlich, dass insbesondere<br />
diese „nachgeschobenen“ Normen<br />
nicht frei von Unklarheiten und Fehlern<br />
sind, mit der Folge, dass mangelhafte<br />
Normen mit Wirkung zum 01.07.<strong>2012</strong><br />
zur Technischen Baubestimmung erhoben<br />
werden.<br />
Verunsicherungen und unüberschaubare<br />
Haftungsrisiken für die Ingenieure sind<br />
die Folge.<br />
III.Umsetzung der Eurocodes in der<br />
Praxis problematisch<br />
1. Softwareprobleme<br />
Da bis zum 01.07.<strong>2012</strong> die altbekannten<br />
DIN als Technische Baubestimmungen<br />
gelten, darüber hinaus die Eurocodes<br />
vielfältigen Überarbeitungen unterlagen<br />
und auch noch liegen, haben sich beispielsweise<br />
die Softwareentwickler nur<br />
äußerst zögerlich der Umsetzung der<br />
Eurocodepakete angenommen. Bei<br />
Ingenieuren bekannte und bewährte Statiksoftware<br />
wird erst seit kurzem mit<br />
Hochdruck angepasst. Die zwingende<br />
Folge des Zeitdrucks sind auch hier Programmierfehler<br />
und Updates.<br />
ithin ist nicht ausgeschlossen, dass zum<br />
01.07.<strong>2012</strong> dem Ingenieur nur solche<br />
Statiksoftware zur Verfügung steht, die<br />
im Hinblick auf die Umsetzung der Eurocodepakete<br />
als mangelhaft bezeichnet<br />
werden muss. Fehlerhafte Anwendungen<br />
der Eurocodepakete bzw. Berechnungsfehler<br />
sind nicht ausgeschlossen.<br />
2. Unzureichende Vorbereitung der<br />
Ingenieure<br />
Die Einführung jeder neuen Norm stellt<br />
54 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
den Ingenieur jeweils neu vor die Herausforderung,<br />
die neue Norm in seinen Planungen<br />
korrekt umzusetzen. Je umfangreicher<br />
die Änderungen sind, desto<br />
schwieriger wird diese Aufgabe selbstverständlich<br />
für den Ingenieur.<br />
Gerade kleineren Ingenieurbüros mit ein<br />
oder zwei Ingenieuren fehlt oft das Geld<br />
für kostenintensive Schulungsmaßnahmen.<br />
Auch verfügen solche Büros oft<br />
nicht über die notwendige Zeit, sich mit<br />
der gebotenen Sorgfalt in die neuen Normierungen<br />
einzuarbeiten. Ihnen steht<br />
nicht die Möglichkeit zum notwendigen<br />
Erfahrungsaustausch offen.<br />
Hinzu tritt das Problem, dass auch Fachkommentierung<br />
zur den Eurocodepaketen<br />
noch nicht vorliegt, die dem Ingenieur<br />
eine wichtige Hilfestellung bei der Auslegung<br />
einzelner Normen sein kann.<br />
Die Ingenieure werden somit gerade in<br />
der Anfangsphase ab dem 01.07.<strong>2012</strong><br />
regelmäßig auf sich alleine gestellt sein,<br />
wenn es um die richtige Anwendung der<br />
Eurocodepakete 0-5, 7 und 9 geht. Planungsfehler<br />
und Haftungsrisiken in<br />
erheblichem Umfange sind die Folge.<br />
IV. Lösungsansätze<br />
1. Verschiebung der Einführung der<br />
Eurocodes als Technische<br />
Baubestimmung<br />
Es könnte darüber nachgedacht werden,<br />
den Termin zur Einführung der Eurocodepakte<br />
0-5, 7 und 9 auf einen späteren<br />
Zeitpunkt zu verlegen, beispielsweise<br />
den 01.07.2013. Bis zum 01.07.2013<br />
könnten die bereits im Weißdruck vorliegenden<br />
Codepakete – wie bisher auch –<br />
als gleichwertige Lösung i.S.d. § 3 Abs. 3<br />
S. 3 BauO Bln neben den bekannten und<br />
bewährten DIN angewandt werden.<br />
2. Befristete Möglichkeit der<br />
Anwendung der bekannten DIN als<br />
gleichwertige Lösung<br />
Alternativ zur Verschiebung des Starttermins<br />
könnte – spiegelbildlich zum Rundschreiben<br />
VI D Nr. 39/11 v. 21.03.2011<br />
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
<strong>Berlin</strong> - darüber nachgedacht werden,<br />
trotz Erhebung der Eurocodes 0-5,<br />
7 und 9 zur Technischen Baubestimmung<br />
mit Wirkung zum 01.07.<strong>2012</strong>, die<br />
bis zum 30.06.<strong>2012</strong> anzuwendenden<br />
DIN-Normen als gleichwertige Lösung<br />
i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 3 BauO Bln weiterhin<br />
zuzulassen. Der Status als gleichwertige<br />
Lösung könnte zumindest bis zur für den<br />
März 2013 angekündigten Überarbeitung<br />
der Eurocodes aufrecht erhalten<br />
werden.<br />
3. Erörterung<br />
der beiden Lösungsansätze<br />
Beiden Lösungsansätzen ist der Vorteil<br />
gemeinsam, dass durch die Schaffung<br />
eines größeren Zeitfensters der Druck<br />
von den an der Einführung der Eurocodes<br />
beteiligten Personenkreisen genommen<br />
wird. Unzulänglichkeiten in Bezug<br />
auf die anzuwendende Statiksoftware<br />
u.ä. könnten beseitigt werden. Notwendige<br />
Schulungsmaßnahmen der Ingenieure<br />
könnten besser und in größerem<br />
Umfange durchgeführt werden. Durch<br />
ein weiteres Nebeneinander von DIN-<br />
Normen und Eurocode könnte insbesondere<br />
den Ingenieuren ein flüssiger Übergang<br />
zu den neuen Eurocodes ermöglicht<br />
werden.<br />
Eine Verschiebung der verbindlichen Einführung<br />
der Eurocodes als Technische<br />
Baubestimmung um bspw. 12 Monate<br />
hätte darüber hinaus den Vorteil, dass<br />
zusätzliche Zeit zur Verfügung stehen<br />
würde, um sämtliche vorgenannten Probleme<br />
unter geringerem Zeitdruck zu<br />
lösen. Es bestünde weiterhin die Möglichkeit,<br />
bis zum 01.07.2013 eine Komplettierung<br />
des Eurocodepaketes herbeizuführen,<br />
sodass ein in sich geschlossenes<br />
Gesamtkonzept bestehen würde,<br />
welches ein Nebeneinander von Eurocodes<br />
und DIN Normen obsolet machen<br />
könnte. Schließlich und endlich bestünde<br />
die Möglichkeit, auf Grundlage weiterer<br />
wissenschaftlicher Forschungen und<br />
Anwendungen in der Praxis noch bestehende<br />
Fehler und Unzulänglichkeiten der<br />
Eurocodes zu beseitigen und dem Ingenieur<br />
so eine größere Sicherheit zu verschaffen,<br />
dass das von ihm in öffentlich<br />
rechtlicher Hinsicht zu beachtende Normenpaket<br />
fehlerfrei ist.<br />
Allerdings dürfte es nunmehr für eine Verschiebung<br />
des Einführungstermins der<br />
Eurocodes, - weg vom 01.07.<strong>2012</strong> – hin<br />
zu einem späteren Zeitpunkt nunmehr<br />
deutlich zu spät sein. Schließlich wurde<br />
der Einführungstermin bereits im August<br />
2010 festgelegt. Ferner ist zu bedenken,<br />
dass die Einführung der Eurocodes zum<br />
01.07.<strong>2012</strong> nicht nur in <strong>Berlin</strong>, sondern in<br />
allen 16 Bundesländern stattfindet. Ein<br />
Alleingang <strong>Berlin</strong>s ist insoweit ausgeschlossen.<br />
Die Deklaration der bis dato geltenden<br />
DIN-Normen als gleichwertige Lösung<br />
i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 3 BauO Bln würde<br />
dagegen einen weitaus geringeren Verwaltungsaufwand<br />
hervorrufen, da der<br />
Starttermin der Eurocodes 01.07.<strong>2012</strong> in<br />
keiner Art und Weise tangiert würde. Eine<br />
entsprechende Reaktion auf die zuvor
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 55<br />
dargestellten Praxisprobleme wäre auch<br />
jetzt noch ohne weiteres möglich.<br />
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen,<br />
dass die Bundesländer – so auch<br />
die Stadt <strong>Berlin</strong> – zuletzt mit Rundschreiben<br />
vom VI D Nr. 39/11 v. 21.03.2011 eindeutig<br />
herausgestellt haben, dass die<br />
aktuell noch als Technische Baubestimmung<br />
anzusehenden DIN-Normen im<br />
Verhältnis zu denjenigen Eurocodes, die<br />
ab dem 01.07.<strong>2012</strong> zur Technischen<br />
Baubestimmung werden, als gleichwertig<br />
zu betrachten sind.<br />
Wenn aber bis zum 30.06.<strong>2012</strong> eine<br />
Gleichwertigkeit beider Normierungen<br />
durch die Oberste Bauaufsicht <strong>Berlin</strong>s<br />
bescheinigt würde, wäre es zwingend,<br />
dass diese Gleichwertigkeit auch nach<br />
dem 30.06.<strong>2012</strong> bestünde – mindestens<br />
bis zum März 2013. Schließlich ändern<br />
sich aufgrund Beschlusses des CEN aus<br />
dem Jahre 2008 zumindest bis in den<br />
März 2013 die bereits heute im Weißdruck<br />
vorliegenden Eurocodes nicht.<br />
Der zweitgenannte Lösungsansatz würde<br />
mit Sicherheit auch dazu beitragen,<br />
dass in stärkerem Maße eine Sensibilisierung<br />
der Ingenieure für das Thema<br />
Eurocodes geschaffen wird. Aufgrund<br />
der Deklaration der Eurocodes als Technische<br />
Baubestimmung ab dem<br />
01.07.<strong>2012</strong> würden die Ingenieure eher<br />
dazu veranlasst werden, sich entsprechend<br />
fortzubilden.<br />
V. Zwischenfazit<br />
Zusammenfassend spricht sich der Verfasser<br />
dafür aus, an der zum 01.07.<strong>2012</strong><br />
geplanten Teil-Einführung der Eurocodepakete<br />
festzuhalten, da eine Verschiebung<br />
nicht mehr möglich sein dürfte.<br />
Um aber den aufgezeigten Praxisproblemen<br />
im Zusammenhang mit der Teil-Einführung<br />
der Eurocodepakte als Technische<br />
Baubestimmung effizient zu entgegnen,<br />
hält es der Verfasser für zwingend<br />
geboten und auch ohne weiteres<br />
möglich, zumindest bis zum März 2013<br />
die bis zum 01.07.<strong>2012</strong> geltende Situation<br />
zu „spiegeln“, sodass ab dem<br />
01.07.<strong>2012</strong> die Eurocodepakete 0-5, 7<br />
und 9 als Technische Baubestimmung §<br />
3 Abs. 3 S. 1 BauO Bln von den Ingenieuren<br />
zu beachten sind, darüber hinaus die<br />
bis zum 30.06.<strong>2012</strong> als Technische Baubestimmung<br />
anzusehenden DIN-Normen<br />
als gleichwertige Lösung i.S.d. § 3<br />
Abs. 3 S. 1 BauO Bln anerkannt werden.<br />
D. Der rechtliche Umgang mit den<br />
Eurocodes ab dem 01.07.<strong>2012</strong><br />
Wie im Zuge jeder Normänderung, stellt<br />
sich auch im Zuge der Einführung der<br />
Eurocodes als Technische Baubestimmung<br />
für den Ingenieur die Frage, welche<br />
Konsequenzen sich hieraus für seine Planungsleistung<br />
ergeben.<br />
Der Ingenieur, bspw. der Tragwerksplaner,<br />
wird regelmäßig auf Basis eines<br />
Werkvertrages mit seinem Auftraggeber<br />
gemäß §§ 631 ff. BGB tätig. Um seine<br />
Vergütung zu erhalten, hat er seinem Auftraggeber<br />
ein mangelfreies Werk i.S.d. §<br />
633 Abs. 1 BGB zu verschaffen, also eine<br />
mangelfreie Planung. Üblicherweise werden<br />
dies die Grundleistungen aus dem<br />
Leistungsbild der Tragwerksplanung<br />
gem. §§ 49 HOAI 2009 (§ 64 HOAI a.F.)<br />
sein.<br />
In privatrechtlicher Hinsicht ist die Planung<br />
des Ingenieurs mangelfrei, wenn<br />
sie u.a. den vertraglichen Vereinbarungen<br />
mit dem Auftraggeber entspricht<br />
oder die allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik beachtet.<br />
Ferner muss sie auch den öffentlich -<br />
rechtlichen Anforderungen genügen,<br />
mithin genehmigungsfähig sein. Soweit<br />
ein Objekt in <strong>Berlin</strong> zu planen ist, ist die<br />
Planung genehmigungsfähig, wenn sie<br />
den Technischen Baubestimmungen<br />
i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 1 BauO Bln entspricht,<br />
also bis zum 30.06.<strong>2012</strong> die geltenden<br />
DIN-Normen bzw. ab dem 01.07.<strong>2012</strong><br />
die Eurocodes 0-5, 7 und 9 beachtet.<br />
Da die Begriffe „allgemein anerkannte<br />
Regel der Technik“ und „Technische<br />
Baubestimmung“ nicht zwangsläufig<br />
deckungsgleich sind, bedarf es – gerade<br />
im Zusammenhang mit der Einführung<br />
der Eurocodes – einer differenzierten<br />
Beachtung.<br />
Recht<br />
I. Privatrechtliche Ebene<br />
1. Vereinbarung über das<br />
Planungssoll<br />
Auf der privatrechtlichen Ebene gilt die<br />
Planung des Ingenieurs als mangelfrei,<br />
wenn sie die konkreten vertraglichen Vereinbarungen<br />
beachtet, § 633 Abs. 2 Nr. 1<br />
BGB. Wird zwischen den Vertragsparteien<br />
gemeinsam festgelegt, dass die Planung<br />
unter Berücksichtigung der DIN-<br />
Normen (bspw. die DIN 1045) erstellt<br />
werden soll, hat die Planung des Ingenieurs<br />
auch nur diesen Anforderungen zu<br />
genügen. Die Einhaltung des Eurocodes<br />
2 als Nachfolgenorm ist dementsprechend<br />
nicht automatisch geschuldet.<br />
Maßgeblich ist daher, ob zum Zeitpunkt<br />
der Abnahme i.S.d. § 640 Abs. 1 BGB<br />
das Werk des Ingenieurs den vertraglichen<br />
Vereinbarungen entspricht. Im<br />
Zuge solcher vertraglicher Vereinbarungen<br />
hat der Ingenieur die ihm obliegenden<br />
Hinweis- und Beratungspflichten zu<br />
beachten, insbesondere den Auftraggeber<br />
darüber aufzuklären, dass Normen<br />
und Regeln einer fortlaufenden Veränderung<br />
unterliegen und welche Konsequenzen<br />
sich hieraus für das bestellte<br />
Werk ergeben.<br />
2. Beachtung der allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik<br />
Fehlt es an einer konkreten vertraglichen<br />
Vereinbarung zwischen den Parteien<br />
über das Planungssoll, muss das Werk<br />
sich für die gewöhnliche Verwendung<br />
eignen, § 633 Abs. 2, Nr. 2 BGB. Jede<br />
Planung des Ingenieurs muss dann zum<br />
Zeitpunkt der Abnahme zumindest den<br />
allgemein anerkannten Regeln der<br />
Technik entsprechen. Sie muss diejeni-<br />
ARGE Baurecht:<br />
Starre Altersgrenze aufgehoben<br />
BERLIN (DAV) - „Die leidige Frage, wie lange öffentlich bestellte Sachverständige<br />
arbeiten dürfen, ist geklärt“, erläutert Baufachanwältin Heike Rath, Mitglied des<br />
Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht<br />
(ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltverein (DAV). „Das Bundesverfassungsgericht<br />
gab einem EDV-Techniker Recht, der sich durch alle Instanzen geklagt<br />
hatte, um seine Bestellung auch über das 71. Lebensjahr hinaus zu behalten.“ Das<br />
Bundesverfassungsgericht urteilte, das oberste Fachgericht – das Bundesverwaltungsgericht<br />
in Leipzig – hätte bei seiner Ablehnung die neue altersfreundliche<br />
Rechtsprechung des EuGH berücksichtigen müssen. Dem kamen die Leipziger Verwaltungsrichter<br />
nach und entschieden im Sinne des Klägers: Die Altersgrenze ist nur<br />
zulässig, wenn sie mit sicherheitsrelevanten Argumenten begründet werden kann.<br />
(Az.: 8 C 24.11). „Auch alle im Bauwesen tätigen öffentlich bestellten Sachverständigen<br />
können sich auf dieses Urteil berufen“, resümiert Heike Rath. Weitere Informationen<br />
zur ARGE Baurecht unter www.arge-baurecht.com.<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 55
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 56<br />
Recht<br />
gen Regeln beachten, die in der Wissenschaft<br />
als theoretisch richtig anerkannt<br />
sind und feststehen, in der Praxis bei<br />
dem nach neuestem Erkenntnisstand<br />
vorgebildeten Techniker durchweg<br />
bekannt sind und sich aufgrund fortdauernder<br />
praktischer Erfahrung<br />
bewährt haben.<br />
Den bis zum 30.06.<strong>2012</strong> maßgeblichen<br />
DIN kommt nach ständiger Rechtsprechung<br />
(so bspw. BGH BauR 1998, 872f.;<br />
OLG Stuttgart, BauR 1977, 129) die<br />
widerlegbare Vermutung zu, dass sie<br />
den anerkannten Regeln der Technik<br />
entsprechen.<br />
Ob diese widerlegbare Vermutung ab<br />
dem 01.07.<strong>2012</strong> für die Eurocodes 0-5, 7<br />
und 9 gilt, bleibt abzuwarten. Dafür<br />
spricht, dass sie aus den DIN-Normen<br />
fortentwickelt wurden und auch im Übrigen<br />
bereits seit dem Januar 2011 zur<br />
Anwendung kommen. Dagegen spricht<br />
allerdings, dass die Ingenieure teilweise<br />
zwangsläufig noch über erhebliche Wissenslücken<br />
in Bezug auf die Eurocodes<br />
verfügen, sodass wohl nicht davon<br />
gesprochen werden kann, dass sich dies<br />
Eurocodes aufgrund fortdauernder praktischer<br />
Erfahrung bewährt haben. Erst<br />
mit fortdauernder Anwendung der Eurocodes<br />
als Technische Baubestimmung<br />
wird den Eurocodes eine vergleichbare<br />
widerlegbare Vermutung als allgemein<br />
anerkannte Regel der Technik zukommen<br />
können.<br />
Gleich ob DIN-Norm oder Eurocode, ein<br />
Gleichsetzen der vorgenannten Normen<br />
mit dem Begriff der allgemein anerkannten<br />
Regel der Technik verbietet sich,<br />
sodass die Einführung der Eurocodes<br />
per 01.07.<strong>2012</strong> in dieser Hinsicht für den<br />
Ingenieur keine direkten Konsequenzen<br />
nach sich ziehen wird. Gleich ob er seine<br />
Planung vor oder nach dem 01.07.<strong>2012</strong><br />
an seinen Auftraggeber übergibt, hat er<br />
sich - soweit es das Kriterium der allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik<br />
betrifft -, ständig fortzubilden und sich<br />
mit neuen Techniken und Verarbeitungsmethoden<br />
auseinander zu setzen. Der<br />
Ingenieur hat ständig aufs Neue zu<br />
ergründen, was (zumindest) allgemein<br />
anerkannte Regel der Technik ist.<br />
Maßgeblich ist in privatrechtlicher Hinsicht<br />
für den Ingenieur, dass diese allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik<br />
zum Zeitpunkt der Abnahme seiner<br />
Planung eingehalten werden. Der Ingenieur<br />
hat seine Planung entsprechend<br />
auszurichten – sofern bei Vertragsschluss<br />
der alsbaldige Regelwechsel<br />
vorhersehbar war.<br />
56 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Diese Verpflichtung birgt für den Ingenieur<br />
regelmäßig erhebliche Probleme,<br />
die er – sofern möglich – bereits bei Vertragsschluss<br />
beachten muss.<br />
Ist zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses<br />
für den Ingenieur absehbar, dass sich<br />
noch innerhalb der gewöhnlichen Planungszeit<br />
eine Änderung in Bezug auf die<br />
allgemein anerkannten Regeln der Technik<br />
vollziehen wird, sollte er zwingend<br />
darauf bedacht sein, bei Vertragsschluss<br />
ein bestimmtes Planungssoll unter<br />
Berücksichtigung einer definierten Technikregel<br />
festzulegen. Wird keine solche<br />
Vorgabe getroffen, sollte der Ingenieur<br />
bei Vertragsschluss zumindest darauf<br />
bedacht sein - für den Fall der Änderung<br />
der Technikregel während der Planungszeit<br />
- eine konkrete Honorarvereinbarung<br />
für Mehraufwendungen zu treffen.<br />
Unterlässt er eine solche Vereinbarung<br />
und ändern sich während der Planungsphase<br />
– für den Ingenieur vorhersehbar –<br />
die allgemein anerkannten Regeln der<br />
Technik, trägt er das Risiko für solche<br />
Mehraufwendungen, die ausgelöst durch<br />
Planänderungen oder Neuplanungen<br />
entstehen.<br />
Findet ein Wechsel innerhalb der allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik<br />
für den Ingenieur völlig unvorhersehbar<br />
statt, so hat er seinen Auftraggeber<br />
unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen,<br />
über die Alternativen zu beraten und<br />
die Entscheidung des Auftraggebers<br />
i.S.d. § 642 Abs.1 BGB einzuholen. Entscheidet<br />
sich der Auftraggeber für die<br />
Anpassung der Planung auf die nunmehr<br />
aktuellen allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik, erwächst dem Ingenieur<br />
ein Anspruch auf Vergütung seiner<br />
zusätzlichen Aufwendungen.<br />
Entscheidet sich der Auftraggeber für die<br />
Beibehaltung des bisherigen Standards,<br />
hat der Ingenieur über die hieraus resultierenden<br />
Konsequenzen zu beraten,<br />
Bedenken anzumelden und seine Planung<br />
auf Basis des „überholten“ Standards<br />
fortzusetzen.<br />
II. Öffentlich rechtliche Ebene<br />
Damit die Planungsleistung des Ingenieurs<br />
den öffentlich - rechtlichen Anforderungen<br />
entspricht, muss sie zum Zeitpunkt<br />
der Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens<br />
insbesondere das<br />
jeweils maßgebliche Bauordnungsrecht<br />
beachten (in <strong>Berlin</strong> die BauO Bln). Bis<br />
zum 30.06.<strong>2012</strong> hat der Ingenieur die<br />
bekannten DIN-Normen oder die als<br />
gleichwertig anerkannten Eurocodes zu<br />
berücksichtigen.<br />
Nach aktueller Rechtslage findet, wie<br />
oben bereits dargestellt, zum Stichtag<br />
01.07.<strong>2012</strong> ein Wechsel der Technischen<br />
Ausführungsbestimmungen hin zu den<br />
Eurocodes 0-5, 7 und 9 statt. Ab diesem<br />
Zeitpunkt sind diese Eurocodes, nicht<br />
aber mehr die DIN-Normen zu beachten.<br />
„Kritischer Zeitpunkt“ ist in öffentlich<br />
rechtlicher Hinsicht nicht die Abnahme<br />
i.S.d. § 641 BGB, sondern die Einleitung<br />
des Baugenehmigungsverfahrens.<br />
ird das Baugenehmigungsverfahren<br />
vor dem 01.07.<strong>2012</strong> eingeleitet,<br />
bemisst sich die Mangelfreiheit der Planung<br />
anhand der DIN-Normen bzw.<br />
der gleichwertigen Eurocodes.<br />
Erfolgt eine Einleitung ab dem<br />
01.07.<strong>2012</strong>, sind nach derzeitiger Sachund<br />
Rechtslage ausschließlich die<br />
Eurocodes maßgeblich. Ohne besondere<br />
Erklärung der Obersten Bauaufsicht<br />
<strong>Berlin</strong>s wird man nicht davon ausgehen<br />
können, dass mit Wirkung zum<br />
01.07.<strong>2012</strong> die bis zum 01.07.<strong>2012</strong> maßgeblichen<br />
DIN-Normen als gleichwertige<br />
Lösung i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 3 BauO Bln<br />
angesehen werden können. Eine nach<br />
DIN-Normen erstellte Planung wird mithin<br />
bei Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens<br />
ab dem 01.07.<strong>2012</strong><br />
nicht mehr genehmigungsfähig sein.<br />
Will der Ingenieur seine nach DIN-Normen<br />
erstellte Planung nach dem<br />
30.06.<strong>2012</strong> einer Genehmigung zuführen,<br />
so hat er sie unter Berücksichtigung<br />
der Eurocodes 0-5, 7 und 9 zu überarbeiten<br />
ggf. sogar neu zu erstellen.<br />
Die Frage, ob dem Ingenieur für diese<br />
Mehrleistungen ein Anspruch auf zusätzliche<br />
Vergütung zusteht, bedarf einer Einzelfallbetrachtung,<br />
wobei auf das bereits<br />
unter D.I.2. Gesagte Bezug genommen<br />
werden kann:<br />
Nur dann, wenn für den Ingenieur die<br />
Änderung der Normierung - weg von den<br />
DIN-Normen hin zu den Eurocodes -<br />
unvorhersehbar war, wird er einen<br />
Anspruch auf Ersatz der aus den zusätzlichen<br />
Leistungen oder Wiederholungsleistungen<br />
entstehenden Mehraufwendungen<br />
inne haben können. Hierbei wird<br />
stets zu berücksichtigen sein, dass die<br />
Einführung der Eurocodes 0-5, 7 und 9<br />
als Technische Baubestimmung u.a.<br />
auch in <strong>Berlin</strong> zum 01.07.<strong>2012</strong> zumindest<br />
seit dem 25.08.2010 bekannt war und<br />
überdies durch Rundschreiben VI D Nr.<br />
39/2011 der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung<br />
<strong>Berlin</strong> vom 21.03.2011 die<br />
Eurocodes in Teilen ab dem ersten Quar-
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 57<br />
tal 2011 als gleichwertige Lösung i.S.d. §<br />
3 Abs. 3 S. 3 BauO Bln anerkannt wurden.<br />
Es dürfte einem Ingenieur, der nach dem<br />
25.08.2010 bzw. 21.03.2011 seine Planungsleistungen<br />
auf Basis der DIN-Normen<br />
beginnt, schwer fallen, einen<br />
Anspruch auf zusätzliche Vergütung von<br />
seinem Auftraggeber einzufordern, wenn<br />
er das Genehmigungsverfahren nicht<br />
spätestens zum 30.06.<strong>2012</strong> einleiten<br />
kann und infolge dessen seine Planung<br />
auf Basis der ab dem 01.07.<strong>2012</strong> ausschließlich<br />
geltenden Eurocodes als<br />
Technische Baubestimmung überarbeiten<br />
muss. Regelmäßig wird sich der Ingenieur<br />
den Vorhalt machen lassen müssen,<br />
er hätte seine Planungen bereit zu<br />
dieser frühen Phase auf die seit Dezember<br />
2010 im Weißdruck vorliegenden<br />
Eurocodes in Verbindung mit dem Rundschreiben<br />
VI D Nr. 39/2011 der Senatsverwaltung<br />
für Stadtentwicklung <strong>Berlin</strong><br />
vom 21.03.2011 ausrichten müssen. Der<br />
Ingenieur müsste jeweils darlegen und<br />
beweisen, dass für ihn unvorhersehbar<br />
und schuldlos das Baugenehmigungsverfahren<br />
nicht zum 30.06.<strong>2012</strong> eingeleitet<br />
werden konnte, also nicht seiner Risikosphäre<br />
zugeordnet werden kann.<br />
E. Fazit<br />
Infolge der Einführung der Eurocodes 0 –<br />
5, 7 und 9 nebst entsprechender nationaler<br />
Anhänge in Deutschland mit Stichtag<br />
01.07.<strong>2012</strong> als Technische Baubestimmung<br />
i.S.d. § 3 Abs.3 MBO (§ 3 Abs. 3<br />
BauO Bln) werden die Ingenieure und<br />
Prüfingenieure vor eine Vielzahl neuer<br />
tatsächlicher und rechtlicher Probleme<br />
gestellt.<br />
Zur Entschärfung der Problematik<br />
erscheint es notwendig und sachgerecht,<br />
zumindest bis zum März 2013 die<br />
durch die Eurocodes ersetzten DIN-Normen<br />
als gleichwertige Lösung gemäß § 3<br />
Abs. 3 S. 3 MBO (§ 3 Abs. 3 S. 3 BauO<br />
Bln) anzusehen.<br />
Die Folgen der sicher zu erwartenden<br />
„Anlaufschwierigkeiten“ der Eurocodes<br />
könnten abgemildert werden. Die Eurocodepakete<br />
könnten einen weiteren<br />
„Reifeprozess“ erfahren. In der Praxis<br />
könnte sich zeigen, ob auch den Eurocodes<br />
die widerlegbare Vermutung zukommen<br />
kann, allgemein anerkannte Regel<br />
der Technik zu sein. Vor allem aber könnte<br />
das befristete Nebeneinander von<br />
Eurocodes und DIN-Normen dazu beitragen,<br />
eine Vielzahl von Honorarstreitigkeiten<br />
zwischen Auftraggebern und<br />
Ingenieuren zu vermeiden, Planungsabläufe<br />
zu beschleunigen und die ordentliche<br />
Gerichtsbarkeit zu entlasten.<br />
Bonn, 20.05.<strong>2012</strong><br />
Recht<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 57
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 58<br />
Stellenmarkt<br />
Mitglieder der <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> können die Zeitschrift kostenfrei für Ihre Stellenanzeige nutzen<br />
ebenso wie die Homepage unter www.baukammerberlin.de<br />
Stellenangebote einschl. Praktikantenplätze • Stellengesuche • Angebote für Büropartnerschaften und -übernahmen<br />
� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze<br />
58 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Stellenmarkt<br />
Planungsingenieur/Technische Gebäudeausrüstung<br />
• Dipl.-Ing. Versorgungstechnik/Energietechnik/Umwelttechnik<br />
• 5 Jahre Erfahrung in einem Planungsbüro für Gebäudetechnik<br />
• Fundierte Kenntnisse der HOAI/VOB<br />
• Reisebereitschaft<br />
• Kenntnisse in Planung und Bauleitung von Heizungs-, Sanitär-, Raumluft-, u.o. Sprinklertechnik<br />
Kontaktadresse: Happold Ingenieurbüro GmbH<br />
Pfalzburger Str. 43-44, 10717 <strong>Berlin</strong>, Sabine Bacher,<br />
Tel.: 030 860 90 60, E-Mail: sabine.bacher@burohappold.com<br />
Projektmanager/Bauingenieur (m/w) Projektentwicklung<br />
Ein kleines freundliches Team sucht zuverlässige Verstärkung. Zu den Aufgaben gehören: Standortanalysen, Erstellen von<br />
Trendprognosen, Erstellung von Ablauf- und Terminplanung, Kosten- und Terminverfolgung, Soll-Ist-Vergleiche, Mitwirkung<br />
bei Risikoanalysen.<br />
Sie haben erfolgreich ein fachbezogenes Studium abgeschlossen und bereits einige Jahre Berufserfahrung, sichere<br />
Englisch-, Arriba-, MS-Office- und MS-Project-Kenntnisse. Zusätzlich sind Erfahrungen im Baurecht und Auto-CAD-<br />
Kenntnisse wünschenswert.<br />
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.<br />
Kontaktadresse: pmw Gesellschaft für Projektmanagement mbH<br />
Hardenbergplatz 2, 10623 <strong>Berlin</strong>, Christine Güler, Tel.: 030 4437330, E-Mail: info@pmwgmbh.de<br />
Projektassistent/-in dringend gesucht!<br />
Voraussetzung: Abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium Bauingenieurwesen, Architektur. Gerne auch im<br />
geringer Berufserfahrung, Teilzeit ist auch möglich. PC-Kenntnisse in MS-Office Programmen erforderlich,<br />
MS-Project-Kenntnisse wären hilfreich.<br />
Kontaktadresse: PB Projektmanagement Bräuling GmbH<br />
Möckernstraße 65, 10965 <strong>Berlin</strong>, Olaf Bräuling, Tel.: 030 78959090, E-Mail: o.braeuling@pb-braeuling.de<br />
Bauingenieur(in) mit Schwerpunkt Tragwerksplanung<br />
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das deutschlandweit in Planung, Produktion, Transport und Montage<br />
von hochwertigen Stahlbetonfertigteilen tätig ist.<br />
Für unser Ingenieurbüro suchen wir zur Festanstellung Bauingenieur(in) mit guten Kenntnissen in Statik und Konstruktion<br />
und möglichst mit Erfahrungen in der Planung von Stahlbeton-Fertigteilbauten. Wir bieten Vollzeitbeschäftigung an<br />
attraktiven Bauvorhaben in einem modernen ausgestatteten Büro, Möglichkeiten zur Fortbildung sowie branchenübliche<br />
Vergütung. Gerne geben wir auch Absolventen eine Chance zum Berufseinstieg.<br />
Ihre Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Foto senden Sie bitten mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an:<br />
Kontaktadresse: allton Planung + IT-Entwicklung GmbH<br />
Veltener Straße 99, 16761 Hennigsdorf, Thomas Hanack,<br />
Tel.: 03302 803 501, E-Mail: planung@allton-online.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 59<br />
Wir suchen: Studenten (m/w) der Fachrichtung Verkehrswesen<br />
Titelthema<br />
Was Sie erwartet<br />
Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,<br />
Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich.<br />
Was wir Ihnen bieten<br />
Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem expandierenden Unternehmen mit über<br />
70 Mitarbeitern in einer hochinteressanten Branche sowie ein motiviertes Team in einem freundlichen Arbeitsumfeld.<br />
Wir bieten auch Diplomarbeiten, Praxissemester, Praktika etc.<br />
Was wir erwarten<br />
Spaß am Beruf und an der Arbeit. Sie zeichnen sich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark<br />
und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in AutoCAD.<br />
Wenn wir Ihre Neugier geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung zu.<br />
Kontaktadresse: Böger + Jäckle Gesellschaft Beratender Ingenieure<br />
Kirschenallee 18, 14050 <strong>Berlin</strong>, Dirk Vielhaben Tel.: 0174 701 84 65, Email: vielhaben@boeger-jaeckle.de<br />
Elektroingenieur (m/w)<br />
• Dipl.-Ing. Elektrotechnik/Elektrische Energietechnik (TU/FH)<br />
• idealer Weise abgeschlossene Ausbildung in der Elektrotechnik<br />
• idealer Weise fünf Jahre Berufserfahrung in einem Planungsbüro<br />
• Umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen<br />
Elektrotechnik/Starkstrom • Nachrichtentechnik/Schwachstrom, Meß-Steuer, • Regelungstechnik (MSR)<br />
u/o Fördertechnik<br />
Kontaktadresse: Happold Ingenieurbüro GmbH<br />
Pfalzburger Str. 43-44, 10717 <strong>Berlin</strong>, Sabine Bacher,<br />
Tel.: 030 860 90 60, E-Mail: sabine.bacher@burohappold.com<br />
Wir suchen: Bauingenieure der Fachrichtung Verkehrswesen<br />
Was Sie erwartet<br />
Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,<br />
Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich.<br />
Was wir Ihnen bieten<br />
Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem expandierenden Unternehmen mit über<br />
70 Mitarbeitern in einer hochinteressanten Branche sowie ein motiviertes Team in einem freundlichen Arbeitsumfeld.<br />
Wir bieten auch Diplomarbeiten, Praxissemester, Praktika etc.<br />
Was wir erwarten<br />
Spaß am Beruf und an der Arbeit. Sie zeichnen sich durch eine selbständige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark<br />
und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in Vestra oder CARD/1, AutoCAD, ARRIBA.<br />
Wenn wir Ihre Neugier geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung zu.<br />
Kontaktadresse: Böger + Jäckle Gesellschaft Beratender Ingenieure<br />
Kirschenallee 18, 14050 <strong>Berlin</strong>, Dirk Vielhaben Tel.: 0174 701 84 65, Email: vielhaben@boeger-jaeckle.de<br />
Projektleiter für Wohnungsbauprojekte gesucht.<br />
Wir sind auf der Bauherrenseite tätig und suchen zur Unterstützung bei neuen Projekten eine/n Projektleiter/-in,<br />
Voraussetzung ist ein angeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium im Bereich Bauingenieurwesen oder Architektur.<br />
Gern auch Berufsanfänger.<br />
Kontaktadresse: PB Projektmanagement Bräuling GmbH<br />
Möckernstraße 65, 10965 <strong>Berlin</strong>, Olaf Bräuling, Tel.: 030 78959090, E-Mail: o.braeuling@pb-braeuling.de<br />
<strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong> | 59
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 60<br />
Titelthema<br />
� Stellenangebote<br />
VORBEREITUNG UND MITWIRKUNG BEI DER VERGABE LP 6 / 7<br />
Ingenieur/-in / Architekt/-in für Ausschreibungen<br />
Verfügen Sie über Erfahrungen in der Erstellung von Leistungsverzeichnissen / Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen?<br />
Sie sind aufgeschlossen und kontaktfreudig, flexibel und verfügen über Organisationsgeschick. Wir bieten Ihnen ein engagiertes<br />
Team, strukturierte Projektführung, kontinuierliche Weiterbildung -sowohl intern als auch extern. Ein sicherer Umgang mit den<br />
gebräuchlichen AVA – Programmen (z.B. California Pro) ist Voraussetzung.<br />
Suchen Sie eine langfristige Perspektive - bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen - einschließlich<br />
Gehaltsvorstellungen und möglichem Arbeitsbeginn.<br />
Bewerbungen bitte an: team@just-architekten.com<br />
� Stellengesuche<br />
Dipl.-Ing. Architektur, Sachverständiger für barrierefreie Stadt- und Gebäudeplanung<br />
seit 2006 überwiegend im Innenausbau tätig, sucht Mitarbeit in einem interdisziplinär aufgestellten Architektur- oder Sachverständigenbüro;<br />
Tätigkeitsschwerpunkt „barrerefreies Planen und Bauen“ Kontakt: architech@online.de<br />
Staatlich geprüfter Bautechniker<br />
Mein Name ist Marc Sander, ich bin 26 Jahre alt und werde im Juli <strong>2012</strong> meinen Abschluss als staatlich geprüften Bautechniker<br />
erreichen. Ich bin gelernter Tischler und habe dort 7 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Dazu bin ich flexibel, freundlich und<br />
zuverlässig und habe Erfahrung mit Software wie Allplan, CAD, Dämmwerk und Office.<br />
Auf ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen.<br />
Kontaktadresse: Marc Sander, Tel.: 0151 29 10 65 41, Email: bt.marcsander@googlemail.de<br />
� Angebot von Büropartnerschaften und -übernahmen<br />
Biete Raum/Platz für Büropartnerschaft<br />
Suche Beratende/n Ingenieur/in vorzugsweise im Bereich Gebäudeenergieberatung/-planung oder verwandte bzw.<br />
angrenzende Tätigkeitsgebiete für Büropartnerschaft.<br />
Biete max. 3 Räume bzw. Plätze in seit 2006 betriebenem Ladenbüro mit 90 m2 Fläche und sehr günstiger Miete.<br />
Kontaktadresse: laws consulting,<br />
Reichenberger Str. 72, 10999 <strong>Berlin</strong>, Werner Hross, Tel.: 0178 610 70 20 Email: w.hross@laws.de<br />
Vermietungsangebot<br />
Architekturbüro in zentraler Lage (S-Bahnhof Savignyplatz) bietet voll eingerichtete Arbeitsplätze für Planungsbüros<br />
(4 Plätze plus Infrastruktur). Ggf. auch doppelte Anzahl möglich.<br />
Miete für kleine Lösung 900,- Euro zzgl. Nebenkosten. Große Lösung Verhandlungssache.<br />
Kontaktadresse: Deubzer König Architekten<br />
Knesebeckstr. 77, 10623 <strong>Berlin</strong>, Herr J. König,<br />
Tel.: 885 22 01 o. 0170-472 86 50, koenig@deubzerkoenigarchitekten.de<br />
Biete Raum/Arbeitsplatz für Büropartnerschaft<br />
Suche Beratende/n Ingenieur/in für den Bereich Gebäudesachschäden (Brand-, Sturm-, Wasser-, Elementar- und<br />
Haftpflichtschäden).<br />
Kontaktadresse: PhoenixS Sachverständige<br />
Ruppiner Chaussee 19a, 16761 Hennigsdorf, Dipl.-Ing. Architekt Norbert Reimann,<br />
Tel.: 03302 787 70 00, Email: norbert.reimann@phoenixs.org<br />
60 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong>
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 61<br />
UZIN UTZ Ausgewählte Produktinformationen<br />
Bodenausgleich bis 300 mm leicht gemacht<br />
Leicht, flexibel und schnell: Uzin-Turbolight-System<br />
Renovierungsmaßnahmen im Bestand<br />
stellen Planer und Handwerker<br />
oft vor unerwartete Herausforderungen.<br />
Begrenzte Tragfähigkeit oder<br />
Aufbauhöhe, Ausbrüche und durchhängende<br />
Decken beispielsweise erfordern<br />
eine adäquate Fußbodenkonstruktion.<br />
Mit dem Turbolight-System<br />
von Uzin ist ein flexibler, großflächiger<br />
Niveauausgleich bis zu 300 mm möglich,<br />
bei extrem geringem Flächengewicht,<br />
hoher Festigkeit und kurzen<br />
Einbauzeiten.<br />
Das Uzin-Turbolight-System ist ein<br />
neuartiges System aufeinander abgestimmter<br />
Verlegewerkstoffe zur Herstellung<br />
schnell belegereifer Untergründe.<br />
Der Name verdeutlicht bereits, welche<br />
Lösungsmöglichkeiten in ihm stecken:<br />
Die Flächenlasten auf dem tragenden<br />
Untergrund liegen nur bei rund einem<br />
Drittel der Last von konventionellen Estrichen<br />
und die Zeiten bis zur Belegereife<br />
verkürzen sich auch im Vergleich zu<br />
Trockenestrichen etwa um die Hälfte. Unebenheiten<br />
lassen sich übergangslos<br />
vom Korndurchmesser bis 300 mm ausgleichen,<br />
wobei die mittlere Schichtdicke<br />
bei 30 mm liegt.<br />
Statt aufwendigen Zusägens bei Fertigteilestrichen,<br />
langen Trocknungszeiten<br />
und hohen Lasten bei Zement- und Calciumsulfatestrichen<br />
ist das aufeinander<br />
abgestimmte Verbundsystem leicht zu<br />
verarbeiten, verformungsfrei und spannungsarm.<br />
Zudem besitzt es eine niedrige<br />
Dichte und ist hoch wärmedämmend.<br />
Ein weiterer Vorteil: Es ist wasserfest und<br />
deshalb auch uneingeschränkt für Feuchträume<br />
geeignet.<br />
Aufbau und Wirkungsweise<br />
Das Uzin-Turbolight-System besteht<br />
aus dem schnellen Leichtausgleichs-<br />
Der schnelle Leichtausgleichsmörtel Uzin NC 194 Turbo passt sich flexibel an alle unebenen<br />
Untergründe an. Er ist mit gängiger Estrichtechnik misch- und pumpfähig sowie<br />
erhärtungs- und trocknungsbeschleunigt.<br />
Das Renoviervlies Uzin RR 201 aus hochzugfesten<br />
Langglasfasern dient als Armierung<br />
und verbindet sich mit den anderen<br />
Systemkomponenten zu einem hochfesten<br />
Verbundwerkstoff, der zu einem<br />
außergewöhnlich hohen Lastaufnahmevermögen<br />
des Gesamtsystems führt.<br />
Das Uzin-Turbolightsystem ist ein einzigartiges System aufeinander abgestimmter und<br />
erprobter Verlegewerkstoffe zur Herstellung schnell belegreifer Untergründe.<br />
mörtel Uzin NC 194 Turbo, dem Renoviervlies<br />
Uzin RR 201 und dem Dünnestrich<br />
Uzin NC 195. Den Unterbau des<br />
Systems bildet der Leichtausgleichsmörtel,<br />
der sich flexibel an unebene Untergründe<br />
anpasst und die auftretenden<br />
Lasten auch bei Ausbrüchen gleichmäßig<br />
auf den tragenden Untergrund beziehungsweise<br />
die tragende Decke verteilt.<br />
Die zweite Komponente des Systems bildet<br />
das Renoviervlies aus hochzugfesten<br />
Langglasfasern. Diese sind mit einem<br />
wasserlöslichen Kleber fixiert, der sich<br />
auflöst, sobald die Verbundausgleichsmasse<br />
als dritte Komponente aufgespachtelt<br />
wird. Die Armierungsfasern bilden<br />
so in Kombination mit dem Dünnestrich<br />
einen hochfesten Faserverbund-<br />
Fotos: Uzin Utz AG<br />
werkstoff, der zu einem außergewöhnlich<br />
hohen Lastaufnahmevermögen des Gesamtsystems<br />
beiträgt. Nach DIN 1055<br />
können damit alle Lastanforderungen der<br />
Klassen A für Wohnflächen sowie der von<br />
B1 und B2 für Büroflächen erfüllt werden.<br />
Auch der Vergleich der Ergebnisse von<br />
Druckversuchen mit und ohne die besondere<br />
Armierungstechnik belegt die Robustheit<br />
des Systems.<br />
Ausbrüche und durchhängende Decken<br />
sind mit dem Turbolight-System kein<br />
Problem, denn es ermöglicht einen<br />
flexiblen, großflächigen Niveauausgleich<br />
bis zu 300 mm bei extrem geringem<br />
Flächengewicht, hoher Festigkeit und<br />
kurzen Einbauzeiten.<br />
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten<br />
Das Uzin-Turbolight-System lässt sich<br />
mit gängiger Estrich- und Spachtelmassentechnik<br />
aufbringen, ist erhärtungsund<br />
trocknungsbeschleunigt und sehr<br />
schnell belegereif. So kann es als Problemlöser<br />
auf Terminbaustellen eingesetzt<br />
werden. Auf dem ausgehärteten<br />
Uzin-Turbolight-System können textile<br />
und elastische Bodenbeläge, Parkett sowie<br />
Fliesen nach den üblichen Methoden<br />
verlegt werden. Die Zeit bis zur Belegereife<br />
variiert nach Art des Oberbelags.<br />
Besonders vorteilhaft bei Renovierungen<br />
in Altbauten: Mit 10 dB besitzt das System<br />
auch eine bemerkenswerte Trittschalldämmung.<br />
Katja Kretzschmar, www.uzin.de<br />
Hinweis der Redaktion: Für diese mit Namen<br />
und/oder Internet-Adresse gekennzeichneten<br />
ausgewählten Produktinformationen übernimmt<br />
die Redaktion keine Verantwortung.<br />
Kontakt: Roger@Ferch-Design.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 62<br />
Ausgewählte Produktinformationen SIKA<br />
Abdichtung von Betonfertigteilkellern<br />
Neue sichere Technologie: Frischbeton-Verbunddichtungsbahn SikaProof A<br />
Wirtschaftlicher Druck und möglichst<br />
kurze Bauzeiten sind der Grund,<br />
warum Bauwerke immer öfter in Fertigteilbauweise<br />
realisiert werden.<br />
Dieser Trend ist in allen Bereichen der<br />
Bauindustrie zu verzeichnen - vom Wohnungsbau<br />
über Industrie- und Gewerbebau<br />
bis hin zu Gebäuden mit besonders<br />
hochwertigem Nutzungsanspruch, wie<br />
zum Beispiel Archive und Lagerräume<br />
für feuchtempfindliche Güter.<br />
Die Ausführung erfolgt entweder mit<br />
massiven Vollwandelementen oder mit<br />
Dreifachwänden. Die Abdichtung stellt<br />
die Ausführung jedoch vor eine besondere<br />
Herausforderung, da die üblichen<br />
Bauweisen als WU-Konstruktion mit Fugenband<br />
hier nur sehr begrenzt möglich<br />
sind. Die Sika Deutschland GmbH hat<br />
hierfür eine einfach zu installierende, sichere<br />
und wirtschaftliche Systemlösung<br />
entwickelt: Die Kombination aus dem<br />
Fugenabklebesystem Tricoflex mit der<br />
neuen Frischbetonverbunddichtungsbahn<br />
SikaProof A.<br />
SikaProof A steht für eine neue Generation<br />
der Frischbetonverbund-Abdichtung und<br />
bietet vielfältige Lösungen für die Erstellung<br />
wasserdichter Betonbauwerke.<br />
Systemkombination aus Fugen-<br />
und Flächenabdichtung<br />
Flächenabdichtungen sind bereits seit<br />
vielen Jahrzehnten am Markt. Ihr größter<br />
Nachteil ist allerdings der hohe Sanierungsaufwand<br />
im Schadensfall. Eine<br />
herkömmliche Flächenabdichtung, wie<br />
beispielsweise die schwarze Wanne,<br />
umhüllt das Bauwerk nur lose. Deshalb<br />
kann Feuchtigkeit gegebenenfalls durch<br />
eine Perforation der Abdichtung eintreten<br />
und anschließend zwischen Bauwerk<br />
und Abdichtungslage wandern. Um<br />
dies zu vermeiden, arbeiten moderne<br />
Systeme mit der Frischbetonverbundtechnologie:<br />
Sie ist hinterlaufsicher und<br />
bietet somit höchsten Schutz.<br />
Hinterlaufschutz durch die Grid-Seal-<br />
Technology: Die Dichtungsmembran ist<br />
mit einer gitternetzartigen Struktur geprägt,<br />
die mit einem speziellen Dichtstoff<br />
gefüllt ist. Kommt es zu einer Beschädigung<br />
der Dichtungsmembran, wird das<br />
Wasser innerhalb eines kleinen Teilbereichs<br />
gehalten und kann die Dichtungsbahn<br />
nicht hinterwandern.<br />
Die neue, innovative Dichtungsbahn<br />
SikaProof A von der Sika Deutschland<br />
GmbH ist eine mehrlagige Abdichtungsmembran<br />
auf Basis einer bewährten<br />
FPO-Dichtungsbahn und der neuen speziell<br />
dafür entwickelten Grid-Seal-Technology.<br />
Diese Technologie ist nach dem<br />
Prinzip eines Mini-Compartment-Systems<br />
aufgebaut: Die Dichtungsmembran ist mit<br />
einer gitternetzartigen Struktur geprägt,<br />
die wiederum mit einem speziellen Dichtstoff<br />
gefüllt ist. Kommt es zu einer Beschädigung<br />
der Dichtungsmembran, wird<br />
das Wasser innerhalb eines kleinen Teilbereichs<br />
gehalten und kann die Dichtungsbahn<br />
nicht hinterwandern. Ein Wassereintritt<br />
in das Bauwerk kann nur im sehr<br />
seltenen Fall auftreten, nämlich wenn ein<br />
Riss oder eine Fehlstelle im Beton<br />
deckungsgleich mit der Beschädigung in<br />
der Membran ist. Aber auch in solch einem<br />
Fall kann die Sanierung sehr einfach<br />
mittels Bohrpackerinjektionen erfolgen.<br />
Die Dichtungsbahn kann sowohl im Neubau<br />
als zur Sanierung, beispielsweise für<br />
die Ausbildung einer Innenwanne eingesetzt<br />
werden. Außerdem kann sie auch für<br />
die partielle Abdichtung als zusätzliche<br />
Sicherung bei rissanfälligen Bauteilen<br />
verwendet werden.<br />
Auf der Betonageseite ist die Membran<br />
mit einen Vlies kaschiert und wird<br />
vor der Betonage in die Schalung oder<br />
auf der Sauberkeitsschicht ausgelegt. Im<br />
Fertigteilwerk wird die Bahn auf die entsprechenden<br />
Wandflächen vorkonfektioniert<br />
und auf dem Schalwagen ausgelegt.<br />
Bei der anschließenden Betonage<br />
Fotos: Sika Deutschland GmbH<br />
penetriert der Frischbeton in das Vlies<br />
und haftet mit Erhärten mechanisch auf<br />
dem Bauwerk - aufgrund der flächigen<br />
Verkrallung.<br />
Neben dem flächigen Verbund und<br />
dem Hinterlaufschutz bieten solche Systeme<br />
vor allem bauphysikalische und<br />
wirtschaftliche Vorteile. Im Gegensatz<br />
zur wasserundurchlässigen Bauweise<br />
handelt es sich hier um eine wasserdichte<br />
Bauweise: Nach dem Austrocknen der<br />
Betonrestfeuchte ist kein weiterer<br />
Feuchteeintrag mehr von außen möglich.<br />
Dies ist vor allem bei Wohnräumen,<br />
Archiven, Technik- und EDV-Zentralen<br />
von enormer Wichtigkeit, da hier ein<br />
möglichst trockenes Raumklima herrschen<br />
muss.<br />
Höchste Sicherheit mit modernen aufeinander<br />
abgestimmten Abdichtungskomponenten:<br />
SikaProof A und Tricoflex.<br />
Die hochflexiblen rissüberbrückenden<br />
Eigenschaften der FPO-Dichtmembran<br />
lassen eine Reduzierung der rissbegrenzenden<br />
Bewehrung bis 1 mm Rissweite<br />
bei der Berechnung der Bauteile zu.<br />
Ebenso sind die in der WU-Richtlinie geforderten<br />
Mindestbauteilstärken nicht erforderlich.<br />
Nach Fertigstellung der im<br />
Ortbeton hergestellten Bodenplatte, können<br />
die im Fertigteilwerk mit Dichtungsbahn<br />
ausgestatteten Wände gestellt und<br />
ggf. ausbetoniert werden. Durchführungen,<br />
Sonderdetails, Spannstellen sowie<br />
die Arbeits- und Dehnfugen werden im<br />
Nachgang mit dem Tricoflex-Abklebesystem<br />
geschlossen. Bei diesem System<br />
wird eine TPE-Dichtmembran beidseitig<br />
der Fuge in ein Epoxydharzkleberbett<br />
eingeklebt. Somit kann der gesamte Fugenverlauf<br />
geschlossen abgedichtet<br />
werden.<br />
Nach Fertigstellung aller Arbeitsgänge<br />
ist das Bauwerk allumfassend in eine geschlossene<br />
und dichte Hülle gebettet.<br />
Sämtliche Detailpunkte und Übergänge<br />
sind in Funktionsprüfungen nachgewiesen<br />
und mit einem allgemein bauaufsichtlichen<br />
Prüfzeugnis belegt.<br />
Der Bauherr erhält mit SikaProof A<br />
nicht nur eine hochwertige, sondern<br />
auch in vollem Umfang geprüfte Bauwerksabdichtung<br />
der neuesten Generation.<br />
Marcus Rybarski, www.sika.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 63<br />
CAPAROL Ausgewählte Produktinformationen<br />
Eckerförder Genossenschaft strebt höhere Energieeffizienz an<br />
Sie setzt dabei auch auf Fassadendämmung - Klinkeroptik und Capapor-Profile<br />
Das Ostseebad Eckernförde hat vier<br />
Kilometer Strand, rund 23.000 Einwohner<br />
und eine ansehnliche Wohnbebauung.<br />
Jede dritte Mietwohnung<br />
in der Stadt gehört dem Gemeinnützigen<br />
Wohnungsunternehmen (GWU)<br />
Eckernförde, einer eingetragenen Genossenschaft,<br />
die 1920 gegründet<br />
wurde und seitdem auf dem regionalen<br />
Wohnungsmarkt eine führende<br />
Position behauptet.<br />
Die Gemeinnützigkeit ist ihr, dem<br />
Nachkriegskind, in die Wiege gelegt worden.<br />
Den Menschen in schwierigen Zeiten<br />
ein Dach über dem Kopf zu geben,<br />
war und bleibt ihre vordringlichste und<br />
vornehmste Aufgabe. Seit seiner Gründung<br />
hat das Unternehmen in Eckernförde<br />
und Umgebung mehr als 3.600<br />
Wohnungen gebaut. Die meisten davon<br />
stammen aus den 50er und 60er Jahren.<br />
Es sind massive Mehrfamilienhäuser mit<br />
Verblendmauerwerk in der Tradition der<br />
Küstenregion. Ältere Wohngebäude aus<br />
den 30er Jahren mit ihrer defizitären<br />
Bausubstanz und Ausstattung werden<br />
schrittweise durch Neubauten ersetzt.<br />
Denn die Nachfrage nach modernen<br />
Mietwohnungen ist groß und die Ansprüche<br />
an den Wohnkomfort sind gewachsen.<br />
Der Bestand der Eckernförder Genossenschaft<br />
beträgt derzeit 2.300 Wohnungen<br />
mit 144.000 m 2 Wohnfläche. Vorstandsmitglied<br />
Stephan Seliger unterstreicht,<br />
dass es sich dabei um zukunftsfähige<br />
Wohnbauten handelt, die künftigen<br />
Ansprüchen an modernes Wohnen<br />
gerecht werden. Aus heutiger Sicht beschränke<br />
sich Gemeinnützigkeit nicht<br />
mehr nur auf die Versorgung breiter Bevölkerungskreise<br />
mit der Mangelware<br />
Wohnraum, sondern schließe die Hochwertigkeit<br />
des Angebots ein. Deshalb gehe<br />
Instandsetzung und Sanierung immer<br />
mit Modernisierung einher. Zwischen<br />
fünf und sieben Millionen Euro investiert<br />
die Genossenschaft jährlich in den Gebäudebestand.<br />
Es ist Geld, das sie auf<br />
der Grundlage einer soliden Finanzpolitik<br />
selbst erwirtschaftet hat. Die Umlage<br />
von Kosten für Modernisierungsmaßnahmen<br />
auf die Mieter bleibt unter dem<br />
gesetzlich festgelegten Limit.<br />
Der Modernisierungsstrategie der<br />
Wohnungsgenossenschaft liegt die Klas-<br />
sifizierung des Wohnungsbestandes zu<br />
Grunde, die die Spreu vom Weizen<br />
trennte. Das ermöglicht, Mittel und Kräfte<br />
zunächst auf die Quartiere zu konzentrieren,<br />
die von Bausubstanz und Wohnqualität<br />
her die besten Perspektiven besitzen<br />
und langfristige Vermietung versprechen.<br />
Wie vom Leiter Technik der<br />
GWU Kay Simon zu hören, rückte in<br />
jüngster Vergangenheit bei den Planungen<br />
die energetische Sanierung immer<br />
mehr in den Vordergrund, trägt sie doch<br />
den Wünschen der Mieter nach niedrigen<br />
Betriebskosten und der Aufwertung<br />
der Quartiere durch damit verbundene<br />
bauliche Maßnahmen Rechnung. Die<br />
angestrebten Effekte orientieren sich an<br />
den Maßstäben, die durch die Energieeinspar-Verordnung<br />
(EnEV) 2009 gesetzt<br />
sind. Bei der Bestandssanierung<br />
hat die GWU das KfW-Effizienzhaus 100<br />
bis 70 mit jährlich maximal 70 kWh/m2 ,<br />
beim Neubau das Passivhaus-Niveau im<br />
Visier. Zu statten kommt dem Wohnungsunternehmen<br />
in diesem Zusammenhang,<br />
dass in der Region die Kraft-<br />
Wärme-Kopplung hoch im Kurs steht<br />
und die Stadtwerke Eckernförde auf<br />
Blockheizkraftwerke (BHKW) setzen, die<br />
die Wohnquartiere effizient mit Strom<br />
und Wärme versorgen können und damit<br />
einen Beitrag zur Verdrängung des<br />
Atomstroms leisten. Wo die Dächer es<br />
hergeben, wie in der Bürgermeister-<br />
Heldmann-Straße, sorgen Photovoltaik-<br />
Anlagen für eigene Stromerzeugung.<br />
Insgesamt sind es bisher 1.000 m2 Dachfläche.<br />
Fassaden mit freundlicherem Gesicht<br />
Die zweite, nicht weniger wichtige<br />
Komponente höherer Energieeffizienz<br />
von Wohngebäuden ist die Verbesserung<br />
der Qualität der Gebäudehülle. An<br />
dafür in Frage kommenden Systemen<br />
herrscht auf dem Markt kein Mangel,<br />
doch nicht immer halten technischer<br />
Sachverstand und Service mit dem Niveau<br />
der Produkte Schritt. Kay Simon<br />
suchte deshalb den Kontakt zu Verkaufsberater<br />
Guntram Fischer des namhaften<br />
Herstellers Caparol, der auf diesem<br />
Gebiet aus einem umfangreichen<br />
technischen Potenzial schöpfen kann<br />
und an sein Sortiment höchste Maßstäbe<br />
anlegt. Mit auf die spezifischen<br />
Fotos: Caparol Farben Lacke Bautenschutz / Martin Duckek<br />
Bedingungen der Wohnquartiere zugeschnittenen<br />
Capatect Wärmedämm-Verbundsystemen<br />
und den für die Wiederherstellung<br />
von Klinkerfassaden wie geschaffenen<br />
Meldorfer Flachverblendern<br />
in unterschiedlichen Farben und Formaten<br />
offerierte der Caparol-Berater effiziente<br />
Lösungen, die den Vorstellungen<br />
des Unternehmens weitgehend entsprachen.<br />
„Nicht zuletzt das äußere Erscheinungsbild<br />
und das Umfeld machen ein<br />
Wohnquartier zu einer gefragten Adresse",<br />
sagte dazu der Technische Leiter.<br />
Bei der Farbgestaltung erhielt die Genossenschaft<br />
durch das Caparol-Farb-<br />
DesignStudio Unterstützung, das die<br />
Vorgaben der Praktiker in Farbentwürfe<br />
umsetzte, die „fortgeschrieben" und an<br />
Hand von Farbtafeln auf ihre Tauglichkeit<br />
überprüft wurden. Eine Abrundung erfuhr<br />
das Caparol-Angebot durch leichtgewichtige<br />
Capapor-Profile, mit denen<br />
unter anderem Klinkerfassaden von hellen<br />
Putzflächen abgesetzt wurden.<br />
In der Ausschreibung ging der Zuschlag<br />
an Malereibetriebe aus der Region.<br />
Sie erhielten bei der Einarbeitung<br />
Unterstützung durch Instandhaltungstechniker<br />
des Herstellers, die ihnen mit<br />
Rat und Tat zur Seite standen. Das war<br />
zum Beispiel der Fall, wenn an der Fassade<br />
größere Unebenheiten ausgeglichen<br />
werden mussten. Architekt Simon<br />
hob das Bemühen der Caparol-Fachleute<br />
hervor, durch die Einflussnahme auf<br />
die Qualität der Verarbeitung die Nachhaltigkeit<br />
der baulichen Maßnahmen abzusichern.<br />
Mit dem Ergebnis der Modernisierung,<br />
die ihnen neben einem angenehmeren<br />
Wohnklima und geringeren<br />
Heizkosten unter anderem neugestaltete<br />
Treppenhäuser oder großzügigere<br />
Balkone beschert hat, sind die<br />
Mieter zufrieden - auch wenn sie sich<br />
daran mit 1,25 Euro/m2 beteiligen<br />
müssen. Nicht weniger zufrieden ist<br />
Vorstand Stephan Seliger - auch wenn<br />
noch 40 bis 50 Prozent des Wohnbestandes<br />
zu modernisieren sind.<br />
Wolfram Strehlau, www.caparol.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 64<br />
Ausgewählte Produktinformationen ECONTROL<br />
Energetisch modernisiert mit »Sonnenbrille«<br />
Niedrige Klimatisierungskosten, blendfreier Ausblick, stets optimale Lichtverhältnisse<br />
Das Haus der Architekten in Stuttgart<br />
ist ein Forum für Baukultur und<br />
Sitz der Architektenkammer Baden-<br />
Württemberg. Das verglaste Foyer<br />
wurde jetzt umfangreich modernisiert.<br />
Einzelne Scheiben waren im<br />
Randverbund undicht und trüb geworden,<br />
Wasser drang ein. Außerdem<br />
war der im Inneren angebrachte<br />
Blendschutz wartungsintensiv und<br />
behinderte die freie Durchsicht.<br />
Die komplexen Anforderungen an<br />
die Modernisierung: Klimatisierungskosten<br />
senken, Lichtverhältnisse verbessern,<br />
blendfreie Ausblicke ohne<br />
Verschattung. Der Bauherr entschied<br />
sich für elektro-chromes Dreifach-<br />
Sonnenschutzglas der Firma EControl<br />
(Plauen). Es ist dimmbar und ermöglicht<br />
so das Variieren des g-Werts<br />
und der Lichtdurchlässigkeit je nach<br />
Sonneneinstrahlung. So entfällt die<br />
außenliegende Verschattung ebenso<br />
wie ein Blendschutz.<br />
Das Gebäude liegt in exponierter<br />
Halbhöhenlage und bietet einen außergewöhnlichen<br />
Blick über Stuttgart. Vor<br />
gut zwei Jahrzehnten erwarb der Eigentümer,<br />
das Versorgungswerk der Architekten,<br />
ein Nachbargrundstück hinzu<br />
und lobte einen Wett-bewerb für den<br />
Neubau aus: Geplant und gebaut von Architekt<br />
Michael Weindel (Waldbronn),<br />
entstand das dreiteilige Ensemble aus<br />
Wohn-, Veranstaltungs- und Verwaltungsgebäude.<br />
Der runde Veranstaltungstrakt<br />
liegt als Sonderbauteil im<br />
Zentrum und schließt transparent und filigran<br />
mit verglastem Foyer an das Verwaltungsgebäude<br />
an. So blieb der grandiose<br />
Durchblick auf die Stuttgarter Silhouette<br />
von der Danneckerstraße her erhalten.<br />
Undichtigkeiten und Wasser:<br />
Sanierung gefragt<br />
Seit einiger Zeit traten bei einzelnen<br />
Scheiben Undichtigkeiten im Randverbund<br />
auf, die Scheiben wurden trüb. Zusätzlich<br />
fand immer wieder Wasser seinen<br />
Weg durch das verglaste Dach. Die<br />
Zweifach-Sonnenschutzverglasung entsprach<br />
nicht mehr den heutigen Anforderungen<br />
an die Klimatisierung des Foyers.<br />
Fotos: Dipl.-Ing. Michael Pauls, Stuttgart<br />
Foto: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Treitz, Stuttgart<br />
Das Innere des Foyers verbindet Innen<br />
und Außen. Im Bild gut erkennbar: Die<br />
Dach- und Fassadenverglasung von<br />
EControl befinden sich in einem unterschiedlichen<br />
Dimmzustand.<br />
Das Architekturbüro Pauls (Stuttgart)<br />
erhielt den Auftrag, das verglaste Foyer<br />
zu modernisieren. Ziele: Architektur erhalten,<br />
Nutzerkomfort erhöhen, moderate<br />
Betriebskosten für die Klimatisierung.<br />
Ein äußerer Sonnenschutz schied ebenso<br />
aus wie der innere Blendschutz - der<br />
ungehinderte Ausblick sollte jederzeit<br />
möglich sein. Herkömmliches Sonnenschutzglas<br />
mit niedrigem aber auch fixem<br />
g-Wert wurde nicht in Betracht gezogen,<br />
da es an trüben Tagen zu wenig<br />
Licht in die Räume lässt.<br />
Intelligente Lösung:<br />
dimmbarer Sonnenschutz<br />
Unter Abwägung der Parameter brachte<br />
der Architekt ein elektrochromes<br />
Sonnenschutzglas (EControl) in die Dis-<br />
Das Haus der Architekten, Stuttgart: Transparentes Zentrum für<br />
Architekten, Baufachleute und bauinteressierte Bürger.<br />
kussion. Es ermöglicht durch dimmbare<br />
Scheiben das Justieren des g-Wertes<br />
und des Blendschutzes - angepasst an<br />
die tatsächliche Lichtintensität. „Scheint<br />
keine Sonne, bleibt das Glas maximal<br />
hell und transparent. Je intensiver sie<br />
scheint, desto dunkler wird es getönt, bis<br />
zu einem tiefen Blau - ähnlich einer photochromen<br />
Skibrille“, erläutert Dipl.-Ing.<br />
Michael Pauls, freier Architekt und Inhaber<br />
des Architekturbüros. Photochrome<br />
Sonnenbrillen ermöglichen einen Verzicht<br />
auf einen zusätzlichen Sonnenschutz<br />
für die Augen und bieten darüber<br />
hinaus einen ermüdungsfreien Durchblick,<br />
der sich der Lichtintensität anpasst.<br />
Das dimmbare Sonnenschutzglas E-<br />
Control überträgt das Prinzip mit elektrochromer<br />
Technik auf die moderne Architektur.<br />
Als modernes Dreifach-Isolierglas<br />
isoliert EControl mit einem Ug-Wert von<br />
0,7 W/(m2K) ausgezeichnet gegen Heizwärmeverluste.<br />
Die gesamten Modernisierungsmaßnahmen<br />
wurden - bei eingeschränktem<br />
Betrieb des Forums Haus<br />
der Architekten - im Sommer in nur 12<br />
Wochen durch den Fassadenbauer<br />
Guttendörfer (Ansbach) durchgeführt<br />
und im Herbst 2011 abgeschlossen.<br />
Bautafel:<br />
Architektenkammer Baden-Württemberg,<br />
Stuttgart<br />
Objektadresse: Danneckerstraße 54,<br />
70182 Stuttgart<br />
Bauherr: Versorgungswerk der Architekten,<br />
Stuttgart<br />
Architekt: Dipl.-Ing. Michael Pauls,<br />
Stuttgart<br />
Fassadenbauer: Aug. Guttendörfer<br />
GmbH & Co. KG, Stahlstraße 8,<br />
91522 Ansbach<br />
Glasprodukt: EControl<br />
Glashersteller: EControl-Glas, Plauen<br />
www.econtrol-glas.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 65<br />
FRANKE AQUAROTTER Ausgewählte Produktinformationen<br />
Die weiterentwickelten Sanitärmodule<br />
von Franke stehen für ein innovatives,<br />
ästhetisches Ausstattungskonzept<br />
im Objektbau, das keine<br />
Wünsche an Komfort und individuellem<br />
Gestaltungsspielraum offen lässt.<br />
Aufgrund dieser Kriterien bietet sich<br />
die Kombination mit dem vom gleichen<br />
Hersteller entwickelten Wassermanagementsystem<br />
AQUA 3000 open zwingend<br />
an.<br />
Das intelligente Wassermanagementsystem<br />
der dritten Generation basiert auf<br />
einer innovativen Elektronikplattform.<br />
AQUA 3000 open wird konsequent in<br />
Technologie trifft Design<br />
Innovatives Wassermanagement inklusive<br />
zwei Ebenen - Armaturen und Netzwerk<br />
- gegliedert, die jeweils über eine standardisierte<br />
Datentechnologie miteinander<br />
kommunizieren. Entsprechend konfigurierte<br />
Armaturen unterschiedlicher<br />
Funktionalität lassen sich automatisch<br />
steuern und sorgen für ein Höchstmaß<br />
an Hygiene und Wirtschaftlichkeit.<br />
Die kompakten Module setzen sich<br />
aus Installationselementen und Funktionseinheiten<br />
zusammen. In den ver-<br />
Ermöglichen ästhetische Sanitärraumausstattung - die weiterentwickelten All-in-one<br />
Waschplatzmodule (Wasser/Seife/Luft) mit Nischenwaschtisch QUADRO und Glasbeplankung<br />
aus Einscheiben-Sicherheitsglas.<br />
Ein intelligentes Elektronikmodul steuert<br />
bei den in den Sanitärmodulen installierten<br />
Armaturen die wichtigsten Abläufe<br />
entsprechend der Armaturenfunktionalität.<br />
schiedenen Funktionseinheiten für<br />
Waschplätze, WC- und Urinalanlagen<br />
sind sämtliche Steuerungs- und Armaturenkomponenten<br />
netzwerkfähig integriert.<br />
Opto-elektronische Sensoren sorgen<br />
für die berührungslose und absolut<br />
hygienische Abgabe von Wasser, Seife,<br />
Luft am Waschtisch sowie bei der WCund<br />
Urinalspülung.<br />
Bei den installierten Armaturen werden<br />
die wichtigsten Abläufe entsprechend<br />
der Armaturenfunktionalität über ein intelligentes<br />
Elektronikmodul gesteuert.<br />
Mit diesem integrierten Elektronikbaustein<br />
und in Kombination mit dem ECC-<br />
Funktionscontroller (Ethernet-Can-Coppler)<br />
sind z.B. zeit- oder temperaturgesteuerte<br />
Hygienespülungen, thermische<br />
Desinfektionen, Betriebsartenum- und<br />
Reinigungsabschaltungen möglich. Die<br />
Netzwerkebene bietet mittels PC und<br />
Software zusätzliche Funktionalitäten<br />
und Systemerweiterungen. Hier kann<br />
das System mit Hilfe einer innovativen<br />
Software beliebig viele Sanitärarmaturen<br />
zentral steuern und verwalten.<br />
Zum Fertigbauset der All-in-one Sanitärmodule<br />
gehört ein Beplankungs-Modul,<br />
bei dem zwischen den hochwertigen<br />
Materialien Glas und gebürstetem Edelstahl<br />
gewählt werden kann. Das 8 mm<br />
Fotos: Franke Aquarotter<br />
Diese Beplankung der All-in-one Module<br />
(hier WC) besteht aus 8 mm Einscheiben-<br />
Sicherheitsglas. Aber auch andere Farben<br />
und/oder Materialien sind auf Wunsch<br />
realisierbar. (All-in-one WC-Modul mit<br />
CMPX592W und PROTRONIC - A 3000<br />
open WC-Spülarmatur »AQUA505«)<br />
All-in-one Urinal-Modul mit Keramik-Urinal<br />
und opto-elektronischer Spülsteuerung<br />
AQUA 3000 open.<br />
dicke Einscheiben-Sicherheitsglas ist in<br />
den Farben bordeaux, schwarz, weiß/<br />
grün erhältlich. Andere Farben und/oder<br />
Materialien sind auf Wunsch realisierbar.<br />
Die neuen Franke-Sanitärmodule können<br />
mit Sanitärobjekten aus Mineralgranit,<br />
Keramik oder Edelstahl kombiniert<br />
werden. Das All-in-one-Konzept zeigt,<br />
dass auch in öffentlichen Sanitäranlagen<br />
Begriffe wie Qualität und optischer Anspruch<br />
keine Fremdwörter sein müssen.<br />
www.franke.de
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:47 Uhr Seite 66<br />
Ausgewählte Produktinformationen INTER Versicherungsgruppe<br />
Neue Krankenvollversicherung<br />
INTER QualiMed ® : flexibel, transparent, leistungsstark - für alle Lebensphasen<br />
Zeiten ändern sich, Menschen ändern<br />
sich, Bedürfnisse ändern sich:<br />
In einer immer schnelllebigeren Welt<br />
ist es nicht nur wichtig, den Überblick<br />
zu behalten sondern auch, dass das<br />
Leben begleitende Dinge sich flexibel<br />
den individuellen Bedürfnissen anpassen.<br />
Das gilt besonders für Versicherungen,<br />
die oft zu einem Zeitpunkt<br />
abgeschlossen werden, an dem man<br />
noch gar nicht weiß, wohin die Reise<br />
des Lebens geht. Umso wichtiger ist<br />
es, die Möglichkeit zu haben, auch<br />
nach Vertragsabschluss flexibel zu<br />
bleiben und Anpassungen vornehmen<br />
zu können. Auch und gerade im<br />
Bereich der Krankenvollversicherung,<br />
die den Kunden ein Leben lang<br />
begleitet.<br />
Mit der neuen Krankenvollversicherung<br />
INTER QualiMed ® hat die INTER<br />
Versicherungsgruppe ein Produkt geschaffen,<br />
das diesen hohen Anforderungen<br />
gerecht wird. Die unterschiedlichen<br />
Ansprüche an Preis, Leistung und Service<br />
finden sich in einem Dreistufenmodel,<br />
innerhalb dessen es variable Preisgestaltungs-<br />
und Wechselmöglichkeiten<br />
gibt. Basis, Exklusiv und Premium sind<br />
drei Tarifvarianten, die individuelle Leistungen<br />
bieten und die einen späteren<br />
Wechsel untereinander zulassen. Kombiniert<br />
mit jeweils drei unterschiedlichen<br />
Selbstbehaltstufen, ergeben sich noch<br />
mehr Auswahlmöglichkeiten.<br />
INTER QualiMed ® Basis -<br />
Die Krankenversicherung für den<br />
perfekten Start!<br />
Bereits der INTER QualiMed ® Basis<br />
zeigt ein hohes Leistungsniveau, das<br />
ganz besonders auf die Bedürfnisse junger<br />
Menschen und Familien ausgerichtet<br />
ist. Gerade in der beruflichen und privaten<br />
Aufbauphase bietet die Basisvariante<br />
hervorragende Leistungen.<br />
INTER QualiMed ® Exklusiv -<br />
Die Krankenversicherung mit dem<br />
gewissen Extra!<br />
Der Exklusivbereich bietet ein hohes<br />
Leistungsniveau, das ganz besonders<br />
auf die individuellen Bedürfnisse einer<br />
ganzen Familie ausgerichtet ist.<br />
INTER QualiMed ® Premium -<br />
Die Krankenversicherung für die<br />
höchsten Ansprüche!<br />
Für die Phase, in der die höchsten Ansprüche<br />
an den Krankenschutz und die<br />
Gesundheitsvorsorge gestellt werden, ist<br />
der INTER QualiMed ® Premium zu empfehlen.<br />
Im Premiumbereich ist das höchste<br />
Leistungsniveau zu finden, das der<br />
INTER QualiMed ® zu bieten hat.<br />
„Wie bei all unseren Produkten, liegt<br />
auch bei INTER QualiMed ® ein ganz besonderes<br />
Augenmerk auf hervorragen-<br />
Foto: Inter<br />
der Qualität und umfangreichem Service.<br />
Der Kunde darf von uns deshalb<br />
nicht nur besondere Leistungen sondern<br />
auch ein für ihn hilfreiches und sinnvolles<br />
Serviceangebot erwarten“, unterstreicht<br />
Peter Thomas. „Im Übrigen ist<br />
die Einführung einer neuen Krankenvollversicherung<br />
zum jetzigen Zeitpunkt<br />
auch ein klares Bekenntnis der INTER<br />
zur Privaten Krankenversicherung und<br />
damit zum dualen System in Deutschland.“<br />
Neben der Flexibilität spielen natürlich<br />
auch Leistung und Transparenz bei einer<br />
Krankenvollversicherung eine wichtige<br />
Rolle. Und da punktet INTER QualiMed ®<br />
ganz besonders: Die transparenten Bedingungen<br />
lassen wenige Fragen offen.<br />
Und wenn doch, dann stehen die Experten<br />
der INTER Versicherungsgruppe jederzeit<br />
zur Verfügung. Rund um die Uhr<br />
und immer mit einem offenen Ohr. Zudem<br />
erwartet den Kunden ein moderner<br />
und umfangreicher Leistungskatalog:<br />
• Leistungen bei Bezug von Elterngeld<br />
in Höhe von bis zu 6 Monatsbeiträgen.<br />
• Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen<br />
und professionelle Zahnreinigung<br />
sind sinnvoll und wichtig. Deshalb<br />
werden diese nicht auf den<br />
Selbstbehalt angerechnet. Zudem beeinflussen<br />
sie auch nicht den Anspruch<br />
auf eine Beitragsrückerstattung.<br />
• Hohe Beitragsrückerstattung (BRE)<br />
bei Leistungsfreiheit. Je 3 maßgebliche<br />
Monatsbeiträge in den ersten 3<br />
vollen Kalenderjahren. Maximale BRE<br />
bis zu 6 maßgebliche Monatsbeiträge<br />
nach 7 leistungsfreien Jahren.<br />
• Das Optionsrecht bietet die Möglichkeit,<br />
zum Ende des 3., 5. und 10. Versicherungsjahres<br />
sowie bei Wechsel<br />
der beruflichen Tätigkeit ohne erneute<br />
Gesundheitsprüfung und Wartezeiten<br />
in jeden INTER QualiMed ® -Tarif umzustellen.<br />
• Überdurchschnittliche Erstattung im<br />
Zahnbereich.<br />
• Offener Heil- und Hilfsmittelkatalog.<br />
• 100% Erstattung für Behandlung<br />
durch Ärzte mit naturheilkundlichen<br />
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden,<br />
die im Hufeland-Verzeich-<br />
nis und im Gebührenverzeichnis für<br />
Heilpraktiker aufgeführt sind. (in den<br />
Tarifstufen Exklusiv und Premium).<br />
• Besonderheit: Erstattung von ver<br />
schreibungspflichtigen Verhütungsmitteln.<br />
• Zahlreiche medizinische Assistance-<br />
und Serviceleistungen wie INTER<br />
Service-Center, Gesundheitsexperte,<br />
Gesundheits-SOS, Gesundheitsmanagement<br />
gehören zu INTER<br />
QualiMed ® .<br />
• Selbstbeteiligung pro Kalenderjahr für<br />
ambulante und zahnärztliche Heilbehandlung.<br />
Partner des Handwerks<br />
Als traditioneller Handwerksversicherer<br />
kennt die INTER Versicherungsgruppe<br />
die Bedürfnisse der Menschen im<br />
Handwerk ganz genau und punktet mit<br />
individuellen Lösungen. Für die tägliche<br />
Arbeit ist selbstverständlich: Flexibel<br />
sein, auf die Wünsche des Kunden eingehen,<br />
verständlich kommunizieren und<br />
schließlich eine Leistung auf bestem Niveau<br />
erbringen.<br />
Ihr Ansprechpartner in der Geschäftsstelle<br />
<strong>Berlin</strong> ist Herr Lie Milbratt,<br />
Telefon: 030 / 235 165 10.<br />
www.inter.de