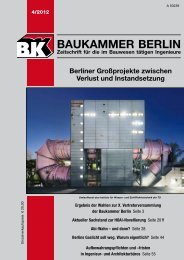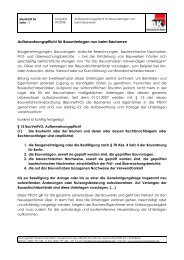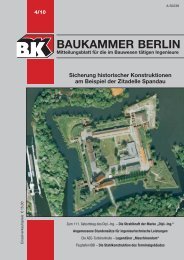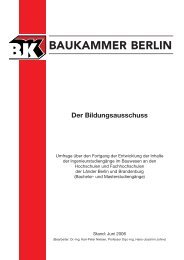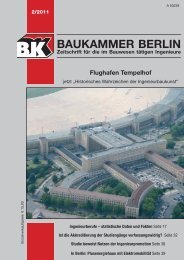BK-Heft 2/2012 - Baukammer Berlin
BK-Heft 2/2012 - Baukammer Berlin
BK-Heft 2/2012 - Baukammer Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bau 2-12 Umbruch 3 20.06.<strong>2012</strong> 14:46 Uhr Seite 46<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Friedrich II, König von Preußen und das Bildungssystem<br />
Wir begehen in diesem Jahr den 300.<br />
Geburtstag von Friedrich II König von<br />
Preußen (24.1.1712 bis 17.8.1786).<br />
Schnell waren wir uns im <strong>Baukammer</strong>ausschuss<br />
Denkmalschutz einig, dass<br />
wir anlässlich dieses Jubiläums zu ausgewählten<br />
„Friedrich Themen“ im <strong>Baukammer</strong>heft<br />
veröffentlichen wollen.<br />
Es gehört zu den allgemein bekannten<br />
Verdiensten Friedrichs, dass er das preußische<br />
Bildungssystem reformiert und<br />
hunderte von Schulen hat bauen lassen.<br />
Die sich nun anschließende Recherche<br />
gab jedoch Anlass, seine Verdienste differenziert<br />
zu betrachten.<br />
Als einer der wichtigsten Förderer des<br />
Schulwesens in deutschen Landen verordnete<br />
am 28. Oktober 1717 der preußische<br />
König Friedrich Wilhelm – also<br />
Friedrichs Vater – das „Edikt zur allgemeinen<br />
Schulpflicht“. „Wir vernehmen<br />
missfällig und wird verschiedentlich von<br />
denen Inspectoren und Predigern bey<br />
Uns geklaget, dass die Eltern, absonderlich<br />
auf dem Lande, in Schickung ihrer<br />
Kinder zur Schule sich sehr säumig erzeigen,<br />
und dadurch die arme Jugend in<br />
grosse Unwissenheit, so wohl was das<br />
lesen, schreiben und rechnen betrifft, als<br />
auch in denen zu ihrem Heyl und Seligkeit<br />
dienenden höchstnötigen Stücken auffwachsen<br />
laßen.“[A]<br />
46 | <strong>Baukammer</strong> <strong>Berlin</strong> 2/<strong>2012</strong><br />
Dipl.-Ing. Sven Cordewinus<br />
Zu dieser Zeit (1717) gab es in Preußen<br />
nur 320 Dorfschulen. Am Ende der<br />
Regierungszeit König Friedrich Wilhelms<br />
im Jahr 1740 war die Anzahl der Schulen<br />
bereits auf 1480 angestiegen [A]. Es ist<br />
nicht davon auszugehen, dass es sich<br />
tatsächlich um mehr als 1000 Schulneubauten<br />
handelte. Obwohl der König das<br />
Baumaterial kostenlos zur Verfügung<br />
stellte, wurden im überwiegenden Teil<br />
der Landgemeinden vorhandene Räumlichkeiten<br />
für den Schulbetrieb genutzt.<br />
Eine effiziente und ordnungsgemäße<br />
Verwaltung, Steuererhebung und Militärorganisation<br />
ist nur möglich, wenn alle<br />
Beteiligten (Bürger, Bauern und Verwaltung)<br />
lesen und schreiben können. Daher<br />
sollte jedes Kind (nicht nur Jungen sondern<br />
auch Mädchen) am Ende der Schulzeit<br />
lesen und schreiben sowie den Katechismus<br />
auswendig können. (Katechismus:<br />
Handbuch zur Unterweisung in<br />
christlichen Fragen)<br />
Zu seinem Regierungsantritt 1740 konnte<br />
Friedrich II daran anknüpfen und die<br />
Bemühungen seines Vaters fortsetzen.<br />
In einem Edikt vom 13.10.1740 erließ er:<br />
„…wie in Preußen verschiedene Leute<br />
sich in dem Sinn kommen ließen, als ob<br />
es nunmehr bei dem Kirchen-, Universitäts-<br />
und Schulwesen wieder auf den<br />
alten unordentlichen Fuß komme - alle<br />
Abb 1 „Preußischer Schulmeister“ Johann Peter Hasenclever, Öl, 1846 [A]<br />
von seines in Gott ruhenden Herrn Vaters<br />
Majestät in Schulsachen erlassenen<br />
Befehle und Reglements, daß selbige in<br />
der völligen Kraft, Autorität und Verbindlichkeit<br />
sein und bleiben sollten.“ (1) S.<br />
10.<br />
In diesem Sinne ermahnte der König am<br />
29.10.1741 seine Adligen und erinnerte<br />
sie an die „Pflicht … sich der Schulen in<br />
ihren Dörfern mit Eifer anzunehmen“ Er<br />
befahl „… daß in der Zeit von einem halben<br />
Jahr die nötigen Schulen in den adligen<br />
Dörfern gebaut sein sollten“. (1) S.9<br />
Er ordnete strenge Kontrollen durch seine<br />
Amtshauptleute an, die entsprechende<br />
Nachweise zu fordern hatten. Es half<br />
nichts. Der Befehl wurde bis auf wenige<br />
Ausnahmen einfach ignoriert. Die Schlesischen<br />
Kriege (1740 - 42, 1744/45)<br />
erforderten andere Prioritäten.<br />
Die eingerichteten Schulen waren – wir<br />
würden heute sagen – „chronisch unterfinanziert“.<br />
Für den Betrieb der Schulen<br />
waren auf den Adelsgütern die Adligen<br />
und nur auf den landeseigenen Domänengütern<br />
der Staat verantwortlich.<br />
Die Bezahlung der Schuldiener (Lehrer)<br />
war schlecht und reichte nicht zum Überleben.<br />
Die Ausübung von Nebenerwerben<br />
war überlebensnotwendig und<br />
üblich. Die Schulmeister waren oftmals<br />
gleichzeitig Küster, Schneider und/oder<br />
sie züchteten Seidenraupen oder Ziegen<br />
(im Volksmund die „Beamtenkuh“). Die<br />
Unterkunft erfolgte meistens im Schulhaus<br />
– oft in Kombination als Schul- und<br />
Bethaus mit kleinem angegliedertem<br />
Stall. Das Gemälde des Johann Peter<br />
Haase von 1846 zeigt im Stil der Romantik<br />
wie man sich den Schulbetrieb im 18.<br />
Jahrhundert vorstellen muss.<br />
Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges<br />
(1756 – 63) widmete sich Friedrich<br />
wieder dem Schulsystem. Während des<br />
Krieges bemerkte er, dass die „sächsischen<br />
Bauern meißt gebildeter und<br />
gewandter wären als die brandenburgischen“<br />
(2) S. 497 und schrieb dies dem<br />
besseren Unterricht zu.<br />
In der Einleitung des General=Landschul=Reglement<br />
vom 12.8.1763 stellte<br />
Friedrich fest „Demnach Wir zu Unserem<br />
höchsten Missfallen selbst wahrgenommen,<br />
daß das Schulwesen und die Erziehung<br />
der Jugend auf dem Lande bisher in