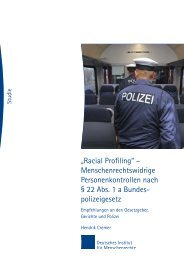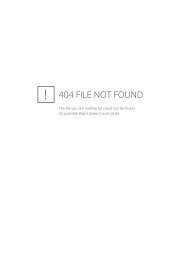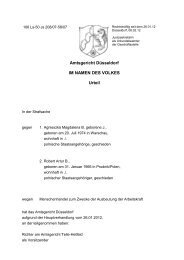B - Deutsches Institut für Menschenrechte
B - Deutsches Institut für Menschenrechte
B - Deutsches Institut für Menschenrechte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
34<br />
A<br />
Ein Menschenrechtsansatz gegen Menschenhandel – Internationale Verpflichtungen und Stand der Umsetzung in Deutschland<br />
Petra Follmar-Otto<br />
steigerte, über die normalen Schutz- und Gewährleistungsverpflichtungen<br />
hinausgehende Verpflichtungen<br />
insbesondere in der Ermächtigung der Betroffenen zur<br />
Durchsetzung ihrer Rechte. 123<br />
Die mit dem Frauenmenschenrechtskonzept verfolgte<br />
Ausweitung menschenrechtlicher Verantwortlichkeit<br />
der Staaten ist <strong>für</strong> Betroffene von Menschenhandel in<br />
zweierlei Hinsicht relevant: Einerseits ist Menschenhandel<br />
eine Form systematischer Gewalt und Rechtsverletzung<br />
in der privaten Sphäre, die menschenrechtliche<br />
Verpflichtungen des Staates zu Prävention, effektiver<br />
Strafverfolgung der Täter und Restitution der<br />
Betroffenen auslöst. Andererseits sind die meisten<br />
Betroffenen als Frauen und als Migrantinnen mit häufig<br />
prekärem Status in doppelter Hinsicht von dem ‚weißen<br />
männlichen Staatsbürger’ als typischen Rechtsträger<br />
des klassisch liberalen Menschenrechtsverständnis<br />
entfernt. Deswegen ist die Betonung der Verpflichtung<br />
zur Überwindung struktureller Diskriminierung <strong>für</strong> sie<br />
besonders bedeutsam.<br />
4.3.2 Menschenrechtliche Pflichtentrias:<br />
Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten<br />
Parallel zu den eben beschriebenen Einflüssen der Frauenrechtsbewegungen<br />
entwickelte sich, ausgehend von<br />
der Universalität und Unteilbarkeit der <strong>Menschenrechte</strong>,<br />
auch ein neues Verständnis staatlicher Verantwortlichkeit<br />
<strong>für</strong> die <strong>Menschenrechte</strong>. Es fand eine Abkehr von<br />
den klassischen Kategorien von Abwehr- und Leistungsrechten<br />
statt, die mit den bürgerlichen und politischen<br />
Rechten einerseits und den wirtschaftlichen, sozialen<br />
und kulturellen Rechten andererseits gleichgesetzt<br />
wurden. Stattdessen wurde nunmehr hervorgehoben,<br />
dass alle <strong>Menschenrechte</strong> gleichermaßen verschiedene<br />
Dimensionen staatlicher Verpflichtungen entfalten, die<br />
kurz als Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten<br />
(‚Pflichtentrias’) gekennzeichnet werden<br />
können. 124 Dadurch wurde einerseits die staatliche<br />
Verantwortung <strong>für</strong> systematische Formen von Rechtsverletzungen<br />
durch Private betont, 125 was die eben dargestellte<br />
frauenrechtliche Position stärkte, die Menschen-<br />
rechtsrelevanz auch der privaten Sphäre anzuerkennen.<br />
Zum anderen wurde durch die Aufwertung der sozialen<br />
und wirtschaftlichen Rechte und die Heraushebung des<br />
Diskriminierungsverbots auch die Frage ungleichen<br />
Zugangs zu wirtschaftlichen und sozialen Gütern und<br />
damit auch die ungleiche Möglichkeit zur tatsächlichen<br />
Ausübung aller <strong>Menschenrechte</strong> unterstrichen.<br />
Die menschenrechtliche Pflichtentrias verpflichtet den<br />
Staat als Adressaten der <strong>Menschenrechte</strong>, die <strong>Menschenrechte</strong><br />
der Betroffenen von Menschenhandel zu<br />
respektieren, sie vor Verletzungen auch durch Private<br />
zu schützen und einen Rahmen an <strong>Institut</strong>ionen und<br />
Verfahren zu gewährleisten, damit Betroffene ihre<br />
Rechte wahrnehmen und tatsächlich umsetzen können.<br />
Das Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit und die<br />
Rechte auf persönliche Freiheit, Bewegungsfreiheit, auf<br />
Privatheit und Selbstbestimmung sowie auf körperliche<br />
und psychische Unversehrtheit entfalten damit auf diesen<br />
drei Ebenen im Kontext von Menschenhandel eine<br />
Vielzahl von Verpflichtungen.<br />
4.3.3 Menschenhandel als Ausdruck<br />
rassistischer Diskriminierung<br />
Menschenhandel stellt zum einen – soweit Frauen und<br />
Mädchen betroffen sind – eine Form von Gewalt gegen<br />
Frauen und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts<br />
dar. Zudem wird Menschenhandel seit der 3. Weltkonferenz<br />
gegen Rassismus in Durban/Südafrika 2001<br />
zunehmend auch im Kontext von rassistischer Diskriminierung<br />
thematisiert. Im internationalen Menschenrechtsschutzsystem<br />
ist in den vergangenen Jahren eine<br />
verstärkte Aufmerksamkeit <strong>für</strong> rassistische Diskriminierung<br />
im Umgang der Staaten mit Nichtstaatsangehörigen<br />
entstanden. 126 Zwar wird das Recht der souveränen<br />
Staaten auf Migrationsregulierung und Grenzkontrolle<br />
anerkannt. Die Staaten dürfen diese Rechte jedoch<br />
nicht in diskriminierender Weise ausüben und müssen<br />
sicherstellen, dass Nicht-Staatsangehörigen nicht faktisch<br />
die Ausübung ihrer <strong>Menschenrechte</strong>, darunter die<br />
Rechte in der Arbeit und das Rechts auf Gesundheit,<br />
verwehrt wird.<br />
123 Vgl. die Verpflichtungen in Art. 4 c)-l) der Deklaration über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen von 1993 und den<br />
thematischen Bericht der Sonderberichterstatterin gegen Gewalt gegen Frauen, UN-Dok. E/CN.4/2000/68, 29.02.2000,<br />
Rn. 49–53.<br />
124 Nowak (2002), S. 62 ff. Zum Verständnis im Rahmen der EMRK: Grabenwarther (2005), S. 118 ff.; vgl auch die Praxis des<br />
Ausschusses <strong>für</strong> wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in seinen Allgemeinen Bemerkungen, inbes. Nr. 12 (Recht auf<br />
Nahrung), Rn. 14 ff.; Nr. 13 (Recht auf Bildung), Rn. 43 ff.; Nr. 14 (Recht auf Gesundheit), Rn. 30 ff.<br />
125 Wiesbrock (1999).<br />
126 Vgl. Durban Declaration and Programme of Action; UN-Antirassismusauschuss CERD: General Comment No. XXX: Non-<br />
Citizens (2004); UN-Frauenrechteausschuss CEDAW: General Recommendation No. 26: Women Migrant Workers (2008).