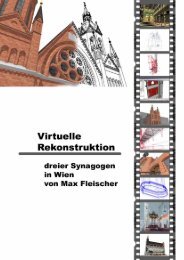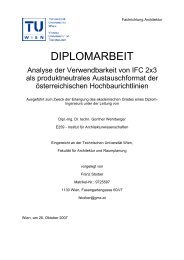Faktoren für Präsenz in virtueller Architektur
Faktoren für Präsenz in virtueller Architektur
Faktoren für Präsenz in virtueller Architektur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
HOLGER REGENBRECHT, BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR, 1999<br />
FAKTOREN FÜR PRÄSENZ IN VIRTUELLER ARCHITEKTUR PRÄSENZ IN REALEN<br />
UND VIRTUELLEN<br />
UMGEBUNGEN<br />
Er<strong>in</strong>nerung, e<strong>in</strong> Glauben an, e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Imag<strong>in</strong>ation etc. mental repräsentiert<br />
wird, entscheidend ist die mentale Repräsentation an sich. „What Meister Eckart<br />
believed about God could not be expressed <strong>in</strong> words ...“ (S. 432).<br />
Johnson-Laird begründet damit e<strong>in</strong>e kognitive Theorie, die es ermöglicht,<br />
räumliche Strukturen (kartesisch und strukturell) und damit auch die Relation<br />
des Selbst zum Raum <strong>in</strong> mentale Kategorien zu fassen.<br />
Bei Schnotz (1994) bilden mentale Modelle quasi-räumliche Modelle aus unterschiedlichen<br />
Perspektiven ab. Es können nebene<strong>in</strong>ander mehrere mentale<br />
Modelle aus gleichen und/oder unterschiedlichen Perspektiven entstehen. Diese<br />
Modelle werden durch „mapp<strong>in</strong>g“ aufe<strong>in</strong>ander bezogen, wobei Eigenschaften der<br />
e<strong>in</strong>zelnen Modelle <strong>in</strong> den anderen Modelle enthalten se<strong>in</strong> können oder nicht. Es<br />
ist somit <strong>für</strong> den Interpretierenden möglich, Geme<strong>in</strong>samkeiten und auch Inkonsistenzen<br />
zu erkennen.<br />
Das mentale Modell enthält alle Informationen, die <strong>für</strong> e<strong>in</strong> Ableiten (e<strong>in</strong> „Ablesen“)<br />
von Schlüssen notwendig s<strong>in</strong>d. Ob hier<strong>für</strong> implizites oder explizites Wissen<br />
und Regeln benötigt werden, ist an dieser Stelle nicht mehr von Belang. Die<br />
Überprüfung von gesetzten Prämissen erfolgt direkt und ausschließlich am mentalen<br />
Modell.<br />
Schnotz verweist jedoch, gerade bezogen auf das Textverstehen, auf Zusammenhänge<br />
von propositionaler und mentaler Repräsentation. Er spricht hier von e<strong>in</strong>er<br />
„mentalen Sprache“ die durch „Beziehungsstiftung“ zum Sachverhalt zugewiesen<br />
wird. Geht man von e<strong>in</strong>er gleichberechtigten und kooperierenden Existenz beider<br />
Modelle aus, so ergänzen sich die Modelle dergestalt, daß mentale Modelle Begriffe<br />
(propositional) enthalten, die nicht-morphologische Beziehungen <strong>in</strong>nerhalb<br />
des mentalen Modells herstellen und andererseits analoge Repräsentationen (mentale<br />
Modelle) <strong>in</strong>nerhalb der propositionalen Begriffswelt Beziehungen herstellen,<br />
die (aktuell oder tatsächlich) nicht durch Begriffe faßbar s<strong>in</strong>d. Wann welche<br />
Form bevorzugt angewendet wird, hängt von der Art der zu bewältigenden Situation<br />
ab.<br />
Selbst wenn man wie Lakoff & Johnson (1980) von e<strong>in</strong>er eher propositionalen<br />
Abbildung ausgeht, so werden dennoch <strong>in</strong> den <strong>für</strong> VR relevanten Situationen<br />
räumliche, strukturelle und temporale Begriffe verwendet, die e<strong>in</strong>e mentale Repräsentation<br />
des erfahrenen Raumes zulassen. Die Autoren schlagen hier e<strong>in</strong> primär<br />
metaphorisches Modell vor, d.h. sie gehen davon aus, daß e<strong>in</strong>e Vielzahl von<br />
Erfahrungen dadurch gemacht wird, daß erlebte Sachverhalte über Ähnlichkeiten<br />
und Analogien konzeptualisiert werden. Auf der anderen Seite weisen sie darauf<br />
h<strong>in</strong>, daß, besonders von e<strong>in</strong>em entwicklungspsychologischen Punkt aus betrachtet,<br />
Erfahrungen auf direkter Interaktion mit der Umgebung beruhen. Der Gegenstand<br />
der Wahrnehmung ist jedoch nicht e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnes Objekt oder Merkmal,<br />
sondern vielmehr die experiential gestalt, die erfahrene Gestalt.<br />
„Doma<strong>in</strong>s of experience that are organized as gestalts <strong>in</strong> terms of such<br />
natural dimensions seem to us to be natural k<strong>in</strong>ds of experience. They are<br />
natural <strong>in</strong> the follow<strong>in</strong>g sense: These k<strong>in</strong>ds of experience are a product of<br />
Our bodies (perceptual and motor apparatus, mental capacities, emotional<br />
makeup, etc.)<br />
Our <strong>in</strong>teractions with our physical environment (mov<strong>in</strong>g, manipulat<strong>in</strong>g<br />
objects, eat<strong>in</strong>g, etc.)<br />
Our <strong>in</strong>teractions with other people with<strong>in</strong> our culture (<strong>in</strong> terms of social,<br />
political, economic, and religous <strong>in</strong>stitutions)“ (Lakoff & Johnson, 1980,<br />
S. 117)<br />
Über das Selbst und die Interaktionen mit der Umwelt wird die Gestalt der Umwelt<br />
erfahren. Dieser Vorgang ist e<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> den jeweiligen psychologischen, sozialen<br />
und kulturellen Kontext. Dieser Kontext schließt derzeit Erfahrungen mit virtuellen<br />
Umgebungen im S<strong>in</strong>ne von VR-Systemen nicht mit e<strong>in</strong>. Insofern besteht hier<br />
40