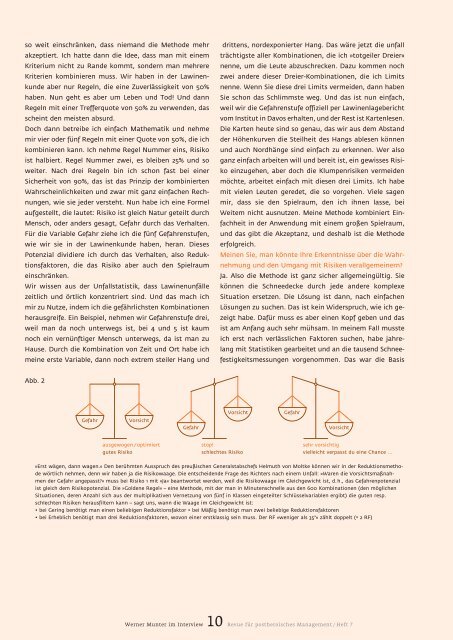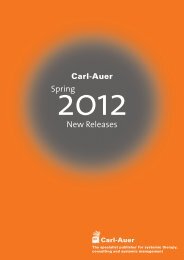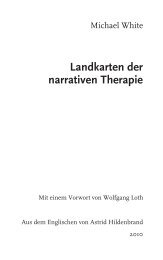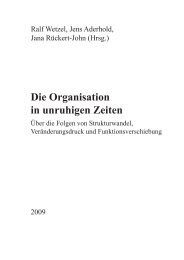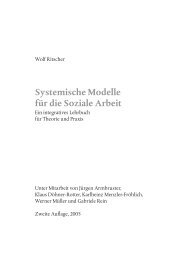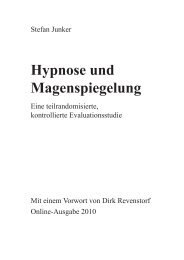B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l
B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l
B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
so weit ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken, dass niemand die Me<strong>th</strong>ode mehr<br />
akzeptiert. Ich hatte dann die Idee, dass man mit einem<br />
Kriterium nicht zu Rande kommt, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> man mehrere<br />
Kriterien kombinieren muss. Wir haben in der Lawinenkunde<br />
aber nur Regeln, die eine Zuverlässigkeit von 50%<br />
haben. Nun geht es aber um Leben und Tod! Und dann<br />
Regeln mit einer Trefferquote von 50% zu verwenden, das<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eint den meisten absu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>.<br />
Doch dann betreibe ich einfach Ma<strong>th</strong>ematik und nehme<br />
mir vier oder fünf Regeln mit einer Quote von 50%, die ich<br />
kombinieren kann. Ich nehme Regel Nummer eins, Risiko<br />
ist halbiert. Regel Nummer zwei, es bleiben 25% und so<br />
weiter. Nach drei Regeln bin ich <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on fast bei einer<br />
Sicherheit von 90%, das ist das Prinzip der kombinierten<br />
Wahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlichkeiten und zwar mit ganz einfachen Rechnungen,<br />
wie sie jeder ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>ht. Nun habe ich eine Formel<br />
aufgestellt, die lautet: Risiko ist gleich Natur geteilt durch<br />
Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>, oder anders gesagt, Gefahr durch das Verhalten.<br />
Für die Va<strong>ria</strong>ble Gefahr ziehe ich die fünf Gefahrenstufen,<br />
wie wir sie in der Lawinenkunde haben, heran. Dieses<br />
Potenzial dividiere ich durch das Verhalten, also Reduktionsfaktoren,<br />
die das Risiko aber auch den Spielraum<br />
ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken.<br />
Wir wissen aus der Unfallstatistik, dass Lawinenunfälle<br />
zeitlich und örtlich konzentriert sind. Und das mach ich<br />
mir zu Nutze, indem ich die gefährlichsten Kombinationen<br />
herausgreife. Ein Beispiel, nehmen wir Gefahrenstufe drei,<br />
weil man da noch unterwegs ist, bei 4 und 5 ist kaum<br />
noch ein ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ünftiger Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> unterwegs, da ist man zu<br />
Hause. Durch die Kombination von Zeit und Ort habe ich<br />
meine e<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng> Va<strong>ria</strong>ble, dann noch extrem steiler Hang und<br />
Abb. 2<br />
Gefahr<br />
Vorsicht<br />
ausgewogen / optimiert<br />
gutes Risiko<br />
Gefahr<br />
drittens, no<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>exponierter Hang. Das wäre jetzt die unfall<br />
trächtigste aller Kombinationen, die ich »totgeiler Dreier«<br />
nenne, um die Leute abzu<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>recken. Dazu kommen noch<br />
zwei andere dieser Dreier-Kombinationen, die ich Limits<br />
nenne. Wenn Sie diese drei Limits vermeiden, dann haben<br />
Sie <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on das Schlimmste weg. Und das ist nun einfach,<br />
weil wir die Gefahrenstufe offiziell per Lawinenlagebericht<br />
vom Institut in Davos erhalten, und der Rest ist Kartenlesen.<br />
Die Karten heute sind so genau, das wir aus dem Abstand<br />
der Höhenkurven die Steilheit des Hangs ablesen können<br />
und auch No<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>hänge sind einfach zu erkennen. Wer also<br />
ganz einfach arbeiten will und bereit ist, ein gewisses Risiko<br />
einzugehen, aber doch die Klumpenrisiken vermeiden<br />
möchte, arbeitet einfach mit diesen drei Limits. Ich habe<br />
mit vielen Leuten geredet, die so vorgehen. Viele sagen<br />
mir, dass sie den Spielraum, den ich ihnen lasse, bei<br />
Weitem nicht ausnutzen. Meine Me<strong>th</strong>ode kombiniert Einfachheit<br />
in der Anwendung mit einem g<strong>ro</strong>ßen Spielraum,<br />
und das gibt die Akzeptanz, und deshalb ist die Me<strong>th</strong>ode<br />
erfolgreich.<br />
Meinen Sie, man könnte Ihre Erkenntnisse über die Wah<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmung<br />
und den Umgang mit Risiken verallgemeine<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>?<br />
Ja. Also die Me<strong>th</strong>ode ist ganz sicher allgemeingültig. Sie<br />
können die Schneedecke durch jede andere komplexe<br />
Situation ersetzen. Die Lösung ist dann, nach einfachen<br />
Lösungen zu suchen. Das ist kein Widersp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch, wie ich gezeigt<br />
habe. Dafür muss es aber einen Kopf geben und das<br />
ist am Anfang auch sehr mühsam. In meinem Fall musste<br />
ich erst nach verlässlichen Faktoren suchen, habe jahrelang<br />
mit Statistiken gearbeitet und an die tausend Schneefestigkeitsmessungen<br />
vorgenommen. Das war die Basis<br />
Vorsicht<br />
stop!<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechtes Risiko<br />
Gefahr<br />
Vorsicht<br />
sehr vorsichtig<br />
vielleicht verpasst du eine Chance …<br />
»Erst wägen, dann wagen.« Den berühmten Aussp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch des preußi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Generalstab<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>efs Helmu<strong>th</strong> von Moltke können wir in der Reduktionsme<strong>th</strong>ode<br />
wörtlich nehmen, denn wir haben ja die Risikowaage. Die ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidende Frage des Richters nach einem Unfall: »Waren die Vorsichtsmaßnahmen<br />
der Gefahr angepasst?« muss bei Risiko 1 mit »Ja« beantwortet we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, weil die Risikowaage im Gleichgewicht ist, d. h., das Gefahrenpotenzial<br />
ist gleich dem Risikopotenzial. Die »Goldene Regel« – eine Me<strong>th</strong>ode, mit der man in Minuten<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>nelle aus den 600 Kombinationen (den möglichen<br />
Situationen, deren Anzahl sich aus der multiplikativen Ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>etzung von fünf in Klassen eingeteilter Schlüsselva<strong>ria</strong>blen ergibt) die guten resp.<br />
<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechten Risiken herausfilte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> kann – sagt uns, wann die Waage im Gleichgewicht ist:<br />
• bei Gering benötigt man einen beliebigen Reduktionsfaktor • bei Mäßig benötigt man zwei beliebige Reduktionsfaktoren<br />
• bei Erheblich benötigt man drei Reduktionsfaktoren, wovon einer erstklassig sein muss. Der RF »weniger als 35°« zählt doppelt (= 2 RF)<br />
We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview 10 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7