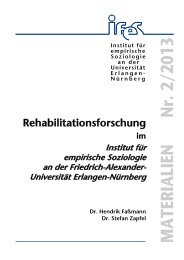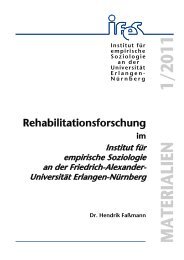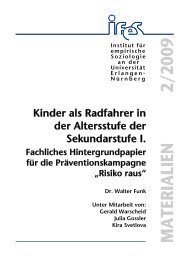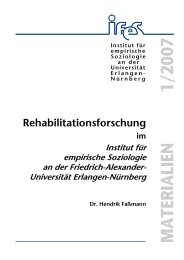Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 16<br />
<strong>Materialien</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>empirische</strong> <strong>Soziologie</strong> Nürnberg 1/2008<br />
troffen. Darüber hin<strong>aus</strong> sind die vielfältigen Be- und Überlastungen insbesondere von Frauen<br />
in Familie, H<strong>aus</strong>halt und Beruf Auslöser von physischer und psychischer Erschöpfung, 22 die<br />
Vorsorge- und Rehabilitationsbedürftigkeit nach sich zieht.<br />
Für diese Personengruppen bieten die Einrichtungen des Müttergenesungswerkes seit vielen<br />
Jahren Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen an, die von den Müttern allein oder aber von<br />
Müttern bzw. Vätern gemeinsam mit ihren Kindern in Anspruch genommen werden können,<br />
wenn andernfalls eine Teilnahme scheitern würde oder das Kind selbst ebenfalls behandlungsbedürftig<br />
ist. 23 Darüber hin<strong>aus</strong> werden auf besondere Lebenssituationen <strong>aus</strong>gerichtete<br />
Spezialmaßnahmen durchgeführt (z.B. <strong>für</strong> Frauen mit behinderten Kindern 24 , <strong>für</strong> Frauen, die<br />
an Krebs oder Multipler Sklerose erkrankt sind, an Angststörungen 25 oder unter Migräne 26<br />
leiden, <strong>für</strong> Frauen mit pflegebedürftigen Angehörigen oder zur Trauerverarbeitung 27 ).<br />
Fortsetzung der Fußnote von vorangegangener Seite<br />
zung mit Burnout im professionellen Kontext (z.B. Pflegepersonal, Ärzte/-innen, Lehrerinnen/-er, Sozialarbeiter/-innen)<br />
eindeutig im Vordergrund.<br />
22 Herwig et al. (2001: 214), Meixner (2004: 22f) und Gutenbrunner et al. (2005: 178f) weisen allerdings auf die<br />
Unschärfe von Definition und Diagnosekriterien der „chronischen Erschöpfung“ sowie die synonym verwendete<br />
Begriffe „Chronic-Fatigue-Syndrom“, „vegetatives Syndrom“, „Neurasthenie“ hin. Dies hat zur Folge, dass<br />
ein eigenständiger Krankheitswert von Erschöpfung oft bezweifelt wird (vgl. Meixner 2004: 24). Siehe dazu<br />
z.B. auch: Swenson 2000; Shepherd / Chaudhuri 2002; Clauß 2004; Meixner 2004: 21ff; Gaab / Ehlert 2005;<br />
Wollmann-Wohlleben 2005; Weidenhammer et al. 2006; Wikipedia 2006; Kobelt et al. 2005: 146f; Kobelt et al.<br />
2006; F<strong>aus</strong>t o.J.). Der Forschungsverbund Prävention und Rehabilitation <strong>für</strong> Mütter und Kinder an der Medizinischen<br />
Hochschule Hannover versucht, mütterspezifische Belastungen, Erkrankungen und Beschwerden auf<br />
Grundlage des sog. „Leitsyndroms mütterlicher Erschöpfung“ zu erfassen und zu analysieren (Collatz / Fischer<br />
/ Thies-Zajonc 1998; Collatz / Arnhold-Kerri / Thies-Zajonc 2000; Arnhold-Kerri / Collatz 2001: 167ff;<br />
Meixner et al. 2001; Collatz 2002: 44ff; Arnhold-Kerri / Sperlich / Collatz 2003: 293ff; Collatz 2004a; Arnhold-<br />
Kerri 2005; Collatz 2005a). Demgegenüber plädieren Herwig und Bengel (2003, 2004, 2005: 11) da<strong>für</strong>, die<br />
Vorsorge- und Rehabilitationsbedürftigkeit von Teilnehmerinnen an Mütter- bzw. Mutter-Kind-Maßnahmen<br />
durch die Diagnostik psychischer Störungen unter Verwendung der ICD-10-Diagnosen zu überprüfen. Auch<br />
die „Begutachtungsrichtlinie Vorsorge und Rehabilitation“ sieht vor, bei Vorsorge- und medizinischen Rehabilitationsleistungen<br />
<strong>für</strong> Mütter / Väter / Kinder neben den ICD-Diagnosen im Sinne der Internationalen Klassifikation<br />
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF: Siehe dazu: DIMDI 2004) auch zielgruppenspezifische<br />
Kontextfaktoren zu berücksichtigen (vgl. Sozialmedizinische Expertengruppe „Leistungsbeurteilung<br />
– Teilhabe“ (SEG-1) der MDK-Gemeinschaft beim MDK Niedersachsen 2005: 30f, 37). Im Vordergrund<br />
stehen dabei die psychosoziale Problemlage der Mutter sowie der Kontextfaktor Mutter-Kind-Beziehung. Es<br />
wird darauf hingewiesen, dass bisher lediglich umweltbezogene, jedoch (noch) keine personenbezogenen<br />
Kontextfaktoren nach ICF klassifiziert wurden (vgl. DIMDI 2004: 14; Leistner 2005: 182; Schuntermann 2005:<br />
21; Bundesarbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Rehabilitation 2006: 16; Schliehe 2006. 262). Das von EAG und KAG gemeinsam<br />
erarbeitete „Rahmenkonzept zur stationären Vorsorge und Rehabilitation <strong>für</strong> Frauen in Familienverantwortung“<br />
geht bereits auf die Möglichkeit zur Indikationsstellung nach ICF ein. (vgl. Hartmann et al. 2005:<br />
13ff). Über erste Versuche, die ICF-Klassifikation in Mutter-Kind-Einrichtungen einzuführen berichten: Barre /<br />
Sperlich / Collatz 2005; Sperlich / Barre / Collatz 2005.<br />
23 Siehe dazu: Prüter 1984; Ziener 1991; Blau 1997; Arnhold-Kerri / Collatz 2003; Collatz 2004b; Schubert /<br />
Horch 2004; Bonnemann-Böhner 2005; Neubourg 2005; ohne Verfasser o.J.d<br />
24 Siehe etwa. Binder 1974; Dauth: 1986<br />
25 Vgl. Toepfer 2006<br />
26 Siehe z.B.: Vonderheid-Guth o.J.<br />
27 Ein umfangreicher Überblick über Schwerpunktmaßnahmen findet sich im Jahrbuch 2007/2008 des MGW<br />
(Elly-Heuss-Knapp-Stiftung / Müttergenesungswerk 2007). Obwohl in einigen wenigen Müttergenesungs-<br />
Einrichtungen zeitweise Maßnahmen angeboten werden, die sich an pflegende Angehörige richten, wird die<br />
Möglichkeit der Inanspruchnahme des Vorsorge- und Rehabilitationssystems von Pflege- bzw. Betreuungs-<br />
Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>empirische</strong> <strong>Soziologie</strong><br />
an der Universität Erlangen-Nürnberg