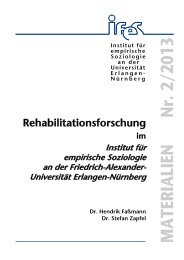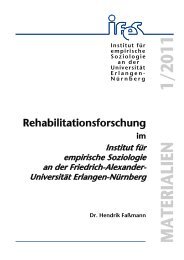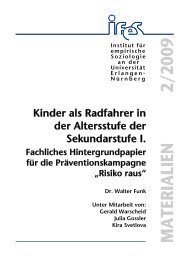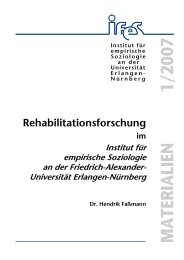Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 20<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>empirische</strong> <strong>Soziologie</strong><br />
an der Universität Erlangen-Nürnberg<br />
<strong>Materialien</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>empirische</strong> <strong>Soziologie</strong> Nürnberg 1/2008<br />
Änderung von SGB V am 22.12.1999 fand sich im Gesetz auch der Begriff „Kur“. Von ihm<br />
hat sich das Recht der Gesetzlichen Krankenversicherung seither ebenso abgesetzt, wie<br />
dies im Rahmen der <strong>für</strong> die Gesetzliche Rentenversicherung geltenden Anspruchsgrundlagen<br />
bereits seit langem der Fall ist. 38 Dem entsprechend wurde im Zuge der zum 01.08.2002<br />
in Kraft getretenen Änderungen der §§ 24 und 41 SGB V „klarstellend der Begriff ‚Mutter-<br />
Vater-Kind-Maßnahmen’ eingeführt.“ 39 Zwar ist der Begriff „Kur“ nicht nur umgangssprachlich<br />
weiterhin präsent 40 , sondern findet sich sogar noch im 7. Familienbericht, mit der Konnotation,<br />
sie diene dazu „sich Erholung und gelegentliche Abwechslung zu gönnen“. 41 Fachleute<br />
plädieren jedoch zunehmend da<strong>für</strong>, den Kurbegriff zu vermeiden: Ihm werden – nicht zuletzt<br />
durch die Marketing-Aktivitäten der Kurorte - Konnotationen zugeschrieben, die weniger auf<br />
ein anspruchsvolles therapeutisches, aktivierendes und gesundheitsförderndes Konzept abstellen,<br />
sondern eher im Bereich von Erholung, Wellness und passiver Inanspruchnahme vor<br />
allem ortsgebundener Heilmittel (Schlamm, Sole, Höhen, Meereslagen) von Bädern und<br />
Massagen sowie eines Kurregimes ( z.B. feste Ruhezeiten) liegen. 42<br />
Demnach gilt es, diese inadäquaten Assoziationen bei Teilnehmerinnen, 43 aber auch bei<br />
Ärzten 44 zu verhindern, da sie den Maßnahmeerfolg beeinträchtigen können. 45<br />
38 Vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 2000: 1. Die Bundesregierung war im Jahre 2001 der<br />
Auffassung, dass mit <strong>dem</strong> Begriff „Vorsorgemaßnahmen in anerkannten Kurorten“ der notwendige medizinische<br />
Gehalt besser zum Ausdruck gebracht würde und brachte explizit ihre Distanz zum traditionellen Kurbegriff<br />
zum Ausdruck (vgl. Deutscher Bundestag 2001: 38f). Damit ging sie konform mit Forderungen des Bundesverbandes<br />
Deutscher Privatkrankenanstalten e.V. <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 2000, den missverständlichen und vorbelasteten<br />
Begriff der „Kur“ nicht in SGB IX aufzunehmen (vgl. Clade 2000: 3467). Die Spitzenverbände der<br />
Leistungserbringer der medizinischen Rehabilitation (2006: 6) haben allerdings darauf hingewiesen, dass der<br />
Begriff „Kuren“ in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
(KSVwV) immer noch verwendet wird und fordern eine Abänderung dieser Rechtsnorm.<br />
39 Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit 2006: 3<br />
40<br />
Er findet sich sogar noch im Jahre 2006 in der Stellungnahme des Bundesministeriums <strong>für</strong> Gesundheit (2006:<br />
3f) zum Bericht der Spitzenverbände der Krankenkassen. In jüngster Zeit etwa: Otto / Arnhold-Kerri 2007; Redaktionsbüro<br />
GESUNDHEIT / Schilling 2007; Stöcker 2007.<br />
41<br />
Deutscher Bundestag 2006c: 173<br />
42<br />
Vgl. Wirth 1990: 192; Wirth 1995: 422; Kliche 2004: 12; Reitz 2004: 19f. Wirth (1995: 422) weist auf die Probleme<br />
hin, die sich <strong>für</strong> Teilnehmerinnen und Klinikpersonal ergeben, wenn Patientinnen eine Kur in einem entsprechenden<br />
Ambiente erwarten und in der Klinik mit einem qualifizierten Therapiekonzept konfrontiert werden.<br />
(Siehe dazu auch: Faßmann / Masopust 1979: 37f; Burger 1996: 156f) Allerdings scheint diese Diskussion<br />
an den Krankenkassen vorbei gegangen zu sein, wird doch auf ihren Websites (z.B. auf den zentralen<br />
Websites der der AOK – Die Gesundheitskasse, Betriebskrankenkassen (BKK), der Techniker Krankenkasse<br />
(TK)) sowohl bei der Bezeichnung der betreffenden Leistungen („Mütterkur“) wie auch der Einrichtungen<br />
(„Mütterkureinrichtungen“) weiterhin mit <strong>dem</strong> Kurbegriff operiert. Wir interpretieren dies als Hinweis darauf,<br />
dass sich die Krankenkassen kaum inhaltlich mit diesem Vorsorge- und Rehabilitationsangebot <strong>aus</strong>einanderzusetzen<br />
scheinen.<br />
43<br />
Faller / Vogel / Bosch (2000: 211) berichten übereinstimmend mit anderen Untersuchungsergebnissen (z.B.<br />
Strittmatter et al. 1997; 182; info-Team 1999: Tabelle zu Frage 1), dass die Reha-Erwartungen von Patienten<br />
auch im Jahre 2000 vorwiegend auf balneophysikalische Maßnahmen, eine angenehme Klinikumgebung, Erholung<br />
und Entlastung und medizinische Betreuung <strong>aus</strong>gerichtet waren, während eher aktive Maßnahmen,<br />
wie sie in den modernen verhaltensmedizinisch orientierten („edukativen“) Behandlungskonzepten eingesetzt<br />
werden, weniger im Zentrum der Erwartungen standen.