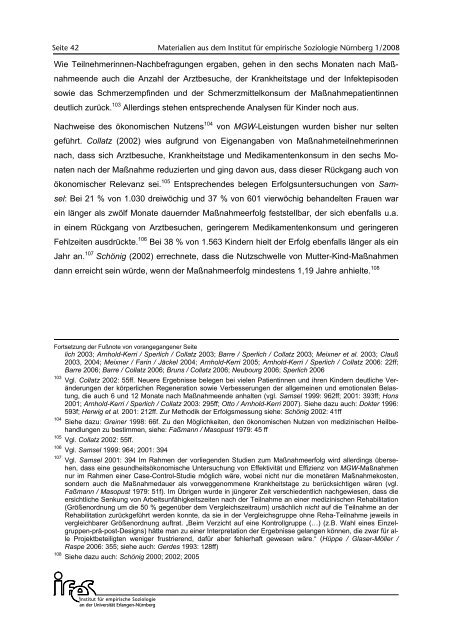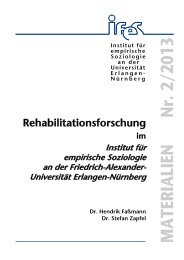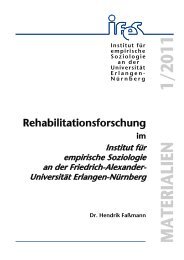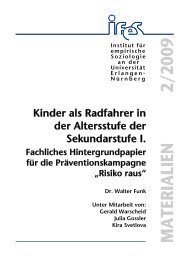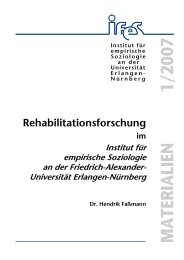Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Materialien aus dem Institut für empirische Soziologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 42<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>empirische</strong> <strong>Soziologie</strong><br />
an der Universität Erlangen-Nürnberg<br />
<strong>Materialien</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>empirische</strong> <strong>Soziologie</strong> Nürnberg 1/2008<br />
Wie Teilnehmerinnen-Nachbefragungen ergaben, gehen in den sechs Monaten nach Maßnahmeende<br />
auch die Anzahl der Arztbesuche, der Krankheitstage und der Infektepisoden<br />
sowie das Schmerzempfinden und der Schmerzmittelkonsum der Maßnahmepatientinnen<br />
deutlich zurück. 103 Allerdings stehen entsprechende Analysen <strong>für</strong> Kinder noch <strong>aus</strong>.<br />
Nachweise des ökonomischen Nutzens 104 von MGW-Leistungen wurden bisher nur selten<br />
geführt. Collatz (2002) wies aufgrund von Eigenangaben von Maßnahmeteilnehmerinnen<br />
nach, dass sich Arztbesuche, Krankheitstage und Medikamentenkonsum in den sechs Monaten<br />
nach der Maßnahme reduzierten und ging davon <strong>aus</strong>, dass dieser Rückgang auch von<br />
ökonomischer Relevanz sei. 105 Entsprechendes belegen Erfolgsuntersuchungen von Samsel:<br />
Bei 21 % von 1.030 dreiwöchig und 37 % von 601 vierwöchig behandelten Frauen war<br />
ein länger als zwölf Monate dauernder Maßnahmeerfolg feststellbar, der sich ebenfalls u.a.<br />
in einem Rückgang von Arztbesuchen, geringerem Medikamentenkonsum und geringeren<br />
Fehlzeiten <strong>aus</strong>drückte. 106 Bei 38 % von 1.563 Kindern hielt der Erfolg ebenfalls länger als ein<br />
Jahr an. 107 Schönig (2002) errechnete, dass die Nutzschwelle von Mutter-Kind-Maßnahmen<br />
dann erreicht sein würde, wenn der Maßnahmeerfolg mindestens 1,19 Jahre anhielte. 108<br />
Fortsetzung der Fußnote von vorangegangener Seite<br />
lich 2003; Arnhold-Kerri / Sperlich / Collatz 2003; Barre / Sperlich / Collatz 2003; Meixner et al. 2003; Clauß<br />
2003, 2004; Meixner / Farin / Jäckel 2004; Arnhold-Kerri 2005; Arnhold-Kerri / Sperlich / Collatz 2006: 22ff;<br />
Barre 2006; Barre / Collatz 2006; Bruns / Collatz 2006; Neubourg 2006; Sperlich 2006<br />
103 Vgl. Collatz 2002: 55ff. Neuere Ergebnisse belegen bei vielen Patientinnen und ihren Kindern deutliche Veränderungen<br />
der körperlichen Regeneration sowie Verbesserungen der allgemeinen und emotionalen Belastung,<br />
die auch 6 und 12 Monate nach Maßnahmeende anhalten (vgl. Samsel 1999: 962ff; 2001: 393ff; Hons<br />
2001; Arnhold-Kerri / Sperlich / Collatz 2003: 295ff; Otto / Arnhold-Kerri 2007). Siehe dazu auch: Dokter 1996:<br />
593f; Herwig et al. 2001: 212ff. Zur Methodik der Erfolgsmessung siehe: Schönig 2002: 41ff<br />
104 Siehe dazu: Greiner 1998: 66f. Zu den Möglichkeiten, den ökonomischen Nutzen von medizinischen Heilbehandlungen<br />
zu bestimmen, siehe: Faßmann / Masopust 1979: 45 ff<br />
105 Vgl. Collatz 2002: 55ff.<br />
106 Vgl. Samsel 1999: 964; 2001: 394<br />
107 Vgl. Samsel 2001: 394 Im Rahmen der vorliegenden Studien zum Maßnahmeerfolg wird allerdings übersehen,<br />
dass eine gesundheitsökonomische Untersuchung von Effektivität und Effizienz von MGW-Maßnahmen<br />
nur im Rahmen einer Case-Control-Studie möglich wäre, wobei nicht nur die monetären Maßnahmekosten,<br />
sondern auch die Maßnahmedauer als vorweggenommene Krankheitstage zu berücksichtigen wären (vgl.<br />
Faßmann / Masopust 1979: 51f). Im Übrigen wurde in jüngerer Zeit verschiedentlich nachgewiesen, dass die<br />
ersichtliche Senkung von Arbeitsunfähigkeitszeiten nach der Teilnahme an einer medizinischen Rehabilitation<br />
(Größenordnung um die 50 % gegenüber <strong>dem</strong> Vergleichszeitraum) ursächlich nicht auf die Teilnahme an der<br />
Rehabilitation zurückgeführt werden konnte, da sie in der Vergleichsgruppe ohne Reha-Teilnahme jeweils in<br />
vergleichbarer Größenordnung auftrat. „Beim Verzicht auf eine Kontrollgruppe (…) (z.B. Wahl eines Einzelgruppen-prä-post-Designs)<br />
hätte man zu einer Interpretation der Ergebnisse gelangen können, die zwar <strong>für</strong> alle<br />
Projektbeteiligten weniger frustrierend, da<strong>für</strong> aber fehlerhaft gewesen wäre.“ (Hüppe / Glaser-Möller /<br />
Raspe 2006: 355; siehe auch: Gerdes 1993: 128ff)<br />
108 Siehe dazu auch: Schönig 2000; 2002; 2005