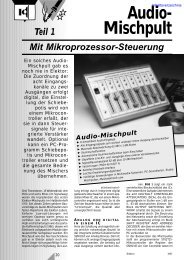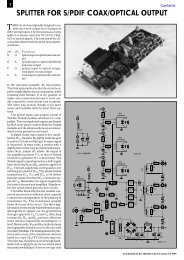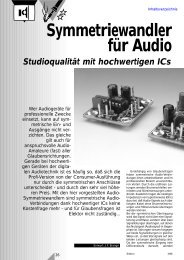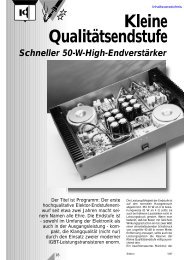technik leistungselektronik - WebHTB
technik leistungselektronik - WebHTB
technik leistungselektronik - WebHTB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TECHNIK EMPFÄNGER<br />
Bild 2.<br />
Der Empfänger passt<br />
zusammen mit dem<br />
Netzteil in ein kleines<br />
Kunststoffgehäuse.<br />
Am Eingang wird die<br />
Spulenantenne (im<br />
schwarzen Kasten)<br />
und am Ausgang die<br />
Soundkarte eines Laptops<br />
angeschlossen, auf dem<br />
hier das Analyseprogramm<br />
Cool Edit läuft.<br />
Bild 3.<br />
Das Bild zeigt eines von<br />
über 20 Signalen, die im<br />
Laufe der letzten Jahre<br />
am früheren Wohnort des<br />
Autors empfangen wurden.<br />
Hier das Spektrum des<br />
„Kuh“-Signals.<br />
Auch wenn das Filter noch so steil ist, wird ein Teil der<br />
empfangenen 50-Hz-Wechselspannung immer noch<br />
durchgelassen. Bei der geforderten, hohen Verstärkung<br />
von mindestens 100.000 kann dieser Teil auch hier zur<br />
Übersteuerung führen, wenn man das Filter nicht an die<br />
richtige Stelle platziert. Grundsätzlich sollten die von der<br />
Spule empfangenen Wechselspannungen erst einmal mit<br />
einem Verstärker, der einen niederohmigen Eingang besitzt,<br />
verstärkt werden. Und zwar so weit, bis die empfangenen<br />
50 Hz aus den benachbarten Stromleitungen einen<br />
Wert von einigen Volt aufweisen und sich die Amplitudenspitzen<br />
dennoch weit genug von der Clippgrenze entfernt<br />
befi nden. Nach anschließender Filterung ist das 50-Hz-<br />
Signal auf einem Oszilloskop kaum noch zu erkennen.<br />
Die erwünschten Signale sind jedoch, wenn auch sehr<br />
schwach, immer noch unverändert vorhanden. Sie lassen<br />
sich nun problemlos erneut verstärken.<br />
Die Schaltung<br />
Die in Bild 1 gezeigte Schaltung geht noch etwas weiter<br />
und ist in ihrer Funktionsweise für jeden erfahrenen<br />
Leser leicht zu durchschauen. Jeder einzelnen, von einem<br />
OpAmp gebildeten Verstärkerstufe folgt ein entkoppeltes<br />
Hoch- und Tiefpassfi lter. Nach jeder dieser Stufen wird<br />
der Netzbrumm etwas schwächer. Der Pegel der zu empfangenden<br />
ELF-Signale nimmt dagegen zu - eine Art „Anreicherungsprozess“,<br />
der bewirkt, dass der Netzbrumm<br />
niemals zur Übersteuerung einer Stufe führen kann. Die<br />
Hochpässe dienen zur Eliminierung der Offset-Spannungen<br />
der einzelnen OpAmps, die bei solch hohen Verstärkungen<br />
leicht zum Clippen der Schaltung führen können.<br />
Bei Verwendung teurer, offsetfreier OpAmps können<br />
sie entfallen. Eine alternative Möglichkeit besteht in der<br />
Offsetkompensation mittels (Spindel-)Trimmpoti. Die Kompensationsspannung<br />
könnte den Verstärkern zum Beispiel<br />
über einen Addierer zugeführt werden. Manche OpAmps<br />
sind auch mit einer Offsetkompensation ausgestattet.<br />
Bei einer geschickter Dimensionierung ist der Empfänger<br />
so empfi ndlich, dass er einen in 5 m Entfernung von der<br />
Spule per Hand hin und her bewegten Magneten (aus<br />
einem altem Kleinlautsprecher) als deutliche Sinuskurve<br />
von einigen Hertz und einigen Volt auf dem Oszilloskop<br />
quittiert. Die 50-Hz-Wechselspannung ist dabei nur noch<br />
bei genauem Hinsehen auf dem Schirm zu erkennen.<br />
Die von der Schaltung empfangenen Signale sind so niederfrequent,<br />
dass man sie nicht mehr hören kann. Das reine<br />
Betrachten des Empfänger-Ausgangssignals auf einem<br />
Oszilloskop macht nicht viel Sinn. Denn aus dem Zeitsignal,<br />
das ein Gemisch unterschiedlichster Frequenzen<br />
darstellt, ist nicht ersichtlich, ob ein interessantes Signal<br />
empfangen wird.<br />
Aus diesem Grunde kommt man an einem Software-Rekorder,<br />
einem Software-Spektrum-Analyzer und einer Langzeit-Aufnahme<br />
von mindestens 15 Minuten nicht vorbei.<br />
Zum Messequipment gehören daher ein Laptop und eine<br />
Software wie etwa Cool Edit (siehe Bild 2).<br />
Doch auch jetzt sind noch nicht alle Probleme gelöst. Die<br />
Frequenzskalen gängiger Software-Spektrumanalyzer sind<br />
so beschaffen, dass der interessierende ELF-Bereich nur<br />
extrem schmal und unübersichtlich am unteren Rand abgebildet<br />
wird.<br />
Um die Skala ganz zu nutzen, muss man dem Spektrum-<br />
Analyzer vorgaukeln, dass es sich bei den empfangenen<br />
Signalen um Frequenzen im Audiobereich handelt (also<br />
zwischen etwa 50 Hz und 20 kHz). Dazu gibt es mehrere<br />
Methoden. Grundsätzlich geht man dabei wie folgt vor:<br />
1. Zuerst nimmt man die vom Empfänger gelieferten Signale<br />
mittels eines PC-Rekorderprogramms auf. Man muss<br />
jedoch daran denken, dass Standard-PC-Soundkarten Frequenzen<br />
unter 16 Hz stark dämpfen.<br />
2. Die Abtastrate darf nicht höher als 200 Hz sein.<br />
Falls dies beim verwendeten Rekorder nicht realisierbar<br />
ist, können die Daten mit einer selbst gestrickten Software<br />
nachträglich reduziert werden - indem man zum<br />
Beispiel nur jedes hundertste Sample aus der Originaldatei<br />
berücksichtigt. Die scheinbare Samplefrequenz<br />
beträgt dann nur noch ein Hundertstel der tatsächlichen<br />
Abtastfrequenz.<br />
3. Die Sound-Datei wird ins Analyseprogramm geladen,<br />
wobei zuvor eine Sample-Frequenz von etwa 32 kHz<br />
(ausprobieren) zu Grunde gelegt werden muss. Das Analyseprogramm<br />
„glaubt“ nun fälschlicherweise, dass die<br />
empfangenen Signale eine um den Faktor 160 höhere<br />
Frequenz (bei 200 Hz Original- bzw. Schein-Sampling)<br />
besitzen und bildet das Spektrum im Ganzen zur Ver-<br />
30 elektor - 5/2007