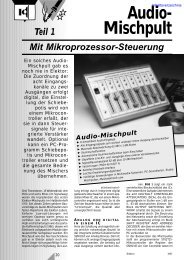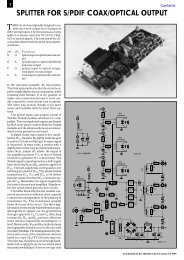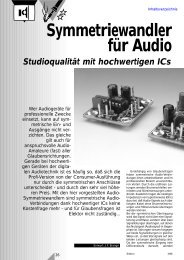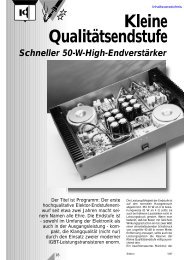technik leistungselektronik - WebHTB
technik leistungselektronik - WebHTB
technik leistungselektronik - WebHTB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TECHNIK LEISTUNGSELEKTRONIK<br />
Asynchron-Motor-<br />
Asynchron-Motor-<br />
mit SPM und AVR<br />
Evaluation-Board für<br />
AT90PWM3-Mikrocontroller und<br />
Fairchild-Smart-Power-Modul<br />
Von Paul Goossens<br />
Die Drehzahlsteuerung von Asynchron-Motoren erfordert einen dreiphasigen<br />
Frequenzumrichter, auch als Frequenz-Inverter bekannt. Kernstück des Evaluation Kit<br />
ATAVRMC200 von Atmel ist eine vielseitige Motorsteuer-Platine mit einem speziellen AVR-<br />
Mikrocontroller und Fairchild-SPM-Modul als Leistungsstufe. Insbesondere der sensorlose<br />
Betrieb von Asynchron-Motoren kann damit einfach realisiert werden.<br />
Der E-Techniker spricht natürlich nicht vom Asynchronmotor,<br />
sondern von der Drehstrom-Asynchronmaschine,<br />
auch Drehstrom-Induktionsmaschine [1] genannt. Wie<br />
die Bezeichnung schon besagt, braucht dieser Motor<br />
Drehstrom, also ein Drei-Phasen-Netz. Diese drei mit den<br />
Buchstaben U, V und W bezeichneten Phasen werden<br />
benötigt, um mit den Statorwicklungen ein Drehfeld zu<br />
erzeugen. Die einfachste Methode besteht darin, diese<br />
drei Wicklungen jeweils an eine sinusförmige Spannung<br />
anzuschließen, wobei die drei Sinussignale um jeweils<br />
120 Grad phasenverschoben sind. Ein Drehstromnetz<br />
stellt diese drei Phasenspannungen mit einer Frequenz<br />
von 50 Hz und einer Spannung von 400 V (von Phase<br />
zu Phase) zur Verfügung.<br />
Da der Läufer eines Asynchronmotors mit einem kleinen<br />
Schlupf dem umlaufenden Drehfeld folgt, hängt seine<br />
Drehzahl in sehr engen Grenzen von der Frequenz des<br />
dreiphasigen Wechselstroms ab und variiert beim Betrieb<br />
am Drehstromnetz mit 50 Hz nur in einem relativ kleinen<br />
Bereich und abhängig von der Last. Die Drehzahl lässt<br />
sich daher praktisch nur über eine Änderung der Frequenz<br />
steuern. Ein Frequenzumrichter löst dieses Problem:<br />
Er erzeugt aus der gleichgerichteten Netzspannung ein<br />
dreiphasiges sinusförmiges Ausgangssignal mit einstellba-<br />
rer Frequenz und meist auch einstellbarer Amplitude, so<br />
dass sich Drehzahl und Drehmoment steuern lassen.<br />
Wechselrichter<br />
Der Drehstrom-Frequenzumrichter besteht dabei im Prinzip<br />
aus drei Sinus-Wechselrichtern mit variabler Frequenz.<br />
Wie bei den bekannten einphasigen Wechselrichtern<br />
(12 V DC/230 V AC) sind lineare Leistungsstufen wegen<br />
des schlechten Wirkungsgrads weniger geeignet, um das<br />
Sinussignal zu erzeugen. Besser ist es, die Leistungstransistoren<br />
als Schalter einzusetzen (siehe Bild 1) – mit<br />
möglichst geringer Verlustleistung. Wenn Schalter S a+ mit<br />
einem PWM-Signal und Schalter S a- mit dem gleichen,<br />
aber invertierten PWM-Signal gesteuert wird, lässt sich<br />
durch die Pulsbreite des PWM-Signals (gemittelt) jeder<br />
gewünschte Spannungswert zwischen 0 V und Betriebsspannung<br />
einstellen. Die Sinusform der Spannung wird<br />
durch eine entsprechende Modulation der Pulsbreite des<br />
PWM-Signals erzielt.<br />
Bei den SPM-Modulen lassen sich diese Leistungsschalter<br />
über TTL-kompatible Eingänge (5-V-Logikpegel) steuern.<br />
Bei der Ansteuerung der Leistungsschalter (IGBTs oder<br />
FETs) muss man sorgfältig darauf achten, dass niemals<br />
42 elektor - 5/2007