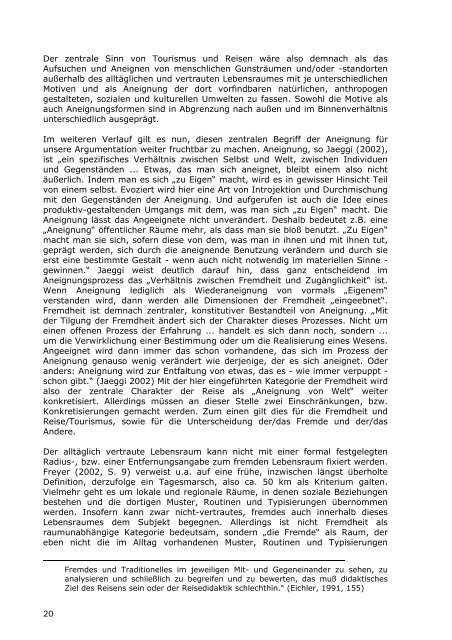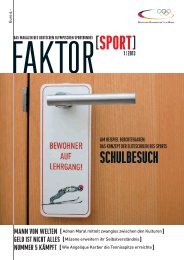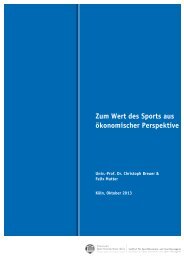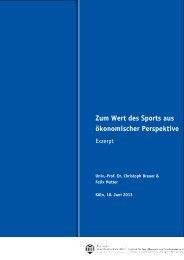Sport und Tourismus - Der Deutsche Olympische Sportbund
Sport und Tourismus - Der Deutsche Olympische Sportbund
Sport und Tourismus - Der Deutsche Olympische Sportbund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Der</strong> zentrale Sinn von <strong>Tourismus</strong> <strong>und</strong> Reisen wäre also demnach als das<br />
Aufsuchen <strong>und</strong> Aneignen von menschlichen Gunsträumen <strong>und</strong>/oder -standorten<br />
außerhalb des alltäglichen <strong>und</strong> vertrauten Lebensraumes mit je unterschiedlichen<br />
Motiven <strong>und</strong> als Aneignung der dort vorfindbaren natürlichen, anthropogen<br />
gestalteten, sozialen <strong>und</strong> kulturellen Umwelten zu fassen. Sowohl die Motive als<br />
auch Aneignungsformen sind in Abgrenzung nach außen <strong>und</strong> im Binnenverhältnis<br />
unterschiedlich ausgeprägt.<br />
Im weiteren Verlauf gilt es nun, diesen zentralen Begriff der Aneignung für<br />
unsere Argumentation weiter fruchtbar zu machen. Aneignung, so Jaeggi (2002),<br />
ist „ein spezifisches Verhältnis zwischen Selbst <strong>und</strong> Welt, zwischen Individuen<br />
<strong>und</strong> Gegenständen ... Etwas, das man sich aneignet, bleibt einem also nicht<br />
äußerlich. Indem man es sich „zu Eigen“ macht, wird es in gewisser Hinsicht Teil<br />
von einem selbst. Evoziert wird hier eine Art von Introjektion <strong>und</strong> Durchmischung<br />
mit den Gegenständen der Aneignung. Und aufgerufen ist auch die Idee eines<br />
produktiv-gestaltenden Umgangs mit dem, was man sich „zu Eigen“ macht. Die<br />
Aneignung lässt das Angeeignete nicht unverändert. Deshalb bedeutet z.B. eine<br />
„Aneignung“ öffentlicher Räume mehr, als dass man sie bloß benutzt. „Zu Eigen“<br />
macht man sie sich, sofern diese von dem, was man in ihnen <strong>und</strong> mit ihnen tut,<br />
geprägt werden, sich durch die aneignende Benutzung verändern <strong>und</strong> durch sie<br />
erst eine bestimmte Gestalt - wenn auch nicht notwendig im materiellen Sinne -<br />
gewinnen.“ Jaeggi weist deutlich darauf hin, dass ganz entscheidend im<br />
Aneignungsprozess das „Verhältnis zwischen Fremdheit <strong>und</strong> Zugänglichkeit“ ist.<br />
Wenn Aneignung lediglich als Wiederaneignung von vormals „Eigenem“<br />
verstanden wird, dann werden alle Dimensionen der Fremdheit „eingeebnet“.<br />
Fremdheit ist demnach zentraler, konstitutiver Bestandteil von Aneignung. „Mit<br />
der Tilgung der Fremdheit ändert sich der Charakter dieses Prozesses. Nicht um<br />
einen offenen Prozess der Erfahrung ... handelt es sich dann noch, sondern ...<br />
um die Verwirklichung einer Bestimmung oder um die Realisierung eines Wesens.<br />
Angeeignet wird dann immer das schon vorhandene, das sich im Prozess der<br />
Aneignung genauso wenig verändert wie derjenige, der es sich aneignet. Oder<br />
anders: Aneignung wird zur Entfaltung von etwas, das es - wie immer verpuppt -<br />
schon gibt.“ (Jaeggi 2002) Mit der hier eingeführten Kategorie der Fremdheit wird<br />
also der zentrale Charakter der Reise als „Aneignung von Welt“ weiter<br />
konkretisiert. Allerdings müssen an dieser Stelle zwei Einschränkungen, bzw.<br />
Konkretisierungen gemacht werden. Zum einen gilt dies für die Fremdheit <strong>und</strong><br />
Reise/<strong>Tourismus</strong>, sowie für die Unterscheidung der/das Fremde <strong>und</strong> der/das<br />
Andere.<br />
<strong>Der</strong> alltäglich vertraute Lebensraum kann nicht mit einer formal festgelegten<br />
Radius-, bzw. einer Entfernungsangabe zum fremden Lebensraum fixiert werden.<br />
Freyer (2002, S. 9) verweist u.a. auf eine frühe, inzwischen längst überholte<br />
Definition, derzufolge ein Tagesmarsch, also ca. 50 km als Kriterium galten.<br />
Vielmehr geht es um lokale <strong>und</strong> regionale Räume, in denen soziale Beziehungen<br />
bestehen <strong>und</strong> die dortigen Muster, Routinen <strong>und</strong> Typisierungen übernommen<br />
werden. Insofern kann zwar nicht-vertrautes, fremdes auch innerhalb dieses<br />
Lebensraumes dem Subjekt begegnen. Allerdings ist nicht Fremdheit als<br />
raumunabhängige Kategorie bedeutsam, sondern „die Fremde“ als Raum, der<br />
eben nicht die im Alltag vorhandenen Muster, Routinen <strong>und</strong> Typisierungen<br />
20<br />
Fremdes <strong>und</strong> Traditionelles im jeweiligen Mit- <strong>und</strong> Gegeneinander zu sehen, zu<br />
analysieren <strong>und</strong> schließlich zu begreifen <strong>und</strong> zu bewerten, das muß didaktisches<br />
Ziel des Reisens sein oder der Reisedidaktik schlechthin.“ (Eichler, 1991, 155)