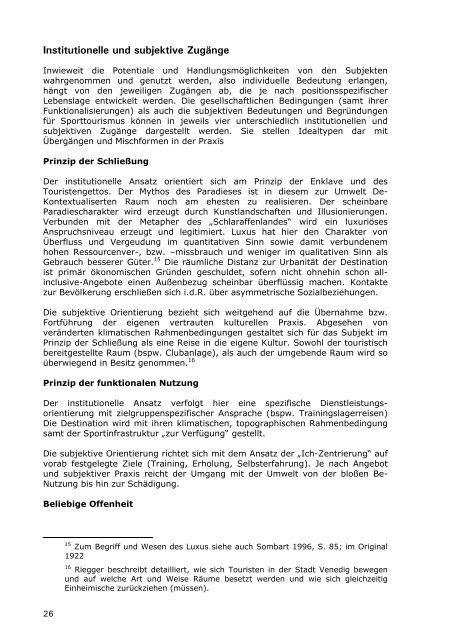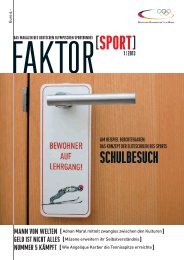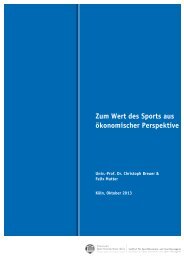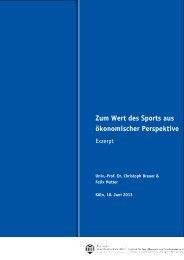Sport und Tourismus - Der Deutsche Olympische Sportbund
Sport und Tourismus - Der Deutsche Olympische Sportbund
Sport und Tourismus - Der Deutsche Olympische Sportbund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institutionelle <strong>und</strong> subjektive Zugänge<br />
Inwieweit die Potentiale <strong>und</strong> Handlungsmöglichkeiten von den Subjekten<br />
wahrgenommen <strong>und</strong> genutzt werden, also individuelle Bedeutung erlangen,<br />
hängt von den jeweiligen Zugängen ab, die je nach positionsspezifischer<br />
Lebenslage entwickelt werden. Die gesellschaftlichen Bedingungen (samt ihrer<br />
Funktionalisierungen) als auch die subjektiven Bedeutungen <strong>und</strong> Begründungen<br />
für <strong>Sport</strong>tourismus können in jeweils vier unterschiedlich institutionellen <strong>und</strong><br />
subjektiven Zugänge dargestellt werden. Sie stellen Idealtypen dar mit<br />
Übergängen <strong>und</strong> Mischformen in der Praxis<br />
Prinzip der Schließung<br />
<strong>Der</strong> institutionelle Ansatz orientiert sich am Prinzip der Enklave <strong>und</strong> des<br />
Touristengettos. <strong>Der</strong> Mythos des Paradieses ist in diesem zur Umwelt De-<br />
Kontextualiserten Raum noch am ehesten zu realisieren. <strong>Der</strong> scheinbare<br />
Paradiescharakter wird erzeugt durch Kunstlandschaften <strong>und</strong> Illusionierungen.<br />
Verb<strong>und</strong>en mit der Metapher des „Schlaraffenlandes“ wird ein luxuriöses<br />
Anspruchsniveau erzeugt <strong>und</strong> legitimiert. Luxus hat hier den Charakter von<br />
Überfluss <strong>und</strong> Vergeudung im quantitativen Sinn sowie damit verb<strong>und</strong>enem<br />
hohen Ressourcenver-, bzw. –missbrauch <strong>und</strong> weniger im qualitativen Sinn als<br />
Gebrauch besserer Güter. 15 Die räumliche Distanz zur Urbanität der Destination<br />
ist primär ökonomischen Gründen geschuldet, sofern nicht ohnehin schon allinclusive-Angebote<br />
einen Außenbezug scheinbar überflüssig machen. Kontakte<br />
zur Bevölkerung erschließen sich i.d.R. über asymmetrische Sozialbeziehungen.<br />
Die subjektive Orientierung bezieht sich weitgehend auf die Übernahme bzw.<br />
Fortführung der eigenen vertrauten kulturellen Praxis. Abgesehen von<br />
veränderten klimatischen Rahmenbedingungen gestaltet sich für das Subjekt im<br />
Prinzip der Schließung als eine Reise in die eigene Kultur. Sowohl der touristisch<br />
bereitgestellte Raum (bspw. Clubanlage), als auch der umgebende Raum wird so<br />
überwiegend in Besitz genommen. 16<br />
Prinzip der funktionalen Nutzung<br />
<strong>Der</strong> institutionelle Ansatz verfolgt hier eine spezifische Dienstleistungsorientierung<br />
mit zielgruppenspezifischer Ansprache (bspw. Trainingslagerreisen)<br />
Die Destination wird mit ihren klimatischen, topographischen Rahmenbedingung<br />
samt der <strong>Sport</strong>infrastruktur „zur Verfügung“ gestellt.<br />
Die subjektive Orientierung richtet sich mit dem Ansatz der „Ich-Zentrierung“ auf<br />
vorab festgelegte Ziele (Training, Erholung, Selbsterfahrung). Je nach Angebot<br />
<strong>und</strong> subjektiver Praxis reicht der Umgang mit der Umwelt von der bloßen Be-<br />
Nutzung bis hin zur Schädigung.<br />
Beliebige Offenheit<br />
26<br />
15 Zum Begriff <strong>und</strong> Wesen des Luxus siehe auch Sombart 1996, S. 85; im Original<br />
1922<br />
16 Riegger beschreibt detailliert, wie sich Touristen in der Stadt Venedig bewegen<br />
<strong>und</strong> auf welche Art <strong>und</strong> Weise Räume besetzt werden <strong>und</strong> wie sich gleichzeitig<br />
Einheimische zurückziehen (müssen).