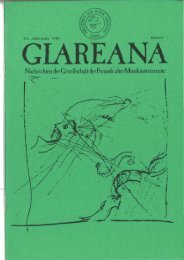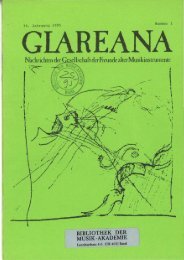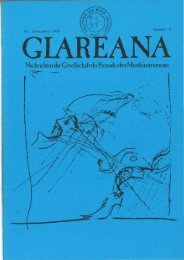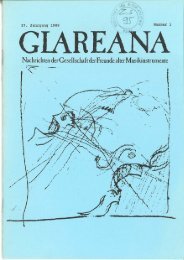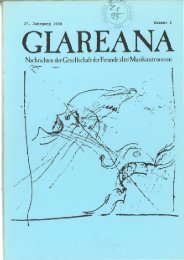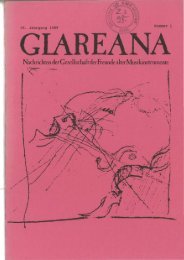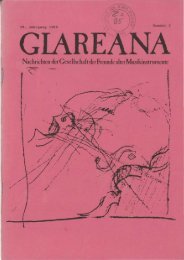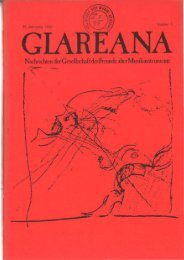Glareana_46_1997_#1
Georg F. Senn Der Klavierbauer Mathias Schautz (1755-1831). (2. Teil) Die Instrumente Thomas Friedemann Steiner Gedanken beim Bau eines Clavichords nach Christian Gottlob Hubert Im Memoriam Siegfried Brenn (22.11.1923 - 15.03.1997)
Georg F. Senn
Der Klavierbauer Mathias Schautz (1755-1831). (2. Teil) Die Instrumente
Thomas Friedemann Steiner
Gedanken beim Bau eines Clavichords nach Christian Gottlob Hubert
Im Memoriam Siegfried Brenn (22.11.1923 - 15.03.1997)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
23<br />
t<br />
f<br />
Bad Krozingen beherbergt in seinem Schloss die etwa fünzig Tasteninstrumente<br />
umfassende Sammlung Neumeyer. Unter der Katalognummer 17 wird dort als Leihgabe<br />
des musikwissenschaftliehen Seminars der Universität Freiburg ein Clavichord "von<br />
Christian Gottlieb 2 Hubert hochfürstl. Anspachischer Hof Orgel u Instrumentenbauer<br />
Bayreuth anno 1772" aufbewahrt. Das nussbaumfurnierte, mit feinen Einlagen und Profilen<br />
geschmückte Instrument ruht auf einem Untergestell mit vier geschwungenen Beinen und<br />
mehreren Schubladen. Die Untertasten der fünf Oktaven umfassenden Klaviatur (FF - f 3 )<br />
sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Elfenbein. Die Tastenfronten sind mit<br />
schwarzen Arkaden verziert. Von Tonumfang und Entstehungszeit eignet sich das<br />
Instrument für Klavierliteratur von C.Ph.E. Bach und frühe Werke von J. Haydn und W. A.<br />
Mozart. Die abgenutzten Tasten weisen darauf hin, dass es viel gespielt worden ist.<br />
Der Korpus zeigt überall Spuren von Wurmfrass; einige Teile, so zum Beispiel die rechte<br />
Seitenwand, sind neu. Zusätzliche Querstreben im Klaviaturbereich und grobe Nägel<br />
zwischen Rückwand und rechter Seite versteifen das stark verformte Gehäuse. Der<br />
ursprüngliche Resonanzboden wurde entlang seiner Auflager herausgeschnitten. Über die<br />
Reste des alten Resonanzbodens wurde ein neuer aus doppelt so feinem Holz geleimt. Er<br />
ist auf der Unterseite vierfach quer zum (originalen) Steg berippt. Ausserdem ziert ihn eine<br />
italienisch anmutende Rosette - ein Detail, das in keinem Hubart-Clavichord mit originalem<br />
Resonanzboden zu finden ist.<br />
Zwischen 1756 und 1771 findet man bei Hubart-Clavichorden Längen von 282 bis 270 mm<br />
für c 2 , nach 1782 264 bis 249 mm. Die 260 mm für das c 2 beim 1772 datierten Instrument in<br />
Bad Krozingen fallen sehr aus dem Rahmen und weisen darauf hin, dass beim Aufleimen<br />
die Position des Stegs nicht sorgfältig beachtet wurde.<br />
Dem kurzen c 2 entspricht eine Normfrequenz von 456 Hz für a 1 . Das Instrument ist jedoch<br />
heute auf a 1 = 415 Hz gestimmt. 37 der 61 Tasten sind ausgeblelt, das Spielgewicht ist<br />
etwa 13,5 gr. Der Tiefgang ist mit 6 mm etwas grösser als bei diesem Instrumententyp<br />
üblich. Saitenspannung, Spielgewicht und Tiefgang wirken hier so zusammen, dass die<br />
Qualitäten des Instruments nicht voll ausgeschöpft werden können.<br />
Von der musikalischen Seite brachte diese Art der Spielbarmachung nur einen schwachen<br />
Abglanz dessen, was ein Hubart-Clavichord zu bieten hat. Gleichzeitig wurde durch das<br />
Entfernen des alten Resonanzbodens wichtige Information zerstört. Daten zum Zustand<br />
des Instruments vor diesem Eingriff existieren nicht.<br />
Im Magazin des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ist unter der Nummer MIR<br />
1 058a ein weiteres bundfreies Clavichord von Christian Gottlob Hubert aufbewahrt. Nach<br />
den Notizen von Dr. Ulrich Rück war auf der jetzt fehlenden Etikette das Jahr 1771 zu<br />
lesen.<br />
2 [Sie] Die Signatur auf einem handgeschriebenen Zettel ist modern.