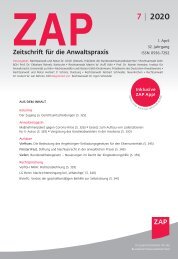ZAP-0617_web
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fach 2, Seite 642<br />
Vertragsstrafen<br />
Allgemeines Zivilrecht<br />
von Geld gerichtet. In diesem Inhalt des Anspruchs unterscheidet er sich von Konstellationen, in denen –<br />
z.B. für den Fall rechtzeitiger Zahlung – eine Belohnung in Form eines Teilverzichts vereinbart wird<br />
(„Verfallklausel mit Belohnungscharakter“, vgl. BGH NJW 2010, 859; OLG München NJW-RR 1998, 1663);<br />
allerdings sind die Regeln über die Vertragsstrafe, z.B. die Herabsetzung gem. § 343 BGB, wegen der<br />
weitgehend gleichläufigen Interessenlage zumindest stellenweise auf Verfallklauseln anzuwenden (BGH<br />
NJW 1968, 1625; NJW-RR 1993, 464, 465). Das Vertragsstrafeversprechen ist stets unselbstständig,<br />
nämlich von einer Hauptverbindlichkeit abhängig, wobei die Hauptverbindlichkeit auf ein Tun oder auf ein<br />
Unterlassen gerichtet sein kann. Ist die Hauptverbindlichkeit, z.B. wegen Formmangels, nicht gegeben, so<br />
besteht auch der akzessorische Vertragsstrafeanspruch nicht (§ 344 BGB). Diese Akzessorietät trennt die<br />
Vertragsstrafe vom Reugeld (§ 353 BGB), das gerade nicht auf die Erfüllung einer Hauptverbindlichkeit<br />
zielt, sondern dem Schuldner die Möglichkeit gewähren soll, sich von einer Verbindlichkeit zu lösen.<br />
Praxishinweis:<br />
Bei der Prüfung, ob eine Vertragsstrafeklausel vorliegt, sollte der Praktiker nicht am Wortlaut haften.<br />
Insbesondere sollte er nicht isoliert darauf abstellen, ob eine Zahlung versprochen wird, sondern die<br />
Interessenlage ergründen. Zeigt diese Parallelen zum Vertragsstrafeversprechen, so ergeben sich aus<br />
den besonderen Schutzvorschriften der Vertragsstrafe, wie z.B. den §§ 343 und 555 BGB, zusätzliche<br />
Verteidigungsmöglichkeiten.<br />
2. Notwendige Vertragserklärungen von Gläubiger und Schuldner<br />
Wie schon aus der Stellung der Vertragsstrafe im 3. Abschnitt des Allgemeinen Teils des Schuldrechts<br />
deutlich wird, entsteht der Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nicht durch eine einseitige<br />
Erklärung des Schuldners, sondern durch einen zwischen Schuldner und Gläubiger geschlossenen<br />
Vertrag. § 339 BGB und § 12 UWG, wo nur von einem „Versprechen“ bzw. der „Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung“<br />
die Rede ist, sollen also nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Zustandekommen<br />
einer rechtswirksamen Vertragsstrafevereinbarung auch eine Erklärung des Gläubigers voraussetzt.<br />
Gläubiger und Schuldner können sich grundsätzlich formfrei erklären. Im praktisch wichtigsten<br />
Fall, nämlich im Zusammenspiel mit einem Unterlassungsversprechen, bedarf die Gesamterklärung des<br />
Schuldners (aber nicht des Gläubigers!) der Schriftform, da das Unterlassungsversprechen ein<br />
abstraktes Schuldversprechen ist und somit nach § 780 BGB der Schriftform bedarf.<br />
Hinweis:<br />
Anderes gilt nur für Kaufleute, die sich nach §§ 350, 343 HGB formfrei unterwerfen können, das Versprechen<br />
aber auf Verlangen des Gläubigers schriftlich bestätigen müssen (BGH NJW 1990, 3147 – Unterwerfung<br />
durch Fernschreiben).<br />
3. Auswirkung auf die Wiederholungsgefahr, Entstehung des Anspruchs auf Vertragsstrafe<br />
Trotz der Notwendigkeit der Vertragserklärung des Gläubigers kommt bereits dem alleinigen Vertragsstrafeversprechen<br />
des Schuldners in bestimmt gelagerten Fällen eine rechtliche Wirkung zu:<br />
Obwohl mit ihr noch kein Unterlassungsvertrag zustande kommt, lässt bereits die einseitige mit einer<br />
Vertragsstrafe bewehrten Unterwerfungserklärung als solche die Wiederholungsgefahr entfallen (BGH<br />
GRUR 2006, 878, Rn 20 – Vertragsstrafevereinbarung). Die Geltendmachung eines Anspruchs auf<br />
Zahlung einer Vertragsstrafe setzt hingegen das rechtswirksame Zustandekommen eines Unterlassungsvertrags<br />
durch Erklärungen beider Parteien voraus.<br />
Praxishinweis:<br />
Gläubiger sollten deshalb darauf achten, die – ggf. modifizierte – Unterlassungserklärung des Schuldners<br />
nachweisbar anzunehmen; problematisch kann aus Nachweisgründen insbesondere die Annahme per<br />
Telefax sein, da hier durch den OK-Vermerk kein Zugangsnachweis zu führen ist (vgl. BGH NJW 2013, 2514;<br />
BGH, Urt. v. 21.7.2011 – IX ZR 148/10).<br />
300 <strong>ZAP</strong> Nr. 6 15.3.2017