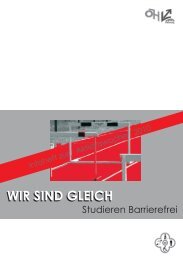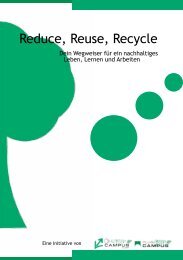Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Faust</strong> I gliedert sich in zwei große Tragödien: Gelehrten- und Gretchentragödie. In<br />
der Gelehrtentragödie verzweifelt <strong>Faust</strong> an seinem Dasein als Gelehrter. Zugleich ist sie<br />
eine beißende Satire auf die Aufklärung und die Vertreter aller Fakultäten (Philosophie,<br />
Medizin, Theologie). Dies hat aber auch handlungstechnische Relevanz, ist es doch ein<br />
Brückenschlag zur persönlichen Tragödie <strong>Faust</strong>s: Die Verzweiflung über seine scheinbar<br />
erfolglosen Bemühungen in der Wissenschaft ist die Voraussetzung für den Teufelspakt.<br />
Solche Parallelen setzen sich durch den gesamten Text hin fort. So ist das Einsetzen des<br />
Frühlings in der Vor dem Tor-Szene ein Symbol für die Öffnung <strong>Faust</strong>s zur Welt und<br />
zur lebendigen Erfahrung, erste Zeichen dafür, dass sich <strong>Faust</strong> von der Studierstube, der<br />
Wissenschaft abwenden wird. Erst diese Öffnung <strong>Faust</strong>s ermöglicht die Verbindung mit<br />
Mephisto in Form der Wette beziehungsweise des Paktes.<br />
Zwischen Gelehrten- und Gretchentragödie begibt sich <strong>Faust</strong> auf eine Irrfahrt mit<br />
Mephisto, beginnend mit Auerbachs Keller in Leipzig. Diese Szene ist eine zugespitzte Satire<br />
auf Adel und Klerus und auch auf die revolutionären Bestrebungen des Volks – Goethe<br />
selbst war kein Freund der Französischen Revolution. Eine weitere Szene der Irrfahrt<br />
ist die Hexenküche. Darin wird <strong>Faust</strong> durch einen Zaubertrank verjüngt, das Irrationale<br />
hält nun Einzug. Gleichzeitig verdeutlicht sich <strong>Faust</strong>s Disposition zur Sinnlichkeit, die<br />
nun bei der Begegnung mit Gretchen offen zu Tage tritt.<br />
Die Gretchenhandlung ist dramaturgisch kompakt und subtil gebaut. Sie reicht von<br />
der Verführung und den Verirrungen Gretchens bis hin zu ihrem Wahnsinn. Die gesellschaftliche<br />
Ächtung Gretchens in der Szene Am Brunnen markiert einen ersten Höhepunkt<br />
in der Gretchentragödie. Verschiedene gesellschaftliche Schichten üben darin harsche<br />
Kritik an Gretchen, die ein uneheliches Kind erwartet. In der Szene Im Dom wird<br />
Kirchenkritik geübt, die Ächtung durch die Kirche treibt Gretchen zum Kindesmord,<br />
einer schieren Verzweiflungstat.<br />
Die Szene der Walpurgisnacht ist zwischen Gretchens Tat und dem Ende eingeschaltet.<br />
Sie hebt die verschiedenen Seiten <strong>Faust</strong>s hervor – einerseits die Liebe zu Gretchen,<br />
andererseits dem Nachgeben niederer Triebe. Am Ende von <strong>Faust</strong> I wird Gretchen gerettet<br />
und Mephisto zieht <strong>Faust</strong> fort – ein Ende, das mit <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> nur sehr wenig zu tun hat.<br />
Die Allegorie und die Phantasmagorie gelten als unterscheidende Merkmale von <strong>Faust</strong> <strong>II</strong><br />
im Vergleich zu <strong>Faust</strong> I. Letzterer ist streng nach dem Schema einer Tragödie aufgebaut.<br />
Zum Verhältnis von <strong>Faust</strong> und Mephisto gibt es in der Forschung verschiedene Auffassungen:<br />
<strong>Faust</strong> und Mephisto wurden lange als Antagonisten von Gut und Böse gedeutet.<br />
Seit dem 2. Weltkrieg wird Mephisto jedoch eher als Alter Ego <strong>Faust</strong>s gesehen.<br />
<strong>Faust</strong> <strong>II</strong><br />
Entstehungsgeschichte<br />
Am Höhepunkt von Goethes klassischer Periode (um 1800) wurde der Helena-Akt ausgearbeitet.<br />
Danach, in den Jahren zwischen 1800 und 1825, ignorierte Goethe den <strong>Faust</strong><br />
<strong>II</strong> fast vollständig. Stattdessen schrieb er in dieser Zeit die Wahlverwandtschaften, seine<br />
Farbenlehre und Wilhelm Meisters Lehrjahre.<br />
Ein Brief von 1818 belegt, dass Goethe selbst nicht mehr an die Vollendung des <strong>Faust</strong><br />
glaubte. Im gleichen Jahr hatte er nämlich den <strong>Faust</strong> von Christopher Marlowe gelesen und<br />
war sehr beeindruckt. Doch 1825 nahm Goethe die Arbeit am <strong>Faust</strong> wieder konzentriert<br />
auf und vollendete <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> im Juli 1831. Den <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> wollte Goethe zu Lebzeiten<br />
aber nicht publizieren lassen, weil er ein, in seinen Augen, absehbares Unverständnis des<br />
Publikums befürchtete. Seine Bedenken äußerte Goethe in einen Brief an Wilhelm von<br />
Helena: Tochter von Zeus und Leda<br />
bzw. Nemesis. Für ihre außergewöhnliche<br />
Schönheit bekannt, wurde<br />
Helena von Paris nach Troja entführt.<br />
Nach zehn Jahren Krieg und unter<br />
Aufbietung aller Helden Griechenlands<br />
gelang ihre Befreiung. [WWM]<br />
Christopher Marlowe: (1564–<br />
1593) Englischer Dichter und Dramatiker.<br />
Stellte Machtverhältnisse und<br />
Glauben seiner Zeit in Frage und wird<br />
seit dem 20. Jh. als ebenbürtiger Zeitgenosse<br />
Shakespeares gesehen. Neben<br />
Doctor <strong>Faust</strong>us (1589, 1593) sind<br />
vor allem sein letztes Stück Massacre<br />
at Paris (1593) sowie sein Liebesgedicht<br />
The Passionate Shepherd to His<br />
Love (nach 1580) bekannt. [OCL]<br />
11