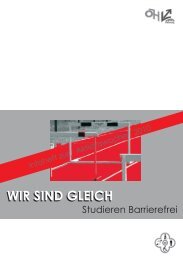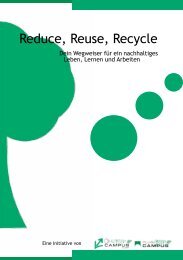Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Faust</strong> als Träger moderner Züge<br />
<strong>Faust</strong> repräsentiert somit moderne Grundhaltungen und ist im Text eine Idealvorstellung,<br />
eine Rolle und eben nicht so sehr ein Individuum. Er tritt als Militärstratege und später<br />
als Kolonisator auf, ist also Repräsentant für die jeweilige Weltanschauung, Ideologie.<br />
Der Figur des <strong>Faust</strong> kommt dadurch eine zentrale Funktion zu: Er soll den modernen<br />
autonomen Menschen vorführen. Denn für Goethe ist jene Autonomie typisch für<br />
den neuzeitlichen Menschen. Eine Autonomie, die auch Unabhängigkeit von geistlicher<br />
Metaphysik bedeutet. Und so tritt <strong>Faust</strong> in Opposition zu Kräften, die Vertreter der<br />
mittelalterlich geprägten Ordnung und gegen die Autonomie des Menschen gerichtet<br />
sind, wie zum Beispiel der Kanzler des Reiches (Vers 44894 f.), der meint: »Natur ist<br />
Sünde, Geist ist Teufel«. Schließlich waren Klerus und Adel die Stützen der Monarchie<br />
und dafür wurden sie dann von der weltlichen Krone durch Ländereien, Geld, Macht<br />
und Einfluss belohnt. Doch <strong>Faust</strong>s Auflehnung gegen solche Mächte ist selten von Erfolg<br />
gekrönt, scheitert er doch stets in seinem Streben.<br />
Wie Goethe selbst festhält, ist <strong>Faust</strong> ein Mensch, der sich beschränkt fühlt durch<br />
das Dasein auf der Erde und den Besitz weltlicher Güter. <strong>Faust</strong> ist ein Geist, der nach<br />
allen Seiten sich wendend, immer wieder zurückkehrt – eine unglückliche Existenz. Ein<br />
Zustand der sich in Goethes Augen analog zur modernen Gesinnung, Existenz verhält.<br />
<strong>Faust</strong> repräsentiert also ein spezifisch modernes unglückliches Bewusstsein – das sich<br />
gegen alte Mächte und Vorstellung zwar wehrt, sie aber nicht brechen kann.<br />
Der erste Akt<br />
Im ersten Akt überschreitet Goethe die Grenze zu jener Kunst, die sich nicht durch reinen<br />
»Schönheits-Charakter« auszeichnet. Für die Figuren- und Denkwelt gibt es keine<br />
harmonische Einheit von Sinnlichem und Sittlichem. Das fortschreitende Leben brau<br />
cht eine andere Form von Kunst, die Auffassung von Kunst wird immer stärker philosophisch.<br />
In diesem Sinn ist <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> das modernste Werk Goethes.<br />
<strong>Faust</strong> <strong>II</strong> zeichnet sich unter anderem durch seine Natursymbolik aus – einer der<br />
wichtigsten Schlüssel für das Werk. So entsteht die Dynamik im Text durch die stetige<br />
Verwandlung. Dies ist ein Grundprinzip, das bei Goethe für die Naturformen ganz allgemein<br />
gilt. Die Verwandlung hat universelle Gültigkeit. Goethe meint dazu »Gestaltenlehre<br />
sei Verwandlungslehre«, die Lehre von den Metamorphosen wäre also der Schlüssel<br />
zu den Naturformen.<br />
Ein Beispiel ist der erste Akt. Am Anfang zeigt er <strong>Faust</strong> schlafend; ein Schlaf, in dem<br />
er vergessen und gleichzeitig bereit werden muss für neue Taten (Vers 4650). Gretchens<br />
und <strong>Faust</strong>s Schuld werden abgelegt. Und auch die Frage des Ethischen und Moralischen<br />
spielt keine Rolle mehr, sie war in <strong>Faust</strong> I noch ein wichtiger Antrieb.<br />
Die Perspektive ist nicht länger die <strong>Faust</strong>s. In <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> wird in der Welt das Objektiv-<br />
Seiende dargestellt, die Subjektivität tritt in den Hintergrund. So gibt es diesbezüglich<br />
auch keinen dramatischen Austausch mehr zwischen den Personen. Eine Voraussetzung<br />
für <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> wäre demnach die Dominanz der naturphilosophischen und erkenntnistheoretischen<br />
Erkenntnisse.<br />
Anmutige Gegend<br />
Die Szene beginnt mit Ariel (vgl. Prolog im Himmel) und endet mit dem Monolog <strong>Faust</strong>s.<br />
Sie liest sich wie ein Programmheft – bereits die gesamte Ästhetik von <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> wird hier<br />
umrissen. Ariels Worte (Vers 4658–4665) klingen zwar verführerisch, aber sie werden<br />
Romantik: Kulturgeschichtliche<br />
Epoche, die vom Ende 18. Jahrhundert<br />
bis Mitte 19. Jahrhundert Kunst<br />
als aus der Einsamkeit des Genies<br />
geboren sieht. Inspirierende und enthusiastische<br />
Innerlichkeit wird propagiert,<br />
die Gefühlswelt in Vers- und<br />
Prosadichtung betont. [MLL]<br />
Idealismus: Bezeichnet philosophiegeschichtlich<br />
die letzten Dekaden<br />
des 18. Jahrhunderts, in denen<br />
die menschliche Erkenntnis vor dem<br />
Wirklichen zurückstecken muss. So<br />
könne der Mensch die Wirklichkeit<br />
nur teilweise erkennen, laut Hegel<br />
wären die Dinge nämlich Gegenstand<br />
einer gottgleichen Einheit. [MLK]<br />
Neuzeit: Geschichtliche Epoche,<br />
welche Mitte des 15. Jahrhunderts<br />
einsetzt, das Mittelalter beendet und<br />
bis in die Gegenwart hineinreicht.<br />
Entdeckung Amerikas 1492 und Martin<br />
Luthers Reformation von 1517<br />
sind Eckpunkte jener beginnenden<br />
Zeit, welche die absolutistische Monarchie<br />
und die Vorrangstellung der<br />
Kirche beenden sollte. [ZWK]<br />
Ancient Régime: Französisch für<br />
die »alte Regierungsform«, bezeichnet<br />
der Ausdruck das absolutistische<br />
Frankreich vor 1789 und allgemein<br />
die politischen und gesellschaftlichen<br />
Verhältnisse im Europa des<br />
17./18. Jahrhunderts, die auf einer<br />
privilegierten Adelswelt aufbauten.<br />
[ZWK]<br />
Weimarer Klassik: Auf wenige<br />
Autoren begrenzte Richtung der<br />
deutschen Kulturgeschichte. Zwischen<br />
Sturm und Drang sowie der<br />
Hochromantik angesiedelt, bestand<br />
sie von ca. 1786 bis 1805. Ein<br />
Großteil von Goethes Werken sowie<br />
Schillers spätere Arbeiten werden<br />
ihr zugerechnet. Die Weimarer Klassik<br />
begrenzte das schwärmerische<br />
Subjekt des Sturm und Drang und<br />
distanzierte sich durch Formstrenge<br />
und Stilisierung vom unmittelbaren,<br />
überschwänglichen künstlerischen<br />
Ausdruck. [MLL]<br />
15