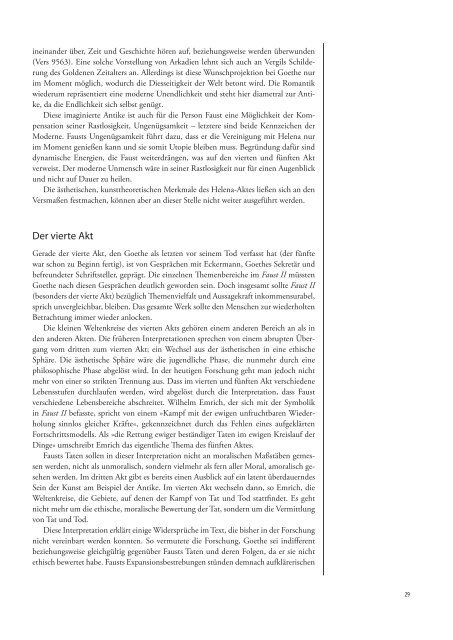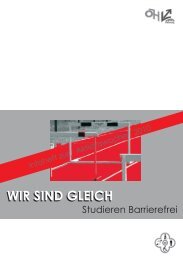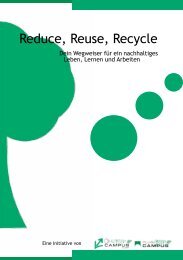Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ineinander über, Zeit und Geschichte hören auf, beziehungsweise werden überwunden<br />
(Vers 9563). Eine solche Vorstellung von Arkadien lehnt sich auch an Vergils Schilderung<br />
des Goldenen Zeitalters an. Allerdings ist diese Wunschprojektion bei Goethe nur<br />
im Moment möglich, wodurch die Diesseitigkeit der Welt betont wird. Die Romantik<br />
wiederum repräsentiert eine moderne Unendlichkeit und steht hier diametral zur Antike,<br />
da die Endlichkeit sich selbst genügt.<br />
Diese imaginierte Antike ist auch für die Person <strong>Faust</strong> eine Möglichkeit der Kompensation<br />
seiner Rastlosigkeit, Ungenügsamkeit – letztere sind beide Kennzeichen der<br />
Moderne. <strong>Faust</strong>s Ungenügsamkeit führt dazu, dass er die Vereinigung mit Helena nur<br />
im Moment genießen kann und sie somit Utopie bleiben muss. Begründung dafür sind<br />
dynamische Energien, die <strong>Faust</strong> weiterdrängen, was auf den vierten und fünften Akt<br />
verweist. Der moderne Unmensch wäre in seiner Rastlosigkeit nur für einen Augenblick<br />
und nicht auf Dauer zu heilen.<br />
Die ästhetischen, kunsttheoretischen Merkmale des Helena-Aktes ließen sich an den<br />
Versmaßen festmachen, können aber an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.<br />
Der vierte Akt<br />
Gerade der vierte Akt, den Goethe als letzten vor seinem Tod verfasst hat (der fünfte<br />
war schon zu Beginn fertig), ist von Gesprächen mit Eckermann, Goethes Sekretär und<br />
befreundeter Schriftsteller, geprägt. Die einzelnen Themenbereiche im <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> müssten<br />
Goethe nach diesen Gesprächen deutlich geworden sein. Doch insgesamt sollte <strong>Faust</strong> <strong>II</strong><br />
(besonders der vierte Akt) bezüglich Themenvielfalt und Aussagekraft inkommensurabel,<br />
sprich unvergleichbar, bleiben. Das gesamte Werk sollte den Menschen zur wiederholten<br />
Betrachtung immer wieder anlocken.<br />
Die kleinen Weltenkreise des vierten Akts gehören einem anderen Bereich an als in<br />
den anderen Akten. Die früheren Interpretationen sprechen von einem abrupten Übergang<br />
vom dritten zum vierten Akt; ein Wechsel aus der ästhetischen in eine ethische<br />
Sphäre. Die ästhetische Sphäre wäre die jugendliche Phase, die nunmehr durch eine<br />
philosophische Phase abgelöst wird. In der heutigen Forschung geht man jedoch nicht<br />
mehr von einer so strikten Trennung aus. Dass im vierten und fünften Akt verschiedene<br />
Lebensstufen durchlaufen werden, wird abgelöst durch die Interpretation, dass <strong>Faust</strong><br />
verschiedene Lebensbereiche abschreitet. Wilhelm Emrich, der sich mit der Symbolik<br />
in <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> befasste, spricht von einem »Kampf mit der ewigen unfruchtbaren Wiederholung<br />
sinnlos gleicher Kräfte«, gekennzeichnet durch das Fehlen eines aufgeklärten<br />
Fortschrittsmodells. Als »die Rettung ewiger beständiger Taten im ewigen Kreislauf der<br />
Dinge« umschreibt Emrich das eigentliche Thema des fünften Aktes.<br />
<strong>Faust</strong>s Taten sollen in dieser Interpretation nicht an moralischen Maßstäben gemessen<br />
werden, nicht als unmoralisch, sondern vielmehr als fern aller Moral, amoralisch gesehen<br />
werden. Im dritten Akt gibt es bereits einen Ausblick auf ein latent überdauerndes<br />
Sein der Kunst am Beispiel der Antike. Im vierten Akt wechseln dann, so Emrich, die<br />
Weltenkreise, die Gebiete, auf denen der Kampf von Tat und Tod stattfindet. Es geht<br />
nicht mehr um die ethische, moralische Bewertung der Tat, sondern um die Vermittlung<br />
von Tat und Tod.<br />
Diese Interpretation erklärt einige Widersprüche im Text, die bisher in der Forschung<br />
nicht vereinbart werden konnten. So vermutete die Forschung, Goethe sei indifferent<br />
beziehungsweise gleichgültig gegenüber <strong>Faust</strong>s Taten und deren Folgen, da er sie nicht<br />
ethisch bewertet habe. <strong>Faust</strong>s Expansionsbestrebungen stünden demnach aufklärerischen<br />
29