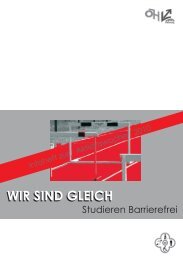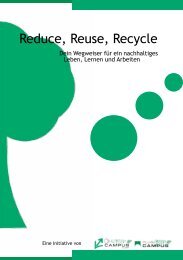Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
an der Laokoongruppe aufzeigt. Es geht um die Fragen der realistischen Darstellung bzw.<br />
der Darstellung eines Ideals. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele werden<br />
in der Laokoongruppe in Balance gehalten, die Affekte und Gefühle werden gebändigt,<br />
was ein Hinweis auf die stoische Ruhe ist.<br />
Goethe stilisiert in dieser Weise Helenas Seelengröße und Geistesstärke, die ihr helfen,<br />
den Affektsturm in Anbetracht der Lebensbedrohung durch Menelaos zu beherrschen.<br />
Weiters zeichnet Helena das Schickliche, das sich Geziemende aus, das die stoische<br />
Haltung ebenso kennzeichnet. Ein Beispiel für das sich Geziemende, worin sich<br />
Parallelen zu Iphigenie finden, sind etwa im Auftrittsmonolog Helenas zu finden (Vers<br />
8604 ff). Ihre Haltung zeigt Würde und auch Distanz zum Geschehen. Ethische Haltung<br />
und ästhetische Vollendung sind die Komponenten des Ideals, das Helena verkörpert.<br />
Der Schauplatz der dritten Szene ist Arkadien, eine Landschaft im Zentrum der Peloponnes.<br />
Es trägt Züge einer Innerlichkeit, die poetisch überhöht ist und einen idyllischen<br />
Rückzugsort darstellt. Euphorion ist eine allegorische Figuration der subjektivistischen<br />
Poesie, in der eine Betonung und hohe Bewertung der dichterischen, künstlerischen und<br />
menschlichen Subjektivität liegt. Für Goethe liegt hier in der neuen romantischen Poesie<br />
ein Höhepunkt, eine Grenzüberschreitung dieser Entwicklung.<br />
Zu Euphorion<br />
Euphorion ist gezeichnet von einer tragischen Hybris, dem Nichterkennen von eigenen<br />
Grenzen, die Goethe mit seinen eigenen Reminiszenzen an den Urfaust in der Sturm<br />
und Drang Zeit verbindet, so z.B. an den Werther (Vers 9691 ff.). Euphorion wäre die<br />
allegorisierte Romantik. Der Chor ist gestaltet als charakterlicher Wankelmut, damit<br />
verbunden verkörpert der Chor die Stimme eines Modepublikums.<br />
Die Romantik erscheint wie eine radikalisierende Wiederkehr eines übersteigerten<br />
Subjektivismus. Dies zeigt sich auch an Euphorions hoffnungsloser Verfallenheit an sich<br />
selbst, er ist einer übersteigerten Egozentrik zum Opfer gefallen. Auch die musikalischen,<br />
gefühlsbetonten Aspekte der Romantik finden sich in <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> wieder. Das sich Bändigen,<br />
das in Bezug auf Euphorion häufiger relevant ist, setzt sich deutlich vom Urfaust und von<br />
den Motiven der Sturm und Drang Zeit ab. Im Gegensatz zur Romantik soll man sich<br />
die der Antike in einer produktiven Neuaneignung im humanistisch-ästhetischen Sinne<br />
neu zu Eigen machen. Vieles im Helena-Akt weist auf die beiden letzten Akte hin, die<br />
Sphären des zivilisatorischen Fortschritt und seiner zerstörerischen Dimensionen.<br />
Szene Innerer Burghof<br />
Allgemein zeigt sich der Helena-Akt als eine Verbindung des griechisch-humanistischen<br />
Ideals, das das ethisch Gute und das Schöne zum Edlen vereint. Wobei das Edle mit ritterlichen<br />
Idealen gepaart ist. An dieser Stelle wird die aristokratisch-höfische »Großheit«<br />
in Helena mit <strong>Faust</strong>, dem Vertreter der ritterlich-höfischen Würde, neu verbunden. Als<br />
Fürst tritt <strong>Faust</strong> Helena entgegen. Die höfische aristokratische Kultur sieht Goethe nicht<br />
kritisch, sondern als ein Medium der Verbindung und Begegnung.<br />
In der Szene Innerer Burghof begegnen sich thematisch Moderne und Antike, außerdem<br />
kommt es zu einer Vollendung der Kultur sowie der Gewinnung idealer Natur. Die<br />
Szene handelt vom Ethos und ist dabei stark beeinflusst von der antiken Stoa und von<br />
Winckelmanns Schriften. Der Rückgriff auf die Stoa, mit dem Ideal der Mäßigung und<br />
Bändigung, ist die Grundlage für das Ideal. So entwirft die Chorführerin in Vers 9127<br />
bis 9134 ein Gegenbild zu Helena, in dem Helena selbst allerdings schon angedeutet<br />
wird. Das stoisch grundierte Ideal beinhaltet eine große innerliche Unabhängigkeit, die<br />
Laokoon: Priester aus Troja, der seine<br />
Mitbürger vor dem Trojanischen Pferd<br />
warnte. Doch zwei riesige Schlangen<br />
töteten ihn und seine zwei Söhne. Die<br />
Trojaner nahmen daraufhin das Pferd<br />
in die Stadt. Die Laokoongruppe ist<br />
eine von drei antiken Künstlern aus<br />
Rhodos geschaffene Statue, die eben<br />
an jene Geschichte erinnert. [WWM]<br />
Menelaos: Jüngerer Bruder Agamemnons,<br />
bekommt den Thron<br />
von Sparta und heiratet die schöne<br />
Helena. Nach deren Entführung tut<br />
sich Menelaos im Trojanischen Krieg<br />
im Zweikampf mit Paris hervor und<br />
kehrt erst nach achtjähriger Irrfahrt<br />
von der Eroberung Trojas zurück.<br />
[WWM]<br />
Iphigenie: Tochter von Agamemnon,<br />
die von ihrem Vater als Buße der<br />
Göttin Artemis geopfert werden soll.<br />
Doch die Göttin entführt das Mädchen<br />
nach Tauris. Dort muss Iphigenie<br />
ihr fortan als Priesterin dienen<br />
und ihr alle Fremden, die die Insel<br />
betreten, opfern. [WWM]<br />
27