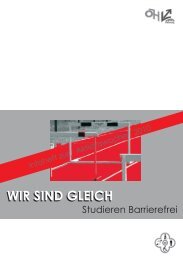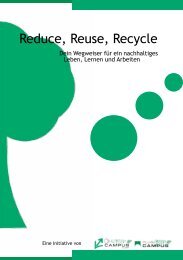Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
mit Helena, näher – somit auch durch die Konfrontation mit den Monstern. Als nächste<br />
Station folgt dann der Fluss Peneios.<br />
Das leitende Bild ist jenes des Traums. Das Thema des Traums lässt sich auf den<br />
gesamten zweiten Akt übertragen und somit ließe sich der Akt als Versuch <strong>Faust</strong>s, ein<br />
Leben wieder zu finden, das ihn an einen Traum erinnert hat, interpretieren.<br />
Die darauf folgende Chiron-Passage wird in der Forschung durchaus als ironisch gesehen,<br />
die der Naivität der Anbetung des Südens durch die Romantiker entgegengesetzt<br />
wird.<br />
Rolle der Musik<br />
Die Szenenangaben beinhalten stets Vermerke zur Musik. So soll Musik erklingen, die<br />
das Arkadien idyllisch untermalen soll. Musikangaben finden sich auch bei den Sphinxen<br />
und den singenden Sirenen, wobei die Wirkung des Gesangs der Sirenen bei Mephisto<br />
nicht bis zum Herzen vordringt. Es wird erneut deutlich, dass Mephisto kein<br />
Recht im antiken Kosmos hat. Denn die Musik ist dem Schönen verbunden, gleichsam<br />
verführerisch und außerdem ist sie ein Antipode zur Erstarrung. Im Text wird also eine<br />
Opposition zwischen dem Granit, Material der Sphinx und Symbol der Bewahrung, und<br />
der Musik, dem Verführerischen, Verflüssigenden und trotzdem Beruhigenden sowie Lebenserweckenden,<br />
deutlich.<br />
Prinzip der Behaglichkeit – Neptunismus<br />
Im Alterswerk <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> zeigt sich Goethes Lust am Fabulieren. Dies führt dazu, dass<br />
Wichtiges von seiner Sinnschwere befreit werden soll. In zweideutigen Szenen kommt<br />
zum Beispiel das Verschmitzte deutlich zum Vorschein. Eine solche Interpretation wird<br />
durch Selbstäußerungen Goethes gestützt. In der Frage nach der ästhetischen Funktion<br />
der Kunst für die Gesellschaft, die seit der Aufklärung relevant ist, hat Goethe etwa<br />
seine Anforderungen im Alter durchaus zurückgenommen. Dadurch wird die These der<br />
Behaglichkeit Goethes weiter gestützt, er zeigt diese Distanz von überspannten Erwartungen<br />
im gesamten <strong>Faust</strong> <strong>II</strong>. Behaglichkeit tritt an die Stelle des Pathos, Gelassenheit an<br />
die Stelle des (gesellschaftlichen) Kämpferischen. Hegel hat diese Liberalität und den Altershumor<br />
unter dem Stichwort des »objektiven Humors« zusammengefasst, womit eine<br />
Haltung der Versöhnlichkeit gegenüber den Widrigkeiten der bürgerlichen Gesellschaft<br />
gemeint ist. Die Walpurgisnacht lässt also Gelassenheit und Heiterkeit erkennen.<br />
Im Text hat aber das seismische Beben nicht nur die geologische Welt verändert,<br />
sondern auch die soziale und politische Welt der klassischen Walpurgisnacht (Vers 7875).<br />
Das gegenseitige Vernichten, dieser darwinistische Kampf (Vers 7884-7947), in dem<br />
kurzzeitig die Stärkeren siegen und schließlich eine Macht von außen ein Ende setzt,<br />
ließe sich als Allegorie der Französischen Revolution bis zur Machtübernahme Napoleons<br />
deuten. Der Kampf zwischen Kranichen und Pygmäen würde dann auf den Kampf<br />
zwischen Neureichen aus dem dritten Stand, die Revolutionsgewinner, und Anhängern<br />
der französischen Monarchie anspielen. Und die Freisetzung des Goldes aus dem Boden<br />
wäre eine Allegorie für die gewaltsame Kapitalisierung von Grund in Boden im Verlauf<br />
der Revolution. Goethe war von diesen unausweichlichen Vorgängen der Revolution<br />
fasziniert wie von einem Naturereignis. Auch Napoleon übte auf Goethe eine große<br />
Faszination aus. Er traute ihm eine ungeheure Kraft in der Umgestaltung Europas zu.<br />
Die Klassenkämpfe der Französischen Revolution sind Folgen einer Umwälzung, die an<br />
sich produktiv ist, die aber zerstört wird durch die moralische Wendung zum Schlechten.<br />
Die Akteure sind dem Geschehen moralisch schlichtweg nicht gewachsen. Zerstörend<br />
Chiron: In der griechischen Mythologie<br />
ein weiser, menschenfreundlicher<br />
Kentaur, sprich Pferdemensch. Erzieher<br />
großer Helden wie zum Beispiel<br />
des Achilleus. [WWM]<br />
Georg Wilhelm Friedrich Hegel:<br />
(1770–1831) Deutscher Philosoph,<br />
der in die Phänomenologie des Geistes<br />
(1807) den Bildungsgang des<br />
menschlichen Geistes vom Bewusstsein<br />
zum spekulativen Denken der<br />
Philosophie verfolgt. In den posthum<br />
veröffentlichen Schriften Vorlesungen<br />
über Ästhetik (1835–1838) wird der<br />
Anspruch gestellt, nicht nur die Geschichte<br />
der Kunst, sondern auch die<br />
Idee des Kunstschönen systematisch<br />
zu erfassen. Auffallend ist an den<br />
Schriften die Idealisierung antiker<br />
Kunst, besonders der Plastiken sowie<br />
der Dramen, sprich der Tragödien.<br />
Prosa stünde dagegen im Zeichen<br />
des sich abzeichnenden »Ende der<br />
Kunst«. [MLK]<br />
23