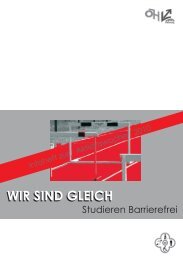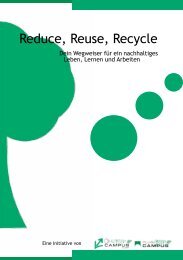Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dieser Koketterie. Auch in Goethes Unterhaltung deutscher Ausgewanderten wird diese<br />
Haltung des Adels satirisch aufgearbeitet.<br />
Am Ende der Lustgarten-Szene ist der Narr der eigentliche Gewinner. Die Mummenschanzszene<br />
erscheint als die szenische, revueartige Darstellung des Wahnsinns, des<br />
Chaos, der Raserei. Ein Wahnsinn, der aus der Nivellierung der Stände resultiert. Die<br />
Abkehr von ständischen Prinzipien führe demnach laut Goethe in die Unfreiheit. Ein<br />
Punkt, der Goethe viel Kritik einbrachte. Da sich Goethe allerdings in seinem Spätwerk<br />
von allen Eindeutigkeiten losgesagt hat, können solche Kritiken nicht wirklich greifen,<br />
da sie nicht alle Aspekte von Goethes Einstellung erfassen.<br />
Nach der Mummenschanzszene folgen die ersten Vorboten der Helena-Handlung.<br />
Diese wird stärker mit <strong>Faust</strong> und Mephisto in Verbindung gebracht. So sind Paris und<br />
Helena Musterbilder von Mann und Frau – Musterbilder, zu denen der Teufel keinen<br />
Zugang hat. Es wird der Versuch sichtbar, die Macht des Teufels mit der antiken Heroine<br />
zurückzunehmen (Vers 6201). Diese Figuren sind der Gewalt des christlichen Teufels<br />
entzogen, Mephisto gerät an die Grenzen seiner eigenen Kunst. Mephisto ist nun in<br />
seinem Wesen unproduktiv, er kann nur bereits Gewesenes hervorbringen, nichts Eigenes.<br />
Helena aber ist einerseits eine Figur der Antike und andererseits der Inbegriff des<br />
gewesenen Seins. Sie ist also nicht nur historisch zu sehen, sondern verkörpert auch die<br />
Vergänglichkeit.<br />
Die Fragen des Seins, des Lebens und der Historizität haben bei Goethe immer auch<br />
Dimensionen seiner Kunstphilosophie, eine ontologische Dimension der antiken Kunst<br />
für die Moderne. Die antike Kunst ist also nichts, das längst vergangen wäre, sondern<br />
sie hat immer noch große Bedeutung für die Moderne: Die antike Kunst ist gleichzeitig<br />
Ursprungswelt der Moderne als auch ein mögliches Potential. Darin unterscheidet sich<br />
Goethe von Schiller, bei dem die Moderne die Folge der Vertreibung aus dem antiken<br />
Kunstparadies darstellt. Bei Schiller wird die Antike mit Idylle gleichgesetzt, die nicht<br />
in die Moderne zurückgeholt werden kann. Goethe begreift dagegen die antike Welt als<br />
Chance für die Gegenwart, solange sie nur richtig genutzt wird. Die antike Welt gibt so<br />
viel frei von der eigenen Menschenkraft, dass sie für die Moderne ein wichtiges kreatives<br />
Potential darstellt. Es findet eine Relativierung des historisch Entstandenen statt. Die<br />
Antike wird bei Goethe als ein Potential für neue kreative Möglichkeiten des Lebens und<br />
der Kunst gedeutet.<br />
Schließlich stand Goethe der Mittelalterideologie der Romantiker kritisch gegenüber,<br />
er hielt sie für reinen Eskapismus. Dies verdeutlicht sich in den Aussagen des Architekten<br />
über die gotische Kunst. Wie wichtig Goethe die Antike war, lässt sich auch daran<br />
erkennen, dass antike Kunstformen nicht einfach nur abgebildet, sondern neu geschaffen<br />
werden. Im Mittelpunkt steht das Lebendige, die Kraft und Energie, die diese Formen<br />
bereithalten, wenn man mit ihnen kreativ umgeht. Im <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> zeigt sich ein meisterhafter<br />
Umgang mit diesen Formen. So lässt sich zwar vieles auf seine Ursprünge zurückführen,<br />
z.B. die antiken Kunstformen – wesentlich wichtiger ist aber ihre Umgestaltung.<br />
Dabei bedient sich Goethe sogenannter »lebender Bilder«. Diese waren eine Art Gesellschaftsspiel<br />
im 18. Jahrhundert, bei dem berühmte Gemälde mit Szenen der antiken<br />
Mythologie durch lebende Personen nachgestellt wurden. Das Erscheinen Helenas ist<br />
diesen Bildern nachgestaltet.<br />
Und ist in <strong>Faust</strong> I die Figur <strong>Faust</strong>s in seiner Entwicklung und seinen Irrtümern noch<br />
psychologisch dargestellt, so ist dies in <strong>Faust</strong> <strong>II</strong> nicht mehr der Fall. Im ersten Akt tritt<br />
er in der Maske Plutos’ auf. Die Masken sind nicht mehr Teil einer psychologischen Entwicklung,<br />
sondern Ausdruck der Prinzipien Wiederholung, Variation und Steigerung.<br />
Ontologie: Teil der antiken Philosophie,<br />
die das eigentliche Wesen der<br />
Entitäten (Dinge) erforscht. In der<br />
modernen Philosophie werden diese<br />
Untersuchungen auf die gesamte<br />
Existenz ausgeweitet. [DDP]<br />
Pluto: Er ist der Gott des Reichtums<br />
und Sohn von Demeter, der Göttin der<br />
Fruchtbarkeit. Nicht zu verwechseln<br />
mit Pluto, dem Beinamen von Hades,<br />
dem Gott der Unterwelt. [WWM]<br />
19