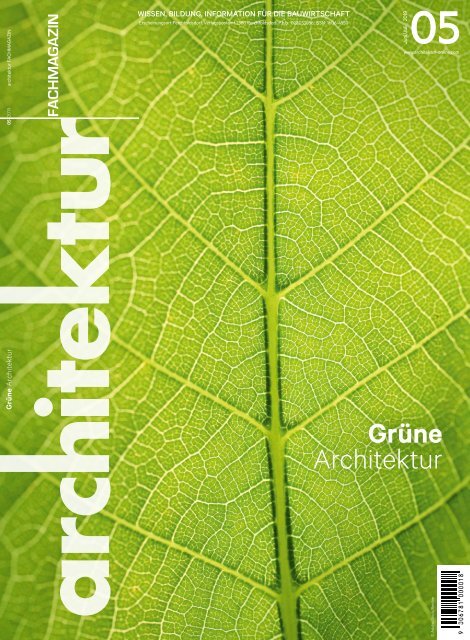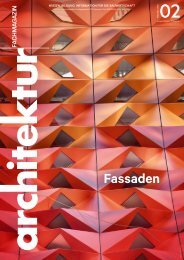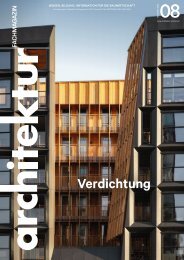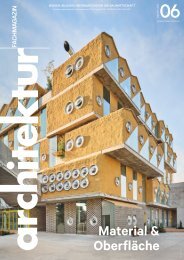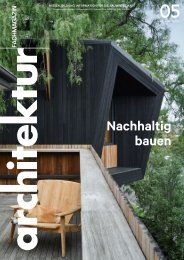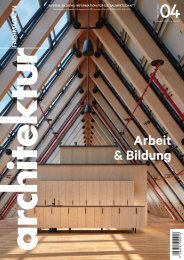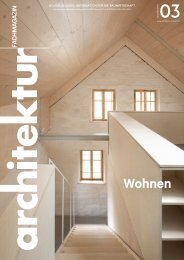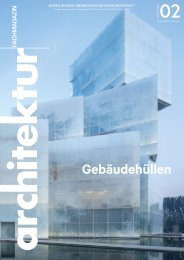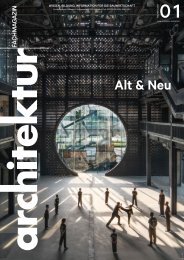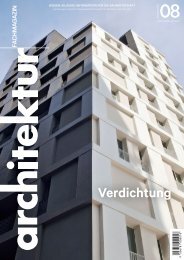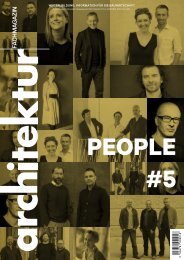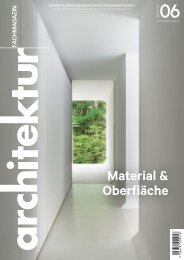architektur Fachmagazin Ausgabe 5 2019
gruene Architektur - Architektur Fachmagazin - Architekten - 2019 - Projekte - gruener Leben - Naturmaterialien - Planer - Ingenieure - Lesen - Zeitschrift - Bau - Interior Design - Sanitär - Baustoffe - Licht
gruene Architektur - Architektur Fachmagazin - Architekten - 2019 - Projekte - gruener Leben - Naturmaterialien - Planer - Ingenieure - Lesen - Zeitschrift - Bau - Interior Design - Sanitär - Baustoffe - Licht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FACHMAGAZIN<br />
WISSEN, BILDUNG, INFORMATION FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT<br />
Erscheinungsort Perchtoldsdorf, Verlagspostamt 2380 Perchtoldsdorf. P.b.b. 02Z033056; ISSN: 1606-4550<br />
05<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Grüne Architektur<br />
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
05 <strong>2019</strong><br />
Juni/Juli <strong>2019</strong><br />
Grüne<br />
Architektur<br />
© Adobe Stock/Reicher
duscholux.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
3<br />
Editorial<br />
Genügt grüne Architektur?<br />
Grün oder blau, das ist die Frage. Vom Weltraum aus, von der ISS Raumstation,<br />
sieht unser Planet Erde – wegen der großen Wasserflächen<br />
– blau aus. Wir auf der Erde bezeichnen ihn als grünen Planeten. Grün<br />
ist für uns die Lebensgrundlage, ohne grüne Pflanzen entsteht kein<br />
Sauerstoff und das Leben auf der Erde würde versiegen.<br />
Was tun wir, was tut die Architektur, damit<br />
die Erde grün bleibt? Genügt es „grüne Architektur“<br />
(mit all ihren Ausprägungen) zu<br />
entwerfen, zu errichten? Oder müssen wir<br />
unseren Lebensstil grundlegend ändern,<br />
damit wir weiterhin grün sehen können?<br />
Wenn wir wie bisher die Ozeane mit Plastik<br />
zumüllen, wird der Planet bald nicht<br />
einmal mehr von oben blau aussehen. Urbane<br />
Agglomerationen kämpfen zurzeit mit<br />
den Hitzeinseln und im Moment scheint die<br />
Ampel für die Vorwärtsbewegung unserer<br />
Zivilisation bereits auf Orange zu stehen,<br />
der „point of no return“ ist nahe. Warten wir<br />
nicht, bis sie auf Rot umschaltet!<br />
Viele Beispiele von Architektur und Innovation<br />
zu diesem Thema enthält diese<br />
<strong>Ausgabe</strong> des <strong>Fachmagazin</strong> <strong>architektur</strong><br />
– alle versuchen einen kleinen Beitrag<br />
zur Verbesserung und zum Erhalt unserer<br />
(noch) grünen oder blauen Erde zu leisten.<br />
Ob durch das Aufgreifen und Aufwerten<br />
bereits vorhandener Bausubstanz, durch<br />
begrünte Fassaden und Architektur, durch<br />
Vermeidung von unnötigen Klimatisierungen,<br />
durch passiven Energietransfer, durch<br />
Bildung, durch Dachgärten, Pocket-Parks,<br />
Parklets, Urban Gardening oder die (fast)<br />
ausschließliche Verwendung von Holz oder<br />
Lehm als ressourcenschonender Baustoff<br />
– alle Wege führen nach Rom, wie man so<br />
schön sagt. Die Palette der Möglichkeiten in<br />
der Architektur, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit<br />
zu leisten, ist groß und wird ständig<br />
breiter. Im Großen und Ganzen gilt aber:<br />
Weniger und bescheidener ist manchmal<br />
mehr und auch besser!<br />
Neben den diesmal – aufgrund der gerade<br />
erwähnten Beispiele und auch Fragen<br />
– sehr aktuellen und auch vielfältigen Projektberichten<br />
erwarten Sie in dieser <strong>Ausgabe</strong><br />
auch ein gut bestücktes Potpurrie an<br />
internationalen Beispielen im Magazinbereich,<br />
interessante Fachberichte zum Thema<br />
Brandschutz und Lehmbau sowie die<br />
gewohnten Kolumnen.<br />
Viel Spaß beim Lesen und eine angenehme<br />
Sommerpause im hoffentlich noch nicht zu<br />
heißen Sommer wünscht Ihnen<br />
Peter Reischer<br />
Kreatives Bauen mit Metall<br />
DOMICO - IHR SPEZIALIST<br />
IN SACHEN METALLFASSADEN<br />
Hinterlüftete Planum®-Fassade<br />
Individuelle Gestaltungsvielfalt mit Deckbreiten von 200 - 800 mm sowie<br />
unterschiedlichen Fugenausbildungen und Verlegemöglichkeiten.<br />
• Durchdringungsfreie Befestigung der Außenschale<br />
• Projektbezogene Produktion mit hohem Vorfertigungsgrad<br />
• Systemlösung mit technischen Details für effiziente Montage<br />
DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG<br />
A-4870 Vöcklamarkt · Mösenthal 1 · Tel. +43 7682 2671-0<br />
office@domico.at · www.domico.at<br />
Foto: ©Sirona Dental Systems GmbH
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
Editorial 03<br />
Start 06<br />
Die Zukunft einer grünen Architektur<br />
Magazin 10<br />
Die flexible Wohnkapsel 46<br />
die Architektur der Zukunft?<br />
Architekturszene 52<br />
Bau & Recht 54<br />
Pocket-Parks 56<br />
Grüne Stadtoasen<br />
Grüne Architektur 60<br />
Ein biomimetischer Wald 64<br />
Palingenesis / Paris /<br />
Vincent Callebaut Architectures<br />
Grüner Flughafen 70<br />
Oslo International Airport /<br />
Gardermoen / Nordic –<br />
Office of Architecture<br />
Die Verlassenheit von Weihai 76<br />
Rocknave Teahouse / Weihai,<br />
Shandong / Trace Architecture Office<br />
(TAO)<br />
Ein Baumhaus als 80<br />
urbaner Wohnraum<br />
25 Verde / Turin, Italien / Luciano Pia<br />
Zurück zur Natur 86<br />
Alnatura Arbeitswelt / Darmstadt /<br />
haascookzemmrich STUDIO2050<br />
Geformt aus Erde 94<br />
Lehm als Baustoff<br />
Licht 96<br />
Produkt News 98<br />
edv 130<br />
AVA-Textdatenbanken<br />
4<br />
64 70<br />
80<br />
76<br />
86<br />
Inhalt<br />
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Laser Verlag GmbH; Hochstraße 103, A-2380 Perchtoldsdorf, Österreich<br />
CHEFREDAKTION Ing. Walter Laser (walter.laser@laserverlag.at) n REDAKTIONSLEITUNG mag. arch. Peter Reischer (rp)<br />
MITARBEITER Linda Pezzei, Dolores Stuttner, Mag. Heidrun Schwinger, DI Marian Behaneck, Mag. Matthias Nödl, Julia Mörzinger, Edina Obermoser<br />
GESCHÄFTSLEITUNG Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n LTG. PRODUKTREDAKTION Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14<br />
MEDIASERVICE RETAILARCHITEKTUR Marion Allinger (marion.allinger@laserverlag.at)<br />
GRAFISCHE GESTALTUNG Andreas Laser n WEB Michaela Strutzenberger n LEKTORAT Helena Prinz n DRUCK Bauer Medien & Handels GmbH<br />
ABONNEMENTS Abonnement (jeweils 8 <strong>Ausgabe</strong>n/Jahr): € 86,- / Ausland: € 106,-, bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):<br />
€ 56,- / Ausland: € 83,- (Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht mind. 6 Wochen vor Erscheinen der letzten <strong>Ausgabe</strong> eine schriftliche Kündigung bei uns einlangt.)<br />
EINZELHEFTPREIS € 12,- / Ausland € 13,50<br />
BANKVERBINDUNG BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000<br />
IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v; n ISSN: 1606-4550<br />
Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen. Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mitglied<br />
der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
DRUCKAUFLAGE 12.000 n ÖAK GEPRÜFTE VERBREITETE AUFLAGE 11.155 (Jahresschnitt 2018) n Österreichs meist verbreitete Architektur-Fachzeitschrift
wasserwellfit<br />
Das Wellfit-Duschsystem: HANSAEMOTION mit drei<br />
wohltuenden Regenerationsfunktionen auf Knopfdruck.<br />
Erholen, entspannen, Kraft tanken – jeden Tag aufs Neue.<br />
Mehr unter hansaemotion.hansa.com/de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
6<br />
Start<br />
Die Zukunft einer<br />
grünen Architektur<br />
Ständig wird (oder soll) Architektur effektiver, nachhaltiger werden, ständig<br />
entwickeln Wissenschaftler neue Konzepte zur Bekämpfung des Klimawandels:<br />
Spiegel im Weltraum halten die Sonnenstrahlung von der Erde fern, eine künstlich<br />
erzeugte Algenblüte frisst CO 2 auf – so klingen Geoengineering- oder Climateengineering-Pläne,<br />
mittels derer die Erderwärmung und damit der Klimawandel<br />
durch eine künstliche Manipulation aufgehalten werden soll. Die Auswirkungen<br />
solcher Eingriffe sind bisher zumeist nur theoretisch oder unzureichend erforscht.<br />
Text: Peter Reischer Illustrationen: Nicholas Stathopoulos<br />
Tatsache ist aber, dass der Mensch immer noch versucht,<br />
die Natur und die Architektur, die Schöpfung an sich anzupassen,<br />
statt sich endlich der Realität anzupassen. Diese<br />
Unbelehrbarkeit hat Nicholas Stathopoulos zum Anlass<br />
genommen, ein dystopisches Märchen über eine mögliche,<br />
immer wahrscheinlicher werdende Zukunft der Architektur<br />
zu entwerfen. Die Erzählung spielt in 100 Jahren.<br />
Früher Morgen 07.15 – Eine starke Windböe trifft<br />
Vater und Sohn, als das Frachtschiff v34 über<br />
ihre Köpfe hinweg fliegt und etwas, das wie ein<br />
künstlicher Wald aussieht, zu einem in der Nähe<br />
gelegenen Museum bringt.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
7<br />
Start<br />
Ein neuer Werkstoff für alle Oberflächen<br />
www.pandomo.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
8<br />
Start<br />
„Vor langer Zeit“, erzählt ein Mann seinem<br />
Sohn, während beide mit schweren Atemschutzgeräten<br />
und Schutzanzügen auf<br />
einer Hafenmauer sitzen, „war der Planet<br />
Erde von vielen Hügeln und großen Wäldern<br />
bedeckt. Sie existierten damals noch außerhalb<br />
unserer Museen. Wir kletterten auf<br />
diese Berge und konnten auch die Sonnenuntergänge<br />
sehen.“<br />
In dieser Geschichte sind die Wälder verschwunden<br />
und die Berge von Abgasen,<br />
Staub und Rauch verhüllt. Die Natur hat aufgehört<br />
zu existieren und eine Welt ähnlicher<br />
einer Marslandschaft zurückgelassen. Eltern<br />
erzählen ihren Kindern nur noch die Geschichten<br />
von Wäldern, Wiesen und Bergen,<br />
wie sie einst waren. Die Kinder staunen und<br />
können sich das nicht mehr vorstellen. Hunderte<br />
Jahre hat man die Natur und Mutter<br />
Erde als gegeben und selbstverständlich erachtet.<br />
Sie wurde sehenden Auges zerstört,<br />
Hektar Waldflächen verdorrten und wurden<br />
von Käfern gefressen, Städte expandierten<br />
und verbrauchten die natürlichen Ressourcen.<br />
Die Menschheit ignorierte die Zeichen<br />
des Klimawandels und als es ernst wurde –<br />
war es zu spät. Das Grün verschwand und<br />
Staubwolken hüllten alles ein.<br />
In dieser Welt werden von Menschen künstlich<br />
erzeugte „Naturstücke“ produziert, in<br />
Museen gebracht und können so besichtigt<br />
werden. Diese Superstrukturen beinhalten<br />
die Schätze einer Vergangenheit und sollen<br />
die Schönheit der Erde, wie man sie früher<br />
als selbstverständlich ansah, repräsentieren.<br />
In dieser zukünftigen Welt reisen nun<br />
Tausende herum, um diese architektonischen<br />
Megastrukturen und mit ihnen das,<br />
was einmal Natur gewesen war, zu bestaunen:<br />
Denkmäler einer Vergangenheit.<br />
Mittag 12.00 – Vater und Sohn nähern sich einem Denkmal, das an die grünen Berge<br />
und die verschwundenen Gletscher erinnern soll.<br />
Nachmittag 14.00 – Ein Museum von Hügeln, Tälern und landwirtschaftlichen Flächen,<br />
eingebettet in Aussichtsterrassen und Warnschilder.<br />
Abenddämmerung – Kann das eine Pflanze sein?<br />
Nicholas Stathopoulos ist ein Konzeptkünstler.<br />
Der aus Griechenland stammende,<br />
in Australien, Melbourne lebende<br />
Architekt, Designer und Illustrator hat<br />
seine Architekturausbildung an der Architecture<br />
RMIT University absolviert.<br />
Seine Arbeiten befassen sich intensiv<br />
und immer wieder mit den Problemen<br />
des Klimawandels und wollen zum Nachdenken<br />
anregen. Mit flauen Tönen und<br />
einer pastellähnlichen Farbpalette gestaltet<br />
er nostalgische Bilder einer immer<br />
möglicher scheinenden Zukunft. Der<br />
Mensch spielt in ihnen nur noch eine unbedeutende,<br />
winzige Rolle.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
10<br />
Magazin<br />
Die 13. Auflage<br />
Im Mai fand zum 13. Mal das „Architektenkochen“ als „Brückenschlag zwischen<br />
Architektur, Kulinarik und geselligem Beisammensein unter Kollegen“<br />
im Miele Experience Center in Wien statt.<br />
Fotos: Andreas Laser<br />
Was vor Jahren als spontane Idee begann, ist mittlerweile<br />
zweimal im Jahr zum Fixpunkt geworden: Das<br />
Architektenkochen, organisiert vom Laser Verlag<br />
und Miele, bei dem jedes Mal von einer handverlesenen<br />
Gruppe von kochwilligen Leserinnen und Lesern<br />
des <strong>Fachmagazin</strong>s <strong>architektur</strong> – unter der Anleitung<br />
von Profikoch Roman Rosmanith – ein 5 Gänge Menü<br />
gekocht wird.<br />
Ausgangsbasis für das Werken in der voll ausgestatteten<br />
Praxisküche in der Miele Galerie in Wien 23<br />
waren wie immer für jede Speise ein entsprechendes<br />
Rezept und die dafür erforderlichen Zutaten in handelsüblichem<br />
Zustand. Darauf basierend wurden die<br />
einzelnen Gänge in kleinen Gruppen in kulinarische<br />
Köstlichkeiten umgesetzt.<br />
Den Abschluss der geselligen Küchenarbeit bildete<br />
wie gewohnt das gemeinsame Essen, wo die einzelnen<br />
Kochgruppen regen Zuspruch und viel Beifall erhielten.<br />
So wie bei allen bisherigen Veranstaltungen<br />
kam auch das Netzwerken nicht zu kurz – die Gespräche<br />
unter Kolleginnen und Kollegen fanden erst lange<br />
nach dem letzten Gang ihren Ausklang.<br />
Gemeinsames Kochen, Essen und Trinken verbindet<br />
– im Herbst <strong>2019</strong> ist ein weiterer „Brückenschlag<br />
zwischen Architektur, Kulinarik und geselligem Beisammensein<br />
unter Kollegen“ geplant. Interessenten<br />
mit und ohne Kocherfahrung – aber Begeisterung<br />
am Kochen, Essen, Trinken und Netzwerken – können<br />
sich unter folgenden Kontaktdaten informieren<br />
und anmelden: silvia.laser@laserverlag.at oder unter<br />
T +43 (0)1 869 58 29 16. Die Teilnahme ist selbstverständlich<br />
kostenfrei.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
GEBERIT ONE<br />
11<br />
Magazin<br />
DAS BESTE<br />
AUS ZWEI WELTEN<br />
WIRD EINS<br />
Geberit entwickelt sich stetig und mit Erfolg weiter. Nun machen<br />
wir den nächsten Schritt und vereinen Know-how hinter der Wand<br />
mit Designkompetenz vor der Wand. So schaffen wir mit Geberit<br />
ONE voll integrierte, technisch wie ästhetisch clevere Lösungen.<br />
Für ein besseres Bad.<br />
www.geberit.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
12<br />
Magazin<br />
Erinnerungen und kulturelle Identität<br />
Warum entscheiden sich Designer oder<br />
Kunsthandwerker bei ihren Projekten<br />
für bestimmte Materialen oder Verarbeitungstechniken?<br />
Ob naturnahe Verfahren<br />
oder ungewöhnlich zusammengesetzte<br />
Baukörper – unterschiedliche<br />
Ansätze drücken individuelle Werte<br />
aus, wecken Erinnerungen an vergangene<br />
Zeiten oder spiegeln kulturelle<br />
Identität wider.<br />
Wie ausdrucksstarke Konzepte und detailverliebte<br />
Umsetzung Hand in Hand gehen,<br />
zeigten 25 Nachwuchskünstler im Förderareal<br />
Talents sowie die Gewinner des renommierten<br />
Design-Wettbewerbes FORM vom<br />
29. Juni bis 1. Juli <strong>2019</strong> auf der Tendence.<br />
Fotos: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera<br />
Mit dem Förderprogramm Talents gab die<br />
Messe Künstlern aus den Bereichen Design,<br />
Kunsthandwerk und Schmuck eine Bühne.<br />
An allen drei Messetagen konnten sie ihre<br />
Unikate und Produktserien kostenfrei ausstellen<br />
und sich dabei mit wichtigen Entscheidern<br />
der internationalen Design- und<br />
Konsumgüterbranche vernetzen. Die ausgewählten<br />
Talente präsentierten sich im direkten<br />
Umfeld der Ausstellung FORM <strong>2019</strong>,<br />
die prämierte zeitgenössische Produkte im<br />
Spannungsfeld zwischen Kunsthandwerk<br />
und Design zeigte. Insgesamt 25 nationale<br />
und internationale Talente stellten im Förderareal<br />
Modern Craft in diesem Jahr aus<br />
und erzählten mit ihren Werken Geschichten,<br />
riefen vergessene Zeiten ins Gedächtnis<br />
oder drückten Einstellungen und Identitäten<br />
aus.<br />
www.messefrankfurt.com<br />
www.tendence.messefrankfurt.com<br />
Die Trends der Outdoor-Saison<br />
Vom 1. bis zum 3. September <strong>2019</strong> präsentiert<br />
die spoga+gafa, die weltweit<br />
größte Gartenmesse, wieder aktuelle<br />
Trends und Themenwelten der grünen<br />
Branche. Die Angebotsvielfalt reicht<br />
dabei von trendigen Outdoor-Möbeln<br />
und Design für die Gartenausstattung<br />
über smarte Gartengeräte, Hightech-Grills<br />
und Outdoor-Küchen bis<br />
hin zu dekorativen Accessoires für das<br />
Leben im Freien.<br />
Als übergreifenden Trend greift die Messe in<br />
diesem Jahr das zukunftsweisende Thema<br />
„City Gardening“ auf und setzt damit neue<br />
Akzente bei der Gestaltung und Ausstattung<br />
des grünen Wohnzimmers. Mehr und mehr<br />
Menschen zieht es in die Stadt und dort wollen<br />
sie auf ihr eigenes Grün und Entspannung<br />
unter freiem Himmel nicht verzichten. Denn<br />
für Stadtbewohner werden begrünte Orte<br />
als Rückzugsort im hektischen Alltag immer<br />
wichtiger. Der Garten gibt den Menschen<br />
ein Gefühl von Sicherheit und Zuhause und<br />
bekommt so eine ganz neue Bedeutung. Es<br />
blüht und gedeiht in kleinen Gärten und auf<br />
immer mehr Balkonen und Dachterrassen.<br />
Zahlreiche Aussteller zeigen auf der diesjährigen<br />
Messe ihre Neuheiten für die Nutzung<br />
dieser urbanen Freiräume.<br />
www.koelnmesse.de<br />
spoga+gafa vom 1. bis zum 3. September<br />
<strong>2019</strong> in Köln<br />
Fotos: Koelnmesse
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
200 Jahre<br />
Wienerberger<br />
Was 1819 als kleine Ziegelmanufaktur<br />
im Süden Wiens begann, ist mittlerweile<br />
zum Weltmarktführer und<br />
internationalen Baustoff-Konzern<br />
herangewachsen.<br />
13<br />
Wienerberger AG-Vorstand Heimo Scheuch<br />
Anlässlich dieses 200-jährigen Jubiläums<br />
luden die Wienerberger AG-Vorstände Heimo<br />
Scheuch, Willy van Riet und Solveig<br />
Menard-Galli sowie Wienerberger Österreich-Geschäftsführer<br />
Mike Bucher und Pipelife<br />
Austria-Geschäftsführer Franz Grabner<br />
Geschäftspartner, prominente Gäste<br />
und Mitarbeiter in die Wiener St. Marx-Halle<br />
zur großen Gala-Feier.<br />
Burgschauspieler Peter Matić führte die<br />
rund 2.000 Anwesenden im Rahmen eines<br />
Rückblickes durch die Geschichte des weltweit<br />
erfolgreichen Konzerns: Von den Anfängen<br />
bis in die Gegenwart – Wienerberger<br />
ist mittlerweile der größte Ziegelproduzent<br />
(Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer<br />
bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach)<br />
in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen<br />
(Semmelrock) in Zentral-Osteuropa.<br />
Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke<br />
Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre<br />
Magazin<br />
Fotos: Wienerberger AG<br />
der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen<br />
zu den führenden Anbietern in Europa. Mit<br />
gruppenweit 195 Produktions standorten<br />
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018<br />
einen Umsatz von 3,3 Mrd. Euro.<br />
WICLINE 75 MAX Fenstersystem<br />
Weniger ist mehr!<br />
Verdeckter Fenstergriff –<br />
ausgezeichnetes Design<br />
Das Fenster für maximale Ansprüche.<br />
Ein innovatives Aluminiumfenster, das mit maximalem Design ein homogenes Erscheinungsbild<br />
schafft, mit maximaler Transparenz mehr Helligkeit und Komfort bietet und mit maximaler<br />
Nachhaltigkeit zum Klimaschutz beiträgt – das ist ein Fenster für die Stadt der Zukunft.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
14<br />
Magazin<br />
Der Hybrid-Geschossbau<br />
Holzkonstruktionen kombiniert mit Deckensystemen aus Beton bilden beim Bau<br />
mehrstöckiger Gebäude eine Erfolg versprechende Kombination. Die als Hybridbauweise<br />
bezeichnete Art ermöglicht Geschosshöhen, an die beim Bauen mit Holz<br />
vorher nicht zu denken war.<br />
Fotos: Dennert<br />
Im Heilbronner Stadtteil Neckarbogen steht das<br />
derzeit höchste aus Holz gebaute Haus Deutschlands.<br />
Mit seinen 34 Metern und zehn Stockwerken<br />
ragt „Skaio“, Deutschlands momentan höchstes<br />
Holzhochhaus, in den Himmel und beweist, welche<br />
Möglichkeiten die Hybridbauweise eröffnet. Mit Holz<br />
alleine wären Gebäude dieser Größe schon aus Gründen<br />
des Brandschutzes nicht zu verwirklichen. Doch<br />
in Kombination mit Beton kommen die spezifischen<br />
Vorteile beider Materialien zum Tragen.<br />
Grundlage bildet der Holzskelett- und Rahmenbau.<br />
In der Kombination von Raumdecken aus Beton mit<br />
Holz als vertikale Elemente profitieren Holzhäuser<br />
von den besseren Schall- und Brandschutz-Eigenschaften<br />
des Materials Beton. Trittschall ist dann<br />
kein Thema mehr, die Gebäude gewinnen an Stabilität,<br />
da die Betondecke nicht schwingt – selbst dann<br />
nicht, wenn sie punktuell stark belastet wird.<br />
Ein Betonfertigteil-Spezialist aus Deutschland hat<br />
nun für den Hybridbau eine bereits im Massivbau<br />
bestens bewährte Raumklima-Decke weiterentwickelt.<br />
Sie ist in den Brandschutzklassen REI 30, REI<br />
60 und REI 90 erhältlich und verfügt über erstklassige<br />
Schalldämmeigenschaften. Mit diesen Betondecken<br />
lassen sich Spannweiten von bis zu sieben Me-<br />
tern überbrücken. Sie haben – je nach Ausführung<br />
– eine Stärke von nur 20 oder 24 Zentimetern. Unterm<br />
Strich wiegen sie weniger als Varianten aus Holz,<br />
die eine vergleichbare Schalldämmung und Brandschutzklasse<br />
aufweisen. Mit einem entsprechenden<br />
Rohrsystem ausgestattet, können sie Wohnungen<br />
heizen, kühlen und lüften. Raumklima-Decken mit ihrem<br />
hohen Anteil an Strahlungswärme sorgen dabei<br />
für einen schnelleren Baufortschritt und später für<br />
ein Plus an Wohnqualität. Es ist eine behagliche Wärme<br />
mit einem hohen Anteil an Wärmestrahlung. An<br />
heißen Sommertagen fungieren die Leitungen, mit<br />
kaltem Wasser gefüllt, als Kühlung.<br />
Jedes Element wird individuell nach Plan vorgefertigt.<br />
Die Hohlräume können für Versorgungs- und<br />
Kabelkanäle genutzt werden. Ausgestattet mit Ringankern,<br />
werden die Elemente montagefertig angeliefert<br />
und per Vergussverfahren – oder idealerweise<br />
mithilfe eines patentierten Verschluss-Systems – trocken<br />
verbaut. Die Decken sind sofort begeh- und belastbar,<br />
müssen weder verkleidet noch verputzt werden.<br />
Vor Ort benötigt man für die Montage von 100<br />
Quadratmetern etwa drei Stunden. Und der Wohnkomfort,<br />
der so entsteht, ist weder mit Holz noch mit<br />
Beton allein zu erzielen.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
15<br />
Magazin
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
16<br />
Magazin<br />
© www.schreinerkastler.at<br />
Vorzeigeprojekt<br />
In der Marktgemeinde Theresienfeld in Niederösterreich feierte man am 22.<br />
Mai <strong>2019</strong> die Grundsteinlegung zu einem Wohnbauvorhaben, bei dem Ökologie<br />
großgeschrieben wird. Zu den Besonderheiten dieser Wohnhausanlage zählt die<br />
innovative Gebäudetechnik mit thermischer Bauteilaktivierung. Beim Projekt Tonpfeifengasse<br />
handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt vom Wohnkonzept über die<br />
Heizungsanlage bis hin zur Gestaltung der Freiräume und Parkplätze.<br />
Zu den Besonderheiten zählt unter anderem das<br />
Heizsystem, das mittels einer hocheffektiven Luftwasserwärmepumpe<br />
auf dem Dach der Gebäude<br />
über die bauteilaktivierten Betondecken die Räume<br />
im Winter wärmt bzw. im Sommer auch kühlt. Außerdem<br />
kommen noch eine Fotovoltaikanlage und Mikrowärmepumpen<br />
zur Warmwassererzeugung zum<br />
Einsatz. Der benötigte Strom wird über die Fotovoltaikanlage<br />
sowie durch die Nutzung von Ökostrom<br />
geliefert. Zusammengenommen ergeben alle diese<br />
Maßnahmen wesentlich geringere Energiekosten für<br />
die künftigen Mieter. Als zusätzliches Angebot wird<br />
es ein eCar-Sharing geben. Ein flexibles Wohnkonzept<br />
soll eine Trennung der Etagen ermöglichen. Mit<br />
ganz geringem Aufwand können aus einer großen<br />
Wohnung zwei kleine gemacht werden.<br />
Der Start für dieses attraktive geförderte Wohnbauvorhaben<br />
in Theresienfeld wurde mit der Grundsteinlegung<br />
im Mai <strong>2019</strong> gesetzt. Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft<br />
Arthur Krupp Ges.m.b.H. errichtet<br />
die moderne Wohnhausanlage in Form von vier jeweils<br />
3-geschossigen Wohngebäuden mit insgesamt<br />
28 Wohnungen. Geboten werden 3-Zimmer-Wohnungen<br />
mit rund 70 m² Nutzfläche, Gartenanteil, Terrassen<br />
bzw. Balkonen, 5-Zimmer-Maisonette-Wohnungen<br />
mit ca. 100 m² Nutzfläche und Garten oder<br />
auch zwei Dachgeschosswohnungen mit großen Terrassenflächen.<br />
Hinzu kommen noch Einlagerungsräume<br />
im Erdgeschoss der Häuser, ein Fahrrad- und<br />
Kinderwagenabstellraum und ein zentraler Müllraum<br />
sowie ein Kinderspielplatz und 59 Autoabstellplätze<br />
im Freien. Die Gesamtkosten des Projekts betragen<br />
4,5 Mio. Euro.<br />
VÖZ Vereinigung der Österr. Zementindustrie<br />
T +43 (0)1 714 66 85-23<br />
www.zement.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Magazin<br />
OHNE GLASLEISTE<br />
ABSOLUT FLÄCHENBÜNDIG<br />
Brandschutz<br />
in seiner<br />
eleganten Form<br />
Die starken Brandschutztüren von Peneder beeindrucken nicht<br />
nur durch Größe und Stabilität, sondern auch durch hohe<br />
Eleganz. Mit dem neuen flächenbündigen Glasausschnitt<br />
wird jede Sicherheitstür ein schönes architektonisches<br />
Designelement. Das ist Brandschutz in elegantester Form.<br />
peneder.com<br />
PENEDER Bau-Elemente GmbH // Brandschutz<br />
Ritzling 9, A-4904 Atzbach // +43(0)50 5603 0<br />
brandschutz@peneder.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
18<br />
Magazin<br />
Pflegeleichte<br />
Fassadenbegrünung<br />
Die Sommer werden immer heißer. Dicht verbaute, urbane Gebiete haben daher<br />
mit dem Entstehen von Hitzeinseln zu kämpfen. Durch die Implementierung<br />
von Grünflächen im Stadtraum lässt sich eine Überhitzung der Gebäude und<br />
Straßen verhindern.<br />
Fotos: Dolores Stuttner<br />
Ein vielversprechender Ansatz ist die Fassadenund<br />
Dachbegrünung von Wohnhäusern. Doch ist<br />
die Begrünung von Hausfassaden entlang von Straßenzügen<br />
heute aufwendig und mit hohen Kosten<br />
verbunden. Auch die Abwicklungs- und Genehmigungsprozesse<br />
sind in Städten wie Wien komplex.<br />
Das Projekt „50 grüne Häuser“ will das ändern. Gemeinsam<br />
mit der Stadt Wien entwickelte das interdisziplinäre<br />
Team von tatwort zum ersten Mal eine<br />
Kombi-Lösung für Hausfassaden. Erprobt wird sie<br />
jetzt in Innerfavoriten. Das Ziel der Kampagne ist die<br />
Begrünung von mindestens 50 grünen Häusern im<br />
10. Wiener Gemeindebezirk.<br />
Mit dem Grünfassadenmodul BeRTA – der Name<br />
steht für die Komponenten Begrünung, Rankhilfe,<br />
Trog – soll eine rasche Begrünung kostengünstig<br />
möglich sein. BeRTA ist modular aufgebaut. Dabei<br />
sind die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt.<br />
Die Basis der Konstruktion bildet ein stabiler<br />
Trog. Nach außen hin ist er robust und widerstandsfähig,<br />
während er den Pflanzen innen Raum zum<br />
Wachstum bietet. Daneben ist das Material leicht zu<br />
reinigen, frostsicher und hält Witterungseinflüssen<br />
stand. Für den Einsatz im öffentlichen Raum und auf<br />
Gehsteigen bringt der Trog also ideale Bedingungen<br />
mit. Je nach Pflanzenart lohnt es sich, eine Rankhilfe<br />
zu installieren. Planern stehen dabei flexible und<br />
starre Konstruktionen zur Verfügung. Gewächse haben<br />
so die Möglichkeit, in die Höhe zu wachsen.<br />
Die Bestandteile der Fassadenbegrünung lassen sich<br />
dem Standort und Gebäude anpassen. Auch sind sie<br />
beliebig erweiterbar. So gibt es Lösungen mit Sitzgelegenheiten,<br />
Vandalismus-Schutz und einer Überwuchsleiste,<br />
die individuelle Bedürfnisse abdecken.<br />
Durch den modularen Aufbau lassen sich verschiedene<br />
Kletterpflanzen einsetzen. Auf dem Konstrukt<br />
kommen lediglich winterharte und langlebige Gewächse<br />
zur Anwendung. Das Team von „50 grüne<br />
Häuser“ wählt die Pflanzen für jedes Objekt individuell<br />
aus und berücksichtigt dabei Beschattung und Himmelsrichtung.<br />
Eine nachhaltige Fassadenbegrünung<br />
ist das Ergebnis. Als Prototyp wurde die Fassadenbegrünung<br />
bereits an einem Wohnhaus in Favoriten installiert.<br />
Bewährt es sich, wird BeRTA wahrscheinlich<br />
ab September käuflich zu erwerben sein.
VORDERSEITE<br />
VELUX Tageslicht-Lösungen<br />
für Schulen und Kindergärten<br />
Helle Räume – helle Köpfe: mehr Konzentration mit Tageslicht<br />
VELUX bringt mit großflächigen Tageslicht-Lösungen eine positive, motivierende Stimmung in Schulen<br />
und Kindergärten. Mit dem flexiblen Oberlichtband VELUX Modular Skylights dringt das natürliche Licht<br />
von oben tief in die Räume der Volksschule Bütze in Vorarlberg: Die Kinder genießen eine völlig neue<br />
Lernatmosphäre mit Wohlfühlcharakter.<br />
Projekt-<br />
Doku<br />
ansehen<br />
commercial.velux.at/<br />
buetze
RÜCKSEITE<br />
Planen Sie<br />
Ihr Projekt<br />
mit uns<br />
Werkshalle GST: Mit der Kraft der Sonne<br />
Energieeffizienz und natürliche Belichtung über das Dach.<br />
Energieeffizienz und beste Tageslichtnutzung waren Prämissen für<br />
das Hallenprojekt des führenden Maschinenbauunternehmens GST.<br />
In der Fertigungshalle sorgt VELUX Modular Skylights als Lichtband<br />
für optimalen Tageslichteinfall von Norden. Die Südseite des Daches<br />
wird mit Photovoltaikmodulen zur Energiegewinnung genutzt. In den<br />
Aufenthaltsräumen gewährleisten VELUX Flachdach-Fenster mit ihrer<br />
großen Tageslichtzufuhr einen hohen Wohlfühlfaktor. Für Architekten<br />
und Bauherren waren die überzeugenden Oberlicht-Lösungen und die<br />
rasche Montage ausschlaggebend für die Umsetzung mit VELUX: So<br />
einfach war Oberlicht noch nie.<br />
VELUX Modular Skylights:<br />
die Oberlicht-Revolution<br />
• Modulares System für große Hallen und<br />
Flachdachflächen im Gewerbe- und Wohnbau<br />
• Mit PV-Modulen kombinierbar<br />
• Einfache Planung (CAD/BIM-Daten als Download)<br />
• 100 % vorgefertigt, einfach schnell montiert<br />
• Geprüftes System, 10 Jahre Garantie<br />
Nähere Infos auf: www.velux.at/modularskylights<br />
VELUX Flachdach-Fenster:<br />
die High-End-Lösungen<br />
• Optional mit innovativem Konvex Glas-Design<br />
(mehrfach ausgezeichnet)<br />
• Hervorragende Wärme- und Schalldämmung<br />
• Kombinierbar mit Hitze- und Sonnenschutz<br />
• Ideal für sichtbare Installation im Dach<br />
• Durchsturzsicherheit durch Verbundsicherheitsglas<br />
Nähere Infos auf: www.velux.at/konvexglas<br />
Planen Sie unkompliziert mit mehr Tageslicht und frischer Luft. Gerne informieren wir Sie persönlich.<br />
Mehr Information und Ihre Ansprechpartner auf: www.velux.at/gst
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
21<br />
Magazin<br />
Dämmung<br />
aus Abfall<br />
Jute ist ein Fasergewächs und eine alte Kulturpflanze. Sie wird biologisch nachhaltig<br />
und sozial ausgewogen auf Schwemmlandböden angebaut. Neben der<br />
Verwendung in der Autoindustrie und im Handwerk wird sie zu hochwertigen<br />
Transportsäcken für Kakaobohnen und andere sensible Lebensmittel verarbeitet.<br />
Jute wächst einjährig und bindet große Mengen an CO 2 .<br />
Fotos: Thermo Natur<br />
So weit, so gut, dachte sich ein Schokoladenhersteller,<br />
der seine Kakaobohnen in<br />
großen Mengen in solchen Jutesäcken geliefert<br />
bekam. Die Säcke wurden üblicherweise<br />
weggeschmissen, verbrannt oder<br />
entsorgt – warum sie nicht weiterverwenden<br />
und ein 100%iges Upcyclingprodukt daraus<br />
erzeugen? Also startete er das Unternehmen<br />
THERMO NATUR zur Erzeugung eines<br />
Hochleistungsdämmstoffes. Die Kakaosäcke<br />
werden zerfasert und die so gewonnenen<br />
Jutefasern unter Zugabe von Soda und einer<br />
langlebigen Stützfaser zu hochwertigen<br />
Matten und Vliesen verarbeitet. Heraus<br />
kommen Produkte, die absolut einzigartig<br />
auf dem Dämmstoffmarkt sind: hygienisch<br />
einwandfrei, schimmelresistent und stark<br />
im sommerlichen Hitzeschutz. Jute ist aufgrund<br />
ihrer robusten Struktur sehr langlebig.<br />
Ihre pflanzliche Kapillarfunktion bei Feuchtigkeit<br />
bewahrt sie auch als Dämmstoff. Das<br />
schafft ein gesundes Raumklima und beugt<br />
auch den Folgen (Schimmel, Sondermüll) eines<br />
industriegesteuerten Dämmwahns vor.<br />
Der Naturdämmstoff erreicht einer Untersuchung<br />
der Materialprüfanstalt Leipzig<br />
zufolge mit 2.350 J/(kgK) die derzeit beste<br />
spezifische Wärmekapazität bei allen auf<br />
dem Markt befindlichen Dämmstoffen. Dies<br />
macht sich vor allem beim sommerlichen<br />
Hitzeschutz deutlich bemerkbar. Mit einem<br />
gemessenen Lambdawert von 0,0356<br />
W/(mK) erreicht die Jutedämmung zudem<br />
sehr gute Dämmwerte, ist wohngesund und<br />
erfüllt alle Anforderungen an den baulichen<br />
Brandschutz. Der konstruktive Aufwand<br />
ist vergleichbar mit einer klassischen Zwischensparrendämmung.<br />
Das Produkt ist<br />
als Platten- und Rollenware erhältlich und<br />
daher sehr flexibel in seiner Handhabung<br />
– bestens geeignet für die Dachdämmung.<br />
Aber auch bei Holzbalkendecken sowie<br />
Außen- und Innenwänden in Holzbauweise<br />
kann dieser hochwertige Dämmstoff eingesetzt<br />
werden.<br />
Neben der hohen Dämmwirkung und dem<br />
wohngesunden Raumklima überzeugen<br />
zahlreiche ökologische Vorteile. Sollte das<br />
Material irgendwann einmal entsorgt werden<br />
müssen, ist das problemlos möglich,<br />
bei der Variante „Plus“ sogar durch Kompostierung.<br />
Da bereits die Herstellung<br />
energetisch wenig aufwendig ist, fällt die<br />
Ökobilanz ausgesprochen positiv aus. Der<br />
Naturdämmstoff ist schnell nachwachsend,<br />
das Vorkommen bei einer Weltproduktion<br />
an Jutefasern von zwei bis drei Millionen<br />
Tonnen pro Jahr schier unbegrenzt.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
22<br />
Magazin<br />
© DOMICO<br />
© pierer.net<br />
Ein inspirierender<br />
Arbeitsplatz<br />
In den letzten 40 Jahren hat sich das Familienunternehmen DOMICO als Spezialist<br />
mit Schwerpunkt Metall etabliert, insbesondere bei Großprojekten mit einem<br />
hohen Anspruch an Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.<br />
Fotos: DOMICO<br />
Das spiegelt sich auch in der neuen Firmenzentrale<br />
in Vöcklamarkt wider. Gemeinsam mit Architekt<br />
DI Volkmar Burgstaller wurde auf einem unbebaubar<br />
erscheinenden Gelände neben der Bundesstraße ein<br />
siebengeschossiges Kunden- und Kompetenzzentrum<br />
errichtet.<br />
40 Jahre und € 9 Mio. Investment für Innovation und<br />
Partnerschaft wurden gebührend mit einer Abendgala<br />
am 17. Mai und einem Mitarbeiterfest am 19. Mai<br />
für insgesamt mehr als 700 Gäste gefeiert. Neben einem<br />
Abendprogramm der Spitzenklasse, garniert mit<br />
künstlerischen und artistischen Highlights, gab es<br />
nicht nur Glückwünsche, sondern eine ganz besondere<br />
Ehrung für Firmengründer und Seniorchef Josef<br />
Hummer mit der Auszeichnung „Wirtschaftsmedaille<br />
in Silber“.<br />
Für Mitarbeiter und Kunden schafft die neue Firmenzentrale<br />
ein funktionelles Wohlfühlambiente, das die<br />
Grundwerte des Unternehmens mit offenen, aber flexiblen<br />
Arbeitsbereichen und mit Begegnungszonen<br />
wie Teeküche, Bibliothek und Cafeteria auch architektonisch<br />
umsetzt. Die Arbeitswege sind kurz, auch<br />
Geschoss übergreifend. Der Informationsfluss im Unternehmen<br />
soll smart erfolgen, das Ambiente für Inspiration<br />
und positive Stimmung sorgen.<br />
Das Design des Kommunikationszentrums ist insgesamt<br />
offen und transparent. Durch die 18 m freie<br />
Auskragung des 1. und 2. Stockwerks entsteht eine<br />
ganz besondere Leichtigkeit, welche durch die Edelstahluntersicht<br />
ein edles Finish erhielt. Ein weiteres<br />
Highlight ist die gläserne Treppe, welche die Arbeitsbereiche<br />
transparent vertikal verbindet.<br />
Eine zusätzliche Schulungshalle „Home of Innovation<br />
for Metal Buildings“ ergänzt das neue Kunden- und<br />
Kompetenzzentrum. Auf 800 m 2 gibt es Ausstellungsflächen<br />
sowie Raum, um Praxisschulungen für Metallverarbeiter,<br />
aber auch für Architekten, Studenten und<br />
Schüler anzubieten.<br />
DOMICO Dach-, Wandund<br />
Fassadensysteme KG<br />
T +43 (0)7682 2671-0<br />
office@domico.at<br />
www.domico.at<br />
© Mathias Lauringer
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
23<br />
Magazin<br />
Recycling am Times Square<br />
Fotos: FMS Presents<br />
Fernando Mastrangelo scheut nicht die<br />
Öffentlichkeit. Der in Brooklyn wohnende<br />
Künstler hat aus Plastik, Sand<br />
und zerkleinertem Altglas ein kleines<br />
Häuschen entworfen und am Times<br />
Square in NY während des Events „NYC<br />
x Design <strong>2019</strong>“ aufgebaut.<br />
Das Projekt zeigt, wie die Architektur dazu<br />
beitragen kann, den Lebenszyklus von bereits<br />
verbrauchtem Material zu verlängern.<br />
Auf nur 16 Quadratmetern – mit einem kleinen<br />
vorgelagerten Garten – eröffnet sich<br />
ein höhlenartiger Raum, ein Mausoleum und<br />
zeigt, dass die Grenzen von Architekten<br />
und Designern nicht mehr allein physisch<br />
determiniert sind. Recyceltes Plastik diente<br />
dem Künstler für den schillernden Effekt der<br />
dunklen Außenfassade, im Inneren sind die<br />
Wände aus geschrottetem Glas. Ganz hinten,<br />
in blaues Licht getaucht, ergibt sich ein<br />
weiterer Ausblick in einen Garten, der das<br />
Gesamtprojekt zu einer Oase in der Stadt<br />
werden lässt.<br />
Führend in Lüftungs- und Brandschutzsystemen<br />
Eine Symbiose von höchster Lebensqualität bei lebendiger Architektur<br />
THE ICON Vienna beim Wiener Hauptbahnhof<br />
gute Raumluftqualität mit den<br />
X-CUBE Lüftungsgeräten<br />
www.trox.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
24<br />
Magazin<br />
Lehmfeinputz<br />
zum Leben<br />
Lehm wird seit Jahrtausenden zum Bau von Häusern verwendet: Schon Jericho,<br />
eine der ältesten Städte der Menschheit, wurde mit Lehm gebaut, genauso wie<br />
mittelalterliche Fachwerkhäuser hierzulande. Im Zuge der aktuellen Klima- und<br />
Umweltschutz-Debatten bekommen die Vorzüge dieses uralten Materials eine<br />
neue Aktualität. Denn Lehm erweist sich nicht nur bei Produktion und Entsorgung<br />
als völlig bedenkenlos für die Umwelt, der Baustoff sorgt auch in Wohnräumen für<br />
ein gutes Klima.<br />
Fotos: Haga<br />
Je höher beim Lehmputz der Anteil an Ton<br />
ist, desto besser. Denn Ton kann Feuchtigkeit<br />
aufnehmen, speichern und wieder<br />
abgeben – neunmal so viel wie Gips. Dadurch<br />
weisen Innenräume mit Lehmfeinputz<br />
eine konstante Luftfeuchtigkeit auf,<br />
die zwischen 45 und 60 Prozent liegt. Das<br />
sorgt bei Menschen für ein Wohlfühlklima,<br />
verhindert Schimmelbildung und bekommt<br />
auch Holzmöbeln und Treppen aus Holz<br />
gut. Ein weiterer Vorteil des atmungsaktiven<br />
Materials: Es kann Schadstoffe und<br />
Gerüche aus der Raumluft aufnehmen und<br />
binden. Da Ton elektrostatisch neutral ist,<br />
wird in Wohnungen mit Lehmfeinputz weniger<br />
Staub aufgewirbelt. Auch im Hinblick<br />
auf Schall- und Brandschutz weist das rein<br />
mineralische Material gute Werte auf.<br />
Je höher der Tonanteil, desto besser die<br />
Regulierung der Luftfeuchtigkeit und die<br />
Luftreinigung. Wohngesunder Lehmputz<br />
ist außerdem völlig frei von organischen<br />
Zuschlagstoffen oder anderen chemischen<br />
Bestandteilen. Mancher Lehmfeinputz<br />
weist einen besonders hohen Anteil an Ton<br />
auf. Der Grund dafür ist die Herstellung aus<br />
reinem Kaolin (Ton). Er kann im Neubau und<br />
für Renovierungen verwendet werden und<br />
fungiert als Farbe und Putz in einem. Angereichert<br />
mit natürlichen Pigmenten wie<br />
Glimmer, Erd- und Eisenoxiden oder farbigen<br />
Sanden steht eine Palette von vielen<br />
Farbtönen zur Wahl. Gestalterisch lassen<br />
sich mit glatten oder rauen Oberflächenstrukturen<br />
zusätzlich Akzente setzen. Der<br />
ökologische Fußabdruck von Lehmfeinputz<br />
kann sich ebenfalls sehen lassen: Für die<br />
Verarbeitung ist nur wenig Primärenergie<br />
nötig, das Material voll kompostierbar.<br />
Aufgrund der Reinheit des Lehmfeinputzes<br />
und des stark erhöhten Tonanteils ist das<br />
eine interessante Alternative für die natürliche<br />
und wohngesunde Wandgestaltung.<br />
Lehmfeinputz wird in zwei Arbeitsgängen in<br />
einer Gesamtschichtstärke von 2,5 bis drei<br />
Millimetern aufgetragen. Für eine Schicht<br />
von zwei Millimetern sind pro Quadratmeter<br />
ca. 2,4 Kilogramm Lehmfeinputz (Trockenmasse)<br />
nötig. Mindestens zwölf Stunden<br />
vor dem Verputzen muss die Wand mit einer<br />
Mineralputzgrundierung vorgestrichen<br />
werden.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Mobiler Klimaraum<br />
für die Stadt<br />
Als Weiterentwicklung von „breathe.austria“, dem<br />
österreichischen EXPO Pavillon 2015, schuf das interdisziplinäre<br />
Designteam Breathe Earth Collective<br />
gemeinsam mit der Österreich Werbung die hybride<br />
Waldoase Airship.01. Nach Stationen in Italien, in<br />
Frankreich und auf der „Green Art Tulln“ ist die Installation<br />
noch bis Mitte September im Haupthof des<br />
MuseumsQuartier Wien frei für Besucher zugänglich.<br />
Zwei für Österreich typische Waldökotypen erzeugen in<br />
dem mobilen Stadtmöbel ein atmosphärisches Raumerlebnis.<br />
Die Synergie aus einer Leichtbaukonstruktion, modularer<br />
Verschattung, Ventilatoren und Sprühnebelsystemen<br />
unterstützt die Pflanzen bei der Evapotranspiration und<br />
kühlt somit die Luft um bis zu 6°C – ganz ohne Klimaanlage.<br />
Damit leistet „Airship.01 – Kulturwald“ auch einen Beitrag<br />
zur Reduktion des Urban Heat Island Effekts. Mittlerweile<br />
gibt es bereits drei Airship-Varianten, die sich mit unterschiedlicher<br />
Architektur und Vegetation mit den Themen<br />
Klima, Raum und Luftverschmutzung auseinandersetzen.<br />
www.mqw.at<br />
25<br />
Magazin<br />
Silica ®<br />
Das flexible Linearsystem für dezentes Lichtdesign<br />
in der Office-Beleuchtung.<br />
www.siteco.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
26<br />
Magazin<br />
Der Stadtelefant<br />
Ein 08/15-Bürobau kam für die Wiener Architekten Franz&Sue (auch für den Eigenbedarf)<br />
nicht infrage. Sie entwarfen ihre eigenen Arbeitsbereiche als flexibles<br />
Raumkonzept, das den Zusammenhalt innerhalb des gesamten Gebäudes stärkt<br />
und auf zukünftige Veränderungen problemlos reagieren kann. Den Beinamen<br />
Stadtelefant verdient sich der Bau über seine mächtige Kubatur und die graue<br />
Farbgebung – im Inneren erscheint er aber alles andere als träge, sondern viel<br />
mehr lebendig und voller Energie.<br />
Fotos: Franz&Sue, Andreas Buchberger, Abdul Fattah<br />
Mit dem Projekt im Wiener Sonnwendviertel, einem<br />
Wohnquartier in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs,<br />
beweisen die Planer, dass grüne Architektur<br />
weit mehr als nur ein intelligentes Energiekonzept<br />
bedeuten kann. Hinter der Lochfassade aus Beton<br />
verbergen sich, inspiriert von Wiener Gründerzeitbauten,<br />
wandlungsfähige Grundrisse, die sich in<br />
Clustern organisieren. Über sechs Stockwerke und<br />
ein Dachgeschoss verteilt, ziehen hier offene Arbeitswelten<br />
für die Architekten selbst und ihre Partnerfirmen,<br />
Wohnungen und Gemeinschaftsflächen in<br />
den Multifunktionsbau ein.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Freie Grundrisse, die bei zukünftigen Umnutzungen<br />
jederzeit flexibel angepasst werden können, verdeutlichen<br />
den Nachhaltigkeitsaspekt des Stadtelefanten.<br />
Franz&Sue verzichten zur Gänze auf tragende<br />
Zwischenwände und Erschließungsbereiche. Die<br />
einzelnen Niveaus werden nur vom Treppenhaus und<br />
den Nasszellen zoniert. Im Parterre befindet sich ein<br />
Lokal, das von den Angestellten als Kantine genutzt<br />
wird und außerdem die Bewohner der Umgebung in<br />
den Bau einlädt und diesen somit belebt und mit der<br />
urbanen Struktur verwebt.<br />
27<br />
Magazin<br />
Neben dem Miteinander und der räumlichen Flexibilität<br />
widmen sich die Architekten dem Thema<br />
Nachhaltigkeit auch über bautechnische Feinheiten.<br />
Sie verzichten auf Hightech und setzen stattdessen<br />
auf intelligente Materialien. Dank dieser kann<br />
die Haustechnik auf ein Minimum reduziert werden.<br />
Die Fertigteilfassade besteht aus zwischengedämmten<br />
Betonelementen. Diese wirken gleichzeitig als<br />
Speichermasse für thermische Energie und sorgen<br />
gemeinsam mit geringer zusätzlicher Kühlung und<br />
Lüftung über die STB-Decken für ein angenehmes<br />
Raumklima. Viele Oberflächen, wie zum Beispiel die<br />
sandgestrahlte Fassade, bleiben unverkleidet, sparen<br />
Zeit und Kosten und machen den Stadtelefanten zu<br />
einem grünen oder viel mehr bunten und zukunftsweisenden<br />
Anlaufpunkt in Wien.<br />
Energiespeicher Beton<br />
Innovativ, zukunftssicher und nachhaltig.<br />
In der Decke integrierte Rohrleitungen speisen den Betonspeicher<br />
und sorgen für eine effiziente Raumtemperierung.<br />
Beton ist ein hervorragender Wärmespeicher<br />
und ein sehr guter Wärmeleiter. Eine thermisch<br />
aktivierte Geschoßdecke aus Beton sorgt für<br />
wohlige Wärme im Winter und angenehme<br />
Frische im Sommer.<br />
Infos unter:<br />
www.betonmarketing.at/<br />
Energiespeicher-Beton
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
28<br />
Magazin<br />
Wegweiser<br />
in die Zukunft<br />
Im Auftrag der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH realisierte das Berliner Architekturbüro<br />
Kaden+Lager einen Neubau zur Stadtausstellung im Rahmen der Bundesgartenschau<br />
Heilbronn <strong>2019</strong>. Dieses „Stadtquartier Neckarbogen“ kann Zug um Zug<br />
weiterentwickelt werden und einmal bis zu 3.500 Bewohnern ein Zuhause geben.<br />
Fotos: Bernd Borchardt<br />
Für eine grüne Umgebung sorgen die Daueranlagen<br />
der BUGA mit der Seenlandschaft, dem Neckaruferpark,<br />
dem Hafenberg mit Himmelspfad und der urbanen<br />
Aue. Mit 34 Metern wird die Architektur mit der<br />
Bezeichnung SKAIO das aktuell höchste Holzhaus<br />
in Deutschland. Am Eingang des Bundesgartenschau-Geländes<br />
empfängt der Neubau den Besucher<br />
als Wegweiser in die Zukunft und zeigt die erfolgreiche<br />
Kombination von nachhaltiger Bauweise und anspruchsvoller<br />
Gestaltung.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
29<br />
Magazin<br />
Das Hochhaus wurde in einer Holz-Hybrid-Bauweise<br />
errichtet: Wände und Decken sind aus Holz und<br />
machen den überwiegenden Teil der Konstruktion<br />
aus. Nach der Vorfertigung erfolgte die Montage vor<br />
Ort. Ein Stockwerk pro Woche ist ein beachtlicher<br />
Baufortschritt. Die Stützen des Neubaus bestehen<br />
aus Brettschichtholz. Sockelgeschoss und Treppenhaus<br />
bestehen jeweils aus Stahlbeton und wurden<br />
zuerst errichtet. Für die Holzwände und -decken hat<br />
man ausschließlich Fichtenholz mit PEFC-Zertifikat<br />
verwendet. Über dem verglasten Sockelbereich mit<br />
sichtbarem Erschließungskern aus Beton setzen sich<br />
die Obergeschosse mit einer hochwertigen Aluminiumlochfassade<br />
ab. Auf den zweiten Blick lassen die<br />
Holz-Unterseiten der Loggien auch von außen erkennen,<br />
dass der Bau ein Holzgebäude ist.<br />
Die Decken bestehen aus Brettsperrholz, die Stützen<br />
aus Brettschichtholz. Die gesamten Horizontallasten<br />
der Aussteifung werden von dem Stahlbetonkern,<br />
der auch als notwendiger Fluchtweg dient,<br />
abgetragen. Die sichtbar eingebauten, 240 mm starken<br />
Brettsperrholzdecken spannen von innen (dem<br />
Stahlbetonkern) in Richtung der Außenwände. Aufgrund<br />
der großen Öffnungen in den Außenwänden<br />
und auch um Setzungen vorzubeugen, liegen die Decken<br />
dort auf Stahlunterzügen auf. Diese wiederum<br />
tragen ihre Vertikallast über blockverleimtes Brettschichtholz,<br />
das ebenfalls später sichtbar bleibt, in<br />
die Gründung ab. Für die nicht tragenden Außenwände<br />
wird Brettsperrholz gewählt, das außenseitig noch<br />
eine Dämmung und eine Gipsfaser-Platte erhält.<br />
Die im Standard offen und hell gestalteten 1- bis<br />
2-Zimmer-Mietwohnungseinheiten (60 Stück) werden<br />
über einen Erschließungskern mit Aufzügen und<br />
Sicherheitstreppenhaus barrierefrei erreicht, sind<br />
zwischen 40 und 90 m² groß und können aufgrund<br />
des Gebäudekonzeptes zusammengeschaltet werden.<br />
Die Wohnungen sind mit Fußbodenheizung und<br />
Einbauküche ausgestattet und haben öffenbare, bodentiefe<br />
Fenster. Nahezu alle Wohnungen verfügen<br />
zudem über eine Loggia. Das Dach ist teilweise als<br />
extensives Gründach geplant. Als weitere Attraktionen<br />
sind für die Bewohner zwei möblierte gemeinschaftliche<br />
Dachterrassen inklusive bewirtschaftbaren<br />
Gemüsegärten vorgesehen. Den Bewohnern<br />
präsentiert sich in über 30 m Höhe ein spektakulärer<br />
Ausblick über die Stadt Heilbronn und den Neckar.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
30<br />
Magazin<br />
Berlins neue<br />
Oberschicht<br />
Wenn Berlin im Jahr 2030 die prognostizierte Einwohnerzahl von vier Millionen<br />
knackt, sind das zwar rund 500.000 Einwohner mehr als heute, aber immer noch<br />
knapp 500.000 weniger als vor dem Zweiten Weltkrieg. Während die Infrastruktur<br />
mit Kanalisation und U-Bahn-Netz durchaus noch nicht an ihre Grenzen stößt,<br />
herrscht auf dem Wohnungsmarkt akute Not. Wie kommt das?<br />
Fotos: Sigurd Larsen<br />
Beim Wiederaufbau Berlins nach 1945 stand trotz erheblichem<br />
Bevölkerungsrückgang an erster Bedarfsstelle<br />
Wohnraum. Dieser wurde auch geschaffen,<br />
allerdings in viel komprimierterer Form als zuvor. Seitdem<br />
erstrecken sich entlang der breiten Boulevards<br />
Berlins gefühlte, endlos lange Plattenbauten, Stockwerk<br />
über Stockwerk, noch dazu mit viel geringeren<br />
Raumhöhen als bis dato in den Altbauten üblich.<br />
Insgesamt führte das zu einer weniger verdichteten<br />
Bebauung und als Nebeneffekt zu den vielen Brachoder<br />
Freiflächen, die dem heutigen Berlin (auch dank<br />
kreativer Zwischennutzungen) dessen besonderen<br />
Charme verleihen. Die deutsche Hauptstadt lebt von<br />
den aus der Geschichte resultierenden kontrastreichen<br />
Nachbarschaftsgefügen, den sogenannten<br />
Kiezen. Doch trotz ständiger Nachverdichtung kann<br />
die Stadt mit der stetig wachsenden Nachfrage nach<br />
(bezahlbarem) Wohnraum nicht Schritt halten.<br />
Zeit für neue Ideen und innovative Konzepte – so wie<br />
den „Dachkiez“ des dänischen Architekten Sigurd<br />
Larsen. Auf der letztjährigen Biennale in Venedig<br />
präsentierte der Wahl-Berliner in einer Ausstellung<br />
seinen Lösungsansatz für eine sozialverträgliche und<br />
ökologisch nachhaltige Nachverdichtung bestehender<br />
Substanzen. Das Studienobjekt: ein massiver und<br />
lückenloser Betonblock, an attraktiver Stelle zwischen<br />
den Stadtteilen Kreuzberg und Mitte gelegen.<br />
Die Idee: Ein neuer, grüner Kiez auf dem Dach des<br />
Plattenbaus, bunt durchmischt und zugänglich für<br />
alle Schichten.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
31<br />
Magazin<br />
Dabei wird der Plattenbau nicht separiert betrachtet.<br />
Vielmehr gewinnen die langjährigen Bewohner eine<br />
neue Nachbarschaft und zugleich Zugang zu einer<br />
komplexen Infrastruktur. Diese erstreckt sich sowohl<br />
auf horizontaler, als auch auf vertikaler Ebene und umfasst<br />
Grünflächen, malerische Aussichtspunkte und<br />
Treffpunkte für alle Kiezbürger von Jung bis Alt. Die<br />
„neue Oberschicht“ legt sich als grünes Band mit tief<br />
wurzelnden Bäumen, Wiesen und Hügeln auf das bestehende<br />
Betondach. An dessen Rändern reihen sich<br />
in leichter Holzbauweise Wohnungen wie an einer Perlenkette<br />
zu einem lang gezogenen Dorf aneinander.<br />
Die einzelnen Module basieren auf einem flexiblen<br />
Baukastensystem, das sich individuell an die Bedürfnisse<br />
der Bewohner anpassen lässt. Das Basis-Modul<br />
kann von einem Single oder Paar bewohnt werden.<br />
Ein zusätzliches Plug-in-Modul mit Schlafzimmer<br />
schafft entweder Raum für ein Kind oder für einen<br />
zusätzlichen Bewohner in der WG. Eine dritte Einheit<br />
ergänzt ein weiteres Schlafzimmer und wertet das<br />
Badezimmer für größere Familien auf. Wohnraum für<br />
jedermann und beste Aussichten für die neue Oberschicht<br />
Berlins.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
32<br />
Magazin<br />
Architektur mit<br />
minimalsten Mitteln<br />
Nicht nur der diesjährige Pritzker Preisträger Arata Isozaki arbeitet mit der Leere,<br />
mit dem Zwischenraum, auch die Chinesen können das. Und zwar, fast ohne Architektur<br />
zu machen!<br />
Fotos: Zhu Enlong<br />
Das ursprüngliche Projekt bestand aus einer Anhäufung<br />
von zehn Containern, in drei Ebenen übereinander<br />
geschlichtet und mit ein paar Stiegen verbunden,<br />
in einige waren Fenster- und Türflächen eingeschnitten.<br />
Die Umgestaltung zu einem kleinen Zentrum für<br />
Arbeit, Kommunikation und Freizeit bedeutete eine<br />
gewisse Herausforderung für das Team von Yiduan<br />
Shanghai Interior Design aus China. Einerseits stand<br />
das Ensemble ziemlich isoliert auf einem weiten Grasgebiet<br />
in Orenda auf der Insel Chongming in der Nähe<br />
von Shanghai, andererseits brachten die engen Innenräume<br />
der Container große Einschränkungen mit sich.<br />
Statt nun dem gewöhnlichen Container einfach einen<br />
ungewöhnlichen Anstrich zu verpassen, um so<br />
das Projekt aufzuwerten, erweiterten die Planer die<br />
Innenräume durch die Schaffung von angeschlossenen<br />
Leerräumen nach außen. Diese Volumina werden<br />
durch Gitter, Lamellenwände und -decken gefasst,<br />
spürbar gemacht und erweitern so den nutzbaren<br />
Raum. Sie erfüllen auch funktionelle Bedürfnisse und<br />
bilden einen Kontrast mit der Masse und dem Körper<br />
der Container. Das durch die Gitterflächen eintretende<br />
Tageslicht generiert fast poetische Licht- und<br />
Schattenspiele. Die Container und die neuen „Körper“,<br />
die aus ihnen so entstanden sind, stellen nun<br />
eine überlappende und gestapelte architektonische<br />
Form dar – sie wirkt fast futuristisch, auf jeden Fall<br />
interessant und modern.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
33<br />
Magazin<br />
Der Gesamteindruck dieser, im Mai 2018<br />
fertiggestellten Architektur spiegelt sich in<br />
einer wohl abgestimmten Palette von Weißund<br />
hellen Holztönen wider. Sie erzeugen<br />
einen sauberen, einfachen visuellen Eindruck.<br />
Außerdem fügen sich die Gebäude<br />
so recht harmonisch in die Weite der umgebenden<br />
Wiesenflächen ein. Ein mäandernder<br />
Flusslauf schlängelt sich in der Mitte<br />
der Gebäude durch, er symbolisiert Veränderung<br />
und Leben.<br />
Auf den drei Ebenen befinden sich im Erdgeschoss<br />
der Empfang und eine Ausstellungsfläche,<br />
in der mittleren erhält man<br />
einfache Speisen, Kaffee und Tee und oben<br />
ist der Bereich für Arbeit, Treffen und geschäftliche<br />
Dinge. Die Wegführung durch<br />
die Räume nimmt Rücksicht auf die Umgebung,<br />
jeder Punkt bietet unterschiedliche<br />
Ausblicke und die verwendeten Zen-Elemente<br />
passen sich gut an den modernen<br />
und minimalistischen Designstil an. Innenund<br />
Außenräume fließen ineinander, bilden<br />
ein Ganzes – immer mit kleinen Aufenthaltsbereichen<br />
und Unterbrechungen, die<br />
der Architektur eine Seele verleihen. Ein<br />
gutes Beispiel, wie sich ohne viel neu zuzubauen,<br />
eine vorhandene Substanz mit einfachsten<br />
Mitteln und nachhaltig zu einer interessanten,<br />
funktionalen Architektur (um)<br />
gestalten lässt. Man kann davon lernen!
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
34<br />
Magazin<br />
Leistbares<br />
Wohnen aus Holz<br />
Schon seit einigen Jahren arbeiten holzaffine Personen in Österreich an Konzepten,<br />
Holzbauten in Modulform zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Architekt<br />
Lukas Lang und Stefan Schrenk, Sohn des Waldviertler Tischlers Franz Schrenk,<br />
zählen zu diesem Kreis und nun haben sie sich mit der Firma Appel aus dem<br />
Waldviertel zusammengetan und „ZiKK 2.0 – Das Plug-In Haus“ aus der Taufe<br />
gehoben. Der Name ZiKK steht für Zimmer, Kuchl, Kabinett im 21. Jahrhundert.<br />
Fotos: Julian Haghofer<br />
Das Haus, das in vier Modellen angeboten<br />
wird, besticht durch seine herausragenden<br />
ökologischen Eigenschaften<br />
samt technischem High-End. Drei Jahre<br />
lang hat man an der Entwicklung des<br />
Hauses getüftelt. Das Plug-In-Haus basiert<br />
auf einem Baukastensystem der Lukas<br />
Lang Building Technologies GmbH<br />
und der vorproduzierten Technikbox von<br />
Appel mit der gesamten Haustechnik. So<br />
kann jedes der Haus-Modelle zwischen<br />
47 und 101 Quadratmetern in fünf bis<br />
zehn Tagen Bauzeit schlüsselfertig an<br />
seine Besitzer übergeben werden.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
35<br />
Magazin<br />
ZiKK 2.0 benötigt kein Fundament, sondern<br />
steht auf Stelzen, dadurch wird<br />
kein Boden versiegelt. Das Dach ist begrünt<br />
und überschüssiges Regenwasser<br />
wird in den Boden abgeleitet. Wenn<br />
man woanders wohnen will, nimmt man<br />
sein Haus einfach mit und gibt den Boden<br />
wieder frei für die Natur. Außerdem<br />
wurde bei der Bauweise auf alle Verbundwerkstoffe<br />
verzichtet und durch<br />
die komplette Zerlegbarkeit des Hauses,<br />
wird jeder Sondermüll vermieden. Alle<br />
Komponenten können im Bedarfsfall<br />
getrennt wiederverwertet oder entsorgt<br />
werden, es entstehen keine Altlasten.<br />
Das eben eröffnete Musterhaus in Vitis<br />
ist eine von vier möglichen Varianten<br />
mit 77 m², einer großzügigen Wohnküche,<br />
zwei Schafzimmern und Terrasse.<br />
Je nach Größe liegen die Preise für die<br />
schlüsselfertige Errichtung zwischen<br />
189.000, - und 297.000, - EUR. Das Niedrigenergie-Smart-Home<br />
kombiniert High<br />
Tech mit dem unvergleichlichen Duft<br />
und dem heimeligen Gefühl von Holz und<br />
ist sozusagen die Summe aller intelligenten<br />
Erfindungen, bewehrten Prüfungen<br />
und Weiterentwicklungen der letzten<br />
20 Jahre in der Baubranche. Über eine<br />
intelligente App lassen sich Funktionen<br />
wie Beschattung, Licht, Heizung u. a. bequem<br />
vom Smartphone aus steuern. Der<br />
Energiebedarf für das Heizen ist beim<br />
Modell „Basis“ (76 m² Wohnnutzfläche)<br />
mit etwa 5.000 kWh pro Jahr angegeben,<br />
somit beläuft sich der Tagesbedarf<br />
auf ca. 13,7 kWh.<br />
MEHR LICHT,<br />
MEHR RAUM,<br />
MEHR RUHE<br />
Mit dem Trennwandsystem<br />
Variflex gestalten Sie Räume<br />
schnell und kom for tabel<br />
genau nach Bedarf. Die Kombination<br />
mit Glas-Elementen<br />
ermöglicht eine Raumteilung<br />
mit maximaler Transparenz und<br />
gleichzeitigem Schallschutz.<br />
T +43 732 600451<br />
office@dorma-hueppe.at<br />
www.dorma-hueppe.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
36<br />
Magazin<br />
Monomaterielle<br />
Bauweise aus Holz<br />
Das IBA Timber Prototype House verkörpert einen neuartigen Ansatz zur Mikro-Architektur:<br />
Es funktioniert im Prinzip wie ein auf die Seite gedrehtes<br />
Blockhaus für das 21. Jahrhundert und kombiniert so die Vorteile traditioneller,<br />
kostengünstiger Blockbauweisen mit den Möglichkeiten digitaler Planungs- und<br />
Fertigungsverfahren. Das Projekt untersucht ein neuartiges Holzbausystem für<br />
zugleich umweltfreundliche, wirtschaftliche und architektonisch ausdrucksstarke,<br />
mono-materielle Gebäudehüllen.<br />
Fotos: ICD Universität Stuttgart, Thomas Mueller<br />
Im Gegensatz zu der horizontalen Stapelung typischer<br />
Blockbauweisen sind hier Kantvollhölzer<br />
stehend aufgereiht. So stimmt die Ausrichtung der<br />
Wandbauteile mit der Haupttragrichtung des Holzes<br />
überein. Zugleich ermöglicht es ohne Beeinträchtigung<br />
der Tragfähigkeit das Einbringen von Schlitzen.<br />
Diese dienen zugleich als Entlastungsschnitte, die<br />
ein Reißen des Vollholzes verhindern. So kann die<br />
Formstabilität und Dichtigkeit gewährleisten werden.<br />
Gleichzeitig werden die Schlitzungen als Luftkammern<br />
genutzt, was die Wärmeleitfähigkeit reduziert<br />
und die Isolationswerte des Materials erhöht. Die<br />
digitale Fertigung ermöglicht dabei die Ausbildung<br />
hochpräziser, luftdichter und sortenreiner Verbindungen<br />
der Holzelemente, ohne jegliche zusätzlichen<br />
Metallbauteile oder Klebstoffe. Das so entstandene,<br />
nachhaltige Mono-Material-Bausystem ist Tragwerk,<br />
Hülle und Dämmung in einem. Es werden selbst die<br />
strengen deutschen Energiesparstandards mit einem<br />
U-Wert von 0,20 W/(m 2 K) erfüllt.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
37<br />
Magazin<br />
Die neuartige Blockbauweise ermöglicht es, die<br />
schachtelartige Ausprägung der meisten Mikro-Architekturen<br />
zu überwinden. Der integrative, computerbasierte<br />
Planungs- und Fertigungsansatz lässt<br />
es zu, Wände und Decken sanft zu verdrehen. Dies<br />
bietet nicht nur die Möglichkeit, das Verhältnis von<br />
Raum und Hüllfläche zu maximieren. Es intensiviert<br />
auch den architektonischen Ausdruck dieses einzigartigen<br />
Mikro-Gebäudes und demonstriert die<br />
Möglichkeiten einer innovativen Baukultur, die auf<br />
regionalem Material und tradiertem Wissen basiert.<br />
Simulationen zeigen, dass der Bau durch seine energieeffiziente<br />
Bauweise alle Merkmale eines Passivhauses<br />
erfüllt.<br />
Herkömmliche Gebäude setzen sich aus einer Vielzahl<br />
verschiedener Materialien zusammen, die mit<br />
hohen Energiekosten und aufwendigen Recyclingmaßnahmen<br />
verbunden sind. Durch den Forschungsansatz,<br />
der auf traditionellen Holzverbindungen<br />
basiert, wurde für das Timber Prototype House ein<br />
System entwickelt, bei dem die strukturellen Fügeund<br />
Verbindungslösungen sowie die luftdichte Hülle<br />
ausschließlich auf der Materialität des Holzes beruhen.<br />
Dadurch konnten die Anzahl der Schichten des<br />
Bausystems erheblich minimiert werden und nach<br />
Ende der Nutzungsdauer ist eine einfache Demontage<br />
für die stoffliche Verwertung gewährleistet. Darüber<br />
hinaus konnten durch die Verwendung des ausschließlich<br />
regionalen Rohstoffes die Energiekosten<br />
für den Materialtransport gering gehalten werden.<br />
Das Timber Prototype House wurde im März <strong>2019</strong><br />
eröffnet. Es ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung<br />
(IBA) Thüringen und kann zur Zwischenpräsentation<br />
der IBA vom 24. Mai bis 29. September<br />
<strong>2019</strong> vor dem Eiermannbau in Apolda, Thüringen, besichtigt<br />
werden. Ein kleines, frei stehendes, vollständig<br />
geschlossenes Mikro-Haus. Die geschwungenen<br />
Wände und die Decke sind sowohl von innen als auch<br />
von außen erlebbar. Die Gebäudeenden finden ihren<br />
Abschluss in übergroßen Fensteröffnungen, die den<br />
Blick auf den Eiermannbau und das angrenzende<br />
Grundstück ermöglichen. Konzipiert als komplett<br />
möbliertes Mikro-Haus, kann das Timber Prototype<br />
House mit allen notwendigen Funktionen für ein angenehmes,<br />
kompaktes Wohnen ausgestattet werden.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
38<br />
Magazin<br />
Perspektive<br />
für die Zukunft<br />
Architektur kann, bzw. soll auch einen pädagogischen Aspekt haben und auch sensitiv<br />
etwas in der Rezeption der Nutzer ändern. Das Internat für die Landwirtschaftsschule<br />
in Bella Vista auf einem Agronomie-Campus im andinen Cochabamba, Bolivien<br />
ist ein gutes Beispiel dafür. Das Ausbildungszentrum mit dem neuen Internatsgebäude<br />
bietet Jugendlichen aus extrem armen Familienverhältnissen eine Perspektive, die<br />
über die in Bolivien übliche Subsistenzlandwirtschaft weit hinausreicht.<br />
Fotos: Cristóbal Palma<br />
Das Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion von<br />
Prof. Ralf Pasel, CODE widmet sich mit dem interdisziplinären<br />
und langfristig angelegten Projekt für das<br />
andine Dorf Bella Vista in Bolivien lokal wirksamen<br />
Lösungsvorschlägen zur Armutsbekämpfung, aber<br />
auch globalen Themen zur wachsenden Urbanisierung<br />
und der Landflucht. Darüber hinaus findet ein<br />
Wissenstransfer über mögliche Baukonstruktionen<br />
zwischen der TU Berlin und der Universidad Major de<br />
San Simon in Cochabamba, Bolivien sowie zwischen<br />
den Studenten und den lokalen Kooperativen, die<br />
handwerklich am Projekt ausgebildet werden, statt.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
39<br />
Magazin<br />
Das Internatsgebäude weist eine klare Gliederung<br />
zwischen Sockel, Wand und Dach auf. Diesen drei<br />
Schichten sind spezifische Materialien und die damit<br />
verbundenen Konstruktionsmethoden, mit welchen<br />
sich die Studierenden auseinandergesetzt haben, zugeordnet:<br />
Beton, Mauerwerk und Holz. Im Gespräch<br />
mit den Einheimischen und unter Verwendung ortsüblicher<br />
Materialien wurden innovative Lösungen auf<br />
Anforderungen der Statik und somit der Sicherheit,<br />
der Gebäudehülle und somit des Komforts und der<br />
Gebäudetechnik entwickelt. Das neue Gebäude ergänzt<br />
funktional die bereits in Betrieb genommene<br />
Schule u. a. mit einer Schlafstätte für die Schüler,<br />
einem Dozentenraum, einer Küche, Ess-, Lern- und<br />
Aufenthaltsbereichen sowie eigenständigen Nassbereichen.<br />
Es ermöglicht in seinem Grundriss Orte<br />
der Begegnung und der Ruhe. Ein privater Patio als<br />
kontemplativer Freiraum und ein kollektiv nutzbarer<br />
Hof erweitern zudem das Angebot von unterschiedlich<br />
qualitativen Außen- und Freiräumen auf dem<br />
Campus. Das bestehende Schulgebäude und der<br />
Neubau des Internats teilen sich die neu erstellte<br />
Pflanzenkläranlage und Frischwasseraufbereitung<br />
für die Felder, die Stromerzeugung durch eine Fotovoltaikanlage<br />
und die Warmwasserzubereitung durch<br />
die im Dachgefälle des Internats integrierte Thermosiphonanlage.<br />
Aufgrund der Materialisierung weist<br />
das Gebäude für die Nutzer einen hohen Wiedererkennungswert<br />
auf und setzt architektonische Standards,<br />
die in Selbstbauweise von den Bewohnern auf<br />
andere Projekte übertragen werden können. Das Gebäude<br />
wird somit zum Lehrmodell selbst.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
40<br />
Magazin<br />
Selbstformende Fertigung<br />
Der Urbach Turm stellt eine einzigartige Holzstruktur dar. Der Entwurf des Turms<br />
verwendet einen neuartigen Selbstformungsprozess für gebogene Holzkomponenten.<br />
Diese Formänderung wird allein durch das Schwinden des Holzes bei<br />
abnehmendem Feuchtegehalt erreicht.<br />
Fotos: IBA Thueringen, Thomas Mueller<br />
Die Technologie der selbstformenden Fertigung von<br />
Massivholzplatten eröffnet mit ihrer einfachen Anpassung<br />
an unterschiedliche Krümmungsradien neue<br />
und unerwartete architektonische Möglichkeiten für<br />
die Verwendung des nachhaltigen, erneuerbaren und<br />
regional verfügbaren Baumaterials Holz.<br />
Die bahnbrechende Entwicklung der großflächigen<br />
Selbstformung stellt einen Paradigmenwechsel im<br />
Holzbau dar. Statt aufwendiger und energieintensiver<br />
mechanischer Umformprozesse, die schwere Maschinen<br />
erfordern, verformt sich der Werkstoff hier ganz<br />
von selbst. Die gebogenen Komponenten der Turmstruktur<br />
aus Brettsperrholz (BSPH / CLT) werden<br />
als flache Paneele geplant und hergestellt, die sich<br />
während des Trocknens autonom in vorausberechnete,<br />
gekrümmte Formen biegen. Die 5,0 m x 1,2 m<br />
großen Bilayer aus Fichtenholz werden mit hoher<br />
Holzfeuchte und spezifischem Schichtaufbau hergestellt<br />
und in einem industriell standardisierten Trock-<br />
nungsverfahren getrocknet. Beim Herausnehmen<br />
aus der Trockenkammer sind die Elemente präzise<br />
gekrümmt. Diese werden anschließend miteinander<br />
überlappend laminiert, um die Geometrie zu fixieren,<br />
und bilden so größere, formstabile, gekrümmte<br />
Brettsperrholz-Komponenten.<br />
Die selbstformenden Komponenten bestehen vollständig<br />
aus regional bezogenen Fichtenholzbrettern<br />
aus der Schweiz. Die einzelnen Bauteile weisen eine<br />
Länge von bis zu 15 m auf, mit einem Radius von<br />
2,40 m und einer Bauteildicke von nur 90 mm. Die<br />
Komponenten sind aus Halbzylinderrohlingen 5-achsig<br />
CNC-gefräst und zu Baugruppen aus drei Komponenten<br />
einschließlich Wassersperre und externer<br />
Holzverkleidung für den Transport vormontiert. Mit<br />
präziser, vorausberechneter Krümmung und optimaler<br />
Faserausrichtung aus dem Herstellungsprozess<br />
wird jede Komponente in nur 90 Minuten Maschinenzeit<br />
geschnitten und bearbeitet.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
41<br />
Magazin<br />
Auf der Außenseite wird eine maßgefertigte Fassade<br />
aus geschnittenen Brettschichtholzträgern aus Lärche<br />
aufgebracht. Dies umfasst ebenfalls die Anwendung<br />
einer transparenten, dauerhaften anorganischen<br />
Beschichtung, die das Holz vor UV-Strahlung und<br />
Pilzbefall schützt. Anstatt zu reißen und unter Witterungseinflüssen<br />
silbergrau zu werden, erhält das Lärchenholz<br />
mit der Zeit eine gleichmäßige weiße Farbe.<br />
Die gesamte Prozesskette, vom Schneiden der regionalen<br />
Stämme im Sägewerk über die Herstellung<br />
der selbstformenden Platten, den Trocknungsprozess<br />
bis hin zur Endbearbeitung und Vormontage,<br />
erfolgt innerhalb derselben Unternehmensgruppe<br />
und am gleichen Standort. Dies ermöglicht nicht nur<br />
eine nachhaltige und innovative Produktion, sondern<br />
zeigt auch, wie sich die selbstformende Fertigung<br />
nahtlos in bestehende industrielle Holzverarbeitungs-<br />
und Fertigungsabläufe integrieren lässt.<br />
Der Urbach Turm besteht aus zwölf gekrümmten<br />
Bauteilen aus Brettsperrholz. Die Tragkonstruktion<br />
des Turms weist eine Dicke von 90 mm auf und ist<br />
über 14 Meter hoch, was zu einem Spannweiten-Dicken-Verhältnis<br />
von ca. 160:1 führt. Die Krümmung<br />
ermöglicht eine sehr schlanke und leichte Turmstruktur<br />
von nur 38 kg pro Quadratmeter Turmoberfläche.<br />
Im montierten Zustand wirkt der Turm durch seine<br />
ausdrucksvolle gekrümmte Geometrie statisch als<br />
flächenaktive Struktur. Die Verbindung der Leichtbauelemente<br />
erfolgt durch kreuzweise angeordnete<br />
Vollgewindeschrauben, deren Anordnung und spezifischer<br />
Winkel im gesamten Bauwerk in Bezug auf<br />
ihre statische Ausnutzung optimiert sind, wobei eine<br />
durchgehende Verbindung entlang der Naht für einen<br />
homogenen Lastabtrag sorgt.<br />
Auf Zuverlässigkeit bauen.<br />
Mit dem Schöck Isokorb®.<br />
Ob frei auskragender oder gestützter Balkon, ob Attika oder Brüstung. Der Schöck Isokorb®<br />
bietet optimale Wärmedämmleistung ohne Einschränkung der Statik und der Gestaltungsfreiheit.<br />
Verlassen Sie sich auf die bewährte Spitzenqualität von Schöck.<br />
Schöck Bauteile Ges.m.b.H | Thaliastraße 85/2/4 | 1160 Wien | Tel.: 01 7865760 | www.schoeck.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
42<br />
Magazin<br />
Eine Hommage<br />
an den Bambus<br />
Anmutig winden sich zahllose Bambusstangen spiralförmig in den Himmel, verdichten<br />
sich hier und da zu einem höhlenartigen Gewölbe, lösen sich an anderer<br />
Stelle wieder komplett auf. Gerade dieser Wechsel zwischen durchscheinenden<br />
und geschlossenen Strukturen, Geborgenheit und Offenheit, verleiht dem Nocenco<br />
Café hoch über den Dächern der Stadt Vinh in Vietnam seinen besonderen Charme.<br />
Fotos: Trieu Chien<br />
Die vom Vietnamkrieg gebeutelte Regionalmetropole<br />
orientierte sich beim Wiederaufbau städtebaulich an<br />
europäischen Vorbildern und überrascht neben einigen<br />
Plattenbauten im DDR-Stil auch mit zahllosen<br />
Fassaden kolonialistischer Façon. So auch das zentral<br />
gelegene siebenstöckige Bestandsgebäude, auf dessen<br />
oberstem Geschoss sich seit Mai 2018 ein Loungecafé<br />
mit darüberliegendem Club befindet. Trotz umfassender<br />
Renovierungsarbeiten sollten die Fassade<br />
und tragende Strukturen unangetastet bleiben.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
43<br />
Magazin<br />
Eine interessante Herausforderung für das<br />
erprobte Team der VTN Architekten, welche<br />
den gesamten Entwurfsprozess unter das<br />
Motto “Leichtigkeit” stellten. Planern und<br />
Bauherren war es außerdem ein Anliegen, die<br />
Bauzeit kurz und das Budget knapp zu halten.<br />
So fiel die Wahl des Baustoffes schnell<br />
auf den von den Architekten favorisierten<br />
Bambus. Dieser grüne Stahl der Zukunft ist<br />
nicht nur leicht, robust, schnell nachwachsend<br />
und in unmittelbarer Nähe zur Genüge<br />
verfügbar, sondern verkörpert im asiatischen<br />
Raum auch Tradition und Demut.<br />
In der Industriestadt Vinh wirkt der Einsatz,<br />
des in der Region sonst so allgegenwärtigen<br />
Tausendsassa Bambus, geradezu innovativ<br />
und revolutionär. Aus der Ferne präsentiert<br />
sich der kuppelartige Aufbau als neue Ikone<br />
der Nachbarschaft. Bei näherer Betrachtung<br />
weckt die schon von der Straße aus<br />
erkennbare kunstvolle Konstruktion der<br />
selbsttragenden Bambusröhren die Neugier<br />
des Betrachters. Im Inneren schließlich<br />
eröffnet sich eine mäandernde Raumfolge,<br />
deren Struktur sich in alle vier Himmelsrichtungen<br />
sowie nach oben öffnet, um den<br />
Blick auf die umliegenden Flachbauten und<br />
historischen Gebäude, den Fluss, die Waldlandschaft<br />
und den Himmel freizugeben.<br />
Im Inneren verdecken zehn Bambussäulen<br />
die bestehende tragende Konstruktion, vier<br />
weitere fungieren als raumbildende Strukturen,<br />
welche die Fläche zonieren und die<br />
Blicke elegant nach außen lenken. Der neue<br />
Dachaufbau wirkt von außen respektvoll,<br />
mutet sogar etwas archaisch an. Im Inneren<br />
sorgen grüne Pflanzen, transparente<br />
Glaskugelleuchten und leichte Holzmöbel<br />
für moderne Leichtigkeit und eine loungige<br />
Atmosphäre.<br />
Das Nocenco Café ist sicherlich ein gelungenes<br />
Beispiel für eine moderne und verspielte<br />
Interpretation eines altgedienten und bewährten<br />
Baustoffes, der auch in Zukunft andere<br />
Baumaterialien ersetzen könnte, wenn<br />
mehr Architekten lernten, seine Stärke und<br />
Vielseitigkeit kreativ zu nutzen.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
44<br />
Magazin<br />
Abfallstoff als<br />
„Liquid Gold“<br />
Das WC ist (laut Kreativitätsforscher und Psychologe Mihály Csíkszentmihályi) als<br />
Ort der Kreativität bekannt, als Ort von sogenannten entfunktionalisierten Phasen im<br />
Tagesverlauf. Dass es auch ein Ort von ausgesprochener Nachhaltigkeit sein kann,<br />
beweist die Entwicklung von Save! Die erste Separations-Toilette der Welt, die Urin<br />
vom Rest trennt und ein neues Kapitel des nachhaltigen Urban-Wastewater-Managements<br />
darstellt.<br />
che Verwendung von Düngemitteln werden<br />
von der Wissenschaft bereits als genauso<br />
gefährlich eingestuft wie zu hohe CO 2 -Werte<br />
und der Klimawandel.<br />
Die Schlüsselinnovation von Save! ist ein von<br />
EOOS entwickeltes Rohrsystem, das Urin<br />
unter Ausnutzung der Oberflächenspannung<br />
in einen getrennten Ablauf ableitet<br />
und so vom Rest separiert. Mittels kompakter,<br />
hocheffizienter dezentraler Bio-Reaktoren<br />
werden die Nährstoffe aus dem Urin<br />
extrahiert, Medikamenten-Rückstände und<br />
Hormone neutralisiert und bis zu 80 Prozent<br />
des im Abwasser enthaltenen Stickstoffs<br />
entfernt. Der im Urin vorkommende<br />
Stoff kann nun dort verwendet werden, wo<br />
er als wertvolle Ressource Nutzen bringt,<br />
zum Beispiel als Dünger auf Feldern.<br />
Man hat diese Technologie, die modernsten<br />
Industrie-Standards entspricht, auf das<br />
Wand-WC angewandt und mit innovativer<br />
Wasser- und Urinführung neu gestaltet, um<br />
die Leistung zu optimieren. Durch die perfekte<br />
Integration der neuen Technik ist das<br />
WC optisch nicht von anderen spülrandlosen<br />
Design-WCs im High-End-Bereich zu<br />
unterscheiden. Produziert wird die Innovation,<br />
die serienreif ist und in Neubauprojekte<br />
installiert werden kann, im Werk im niederösterreichischen<br />
Wilhelmsburg.<br />
Die Zukunfts-Toilette ist das perfekte Beispiel<br />
dafür, was alles erreicht werden kann,<br />
wenn die Disziplinen Social Design, Industrie<br />
und Forschung kooperieren. Nämlich die<br />
Lösung eines Umweltproblems, das besonders<br />
in urbanen Zentren immer gravierender<br />
wird und durch die Rückführung von<br />
Nährstoffen in die Landwirtschaft gelöst<br />
werden kann.<br />
Save! ist Teil des „Reinvent the Toilet Challenge“<br />
Programms der Bill & Melinda Gates<br />
Foundation.<br />
Bei konventionellen Toiletten gelangt der<br />
Urin über das Abwasser in Flüsse und Meere.<br />
Der darin enthaltene Stickstoff unterstützt<br />
hier das Wachstum von Algen. Jene<br />
Mikroben, die diese zersetzen, verbrauchen<br />
dabei fast den gesamten Sauerstoff. Viele<br />
Flussmündungen werden so zu „Dead<br />
Zones“ – fast 60 davon gibt es bereits an<br />
europäischen Küsten. Deshalb haben LAU-<br />
FEN und EOOS Design gemeinsam mit der<br />
Eawag (Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung,<br />
Abwasserreinigung & Gewässerschutz)<br />
Save! entwickelt. Das Produkt<br />
wurde bei den Architekturtagen <strong>2019</strong> erstmals<br />
in Österreichpräsentiert.<br />
Wie Abwässer derzeit entsorgt werden,<br />
trägt maßgeblich zu einem der dringlichsten<br />
Umweltprobleme der Erde bei. Übermäßige<br />
Stickstoffwerte, verursacht durch<br />
menschlichen Urin und die landwirtschaftli-
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
45<br />
Magazin<br />
Gernot Bohmann,<br />
Harald Gründl<br />
& Martin Bergmann<br />
© Elfi Semotan<br />
Der lange Weg in eine<br />
bessere Zukunft<br />
Selten hört man von Erfindungen – die noch<br />
dazu bereits von der Industrie produziert<br />
werden können – die ein Wesentliches zur<br />
Verbesserung der Umweltsituation auf unserem<br />
Planeten beitragen. Die Präsentation von<br />
Save! war Grund genug für <strong>architektur</strong>, sich<br />
mit einem der Entwickler, mit Harald Gründl<br />
vom Designbüro EOOS zu unterhalten.<br />
Welche Beweggründe hat ein Designer, sich<br />
mit der Rettung der Welt zu beschäftigen?<br />
Dieses Produkt, diese Entwicklung, stellt einen<br />
Paradigmenwechsel in der Sanitärindustrie<br />
dar. 2008 haben wir von EOOS beschlossen,<br />
unsere Kräfte systemischer und nachhaltiger<br />
einzusetzen. Denn Designer werden meist nur<br />
nach einem Produkt gefragt, zum Beispiel einer<br />
Badewanne. Aber kein Mensch überlegt<br />
sich, wie wird das Wasser erwärmt und was<br />
passiert mit dem Abwasser.<br />
Ist das so eine Art Tunnelblick des Designs,<br />
nicht im Kontext zu arbeiten?<br />
Das sind nicht nur die Designer, sondern<br />
auch die Industrien, die nicht vernetzt funktionieren<br />
oder denken.<br />
Wie ging es dann weiter?<br />
Wir haben damals beschlossen, zwar auch<br />
weiterhin isoliert über Dinge nachzudenken<br />
– aber nicht mehr ausschließlich. Ich bin<br />
dann in die Schweiz gefahren, auf die ETH<br />
Zürich zur Eawag und habe dort die führende<br />
Abwasserwissenschaftlerin gefragt: „Ich<br />
bin Designer, könnt ihr uns für irgendetwas<br />
gebrauchen?“ „Ja“, hat sie gesagt, „entwirf<br />
ein Urinseparationsklo und schau, dass es<br />
jemand herstellt.“<br />
Ich habe fast zehn Jahre gebraucht, um dieses<br />
Versprechen einzulösen – aber ich habe<br />
es geschafft!<br />
Glauben Sie, dass die Probleme bezüglich<br />
Ressourcen, Klima etc, die wir haben, nicht<br />
genügend kommuniziert werden?<br />
Nein, am Wissen über die Probleme liegt es<br />
nicht. Das Stickstoffproblem der Erde ist allerdings<br />
vielleicht nicht wirklich genug bekannt,<br />
schließlich ist es noch alarmierender<br />
als der Klimawandel.<br />
Wieso handeln die Menschen dann nicht<br />
entsprechend? Sind wir zu dumm?<br />
Eine starke Verhaltensänderung benötigt<br />
sicherlich Courage. Niemand zerstört absichtlich<br />
die Welt, aber unser Konsumverhalten<br />
ist dann doch ein großes Problem. Es<br />
braucht ein Zusammenwirken von Politik,<br />
Industrie und natürlich Design und Architektur.<br />
Ein nachhaltiges Abwassersystem<br />
ist eine Infrastrukturentscheidung, keine<br />
individuelle Konsumentscheidung. Unsere<br />
Toilette Save! ist eine Systemkomponente<br />
die eine nachhaltige Abwasserlösung<br />
ermöglicht. Statt Algenteppichen im Küstenbereich<br />
können wir mit den Nährstoffen<br />
besser die Felder düngen! Ja, vielleicht sind<br />
wir wirklich zu dumm, wenn wir das nicht<br />
schnell umsetzen.<br />
Ist dieses Gebiet der Produktentwicklung<br />
für eine „grüne“ Zukunft, nicht auch ein riesiges<br />
Geschäftsfeld?<br />
Natürlich, aber Pioniere müssen auf die Ernte<br />
manchmal länger warten. Aufgrund der<br />
Dringlichkeit des Systemwandels sollte es<br />
jetzt aber schneller gehen. Es gibt viel zu<br />
tun für das Design.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
46<br />
Wohnkapseln<br />
© Luca Rotondo<br />
Die flexible Wohnkapsel –<br />
die Architektur der Zukunft?<br />
Der sparsame Umgang mit dem Raum ist ein neuer, wichtiger Trend in der Architektur.<br />
Viele Planer sehen es als ihre Aufgabe an, nachhaltige und vor allem platzsparende<br />
Lösungen für das Koexistieren des Menschen mit seiner Umwelt zu finden.<br />
Auch steht die Architektur heute vor der Herausforderung, Bauten zu entwerfen, die<br />
sich wechselnden Temperaturen und Witterungsbedingungen anpassen. Nicht nur<br />
hierzulande sorgt der Klimawandel für unvorhersehbare Wetterphänomene. Folgende<br />
Beispiele zeigen, wie sich kompakte Wohnformen auf knappem Raum realisieren<br />
lassen und dabei trotzdem Lebensqualität bieten.<br />
Text: Dolores Stuttner<br />
Das Haus aus dem Drucker<br />
Mit einem tragbaren Roboter schafften es<br />
die Planer von Arup und CLS Architetti, ein<br />
Haus im 3D-Druckverfahren in weniger als<br />
einer Woche herzustellen. Präsentiert wurde<br />
das 3D Housing 05 auf der Milan Design<br />
Week <strong>2019</strong>.<br />
Es steht auf dem Piazza Cesare Beccaria in<br />
Mailand mit einer Wohnfläche von 100 m 2<br />
und setzt sich aus 35 Modulen zusammen.<br />
Geschwungene Wände umschließen ein<br />
Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlaf- und<br />
ein Badezimmer. Der Bau selbst besteht aus<br />
einer Mischung aus Beton mit speziellen<br />
Zusätzen. Ein Stapel aus sauber verarbei-<br />
teten Schichten bildet das Mauerwerk. Die<br />
Wände wurden vom Roboter wie Zahnpasta<br />
aus der Maschine gedrückt. Das Ergebnis<br />
kann sich aber sehen lassen – die daraus<br />
entstandene Struktur ist formgebend und<br />
verleiht dem Haus Individualität. Nur 48<br />
Stunden dauerte der Aufbau des Gebäudes,<br />
wobei die Konstruktion eines Mauersegments<br />
nur eine Stunde in Anspruch<br />
nahm. Nicht im Druckverfahren hergestellt<br />
wurden Bestandteile wie Fenster und Türen.<br />
Der Innenraum ist eine Mischung aus Moderne<br />
und Minimalismus. Vergoldete und<br />
glänzende Oberflächen samt glatten Stein-<br />
möbeln bilden einen ansehnlichen Kontrast<br />
zu den mattweißen, rauen Wänden. Diese<br />
umschließen die Räume kreisförmig und<br />
bilden dadurch eine heimelige, schützende<br />
Hülle. Derzeit ist das Mailänder Haus aus<br />
dem 3D-Druck noch ein Prototyp. Die Architekten<br />
wollen die Technik derart weiterentwickeln,<br />
dass das Konzept bald in Serie<br />
geht. Mit ihrem Konstrukt zeigen die Planer<br />
eine Alternative zum traditionellen Bau auf.<br />
Auch die Herstellung von Möbeln ist mit<br />
dieser Methode möglich.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
47<br />
Wohnkapseln<br />
© Janez Martincic<br />
Ein Pavillon für jede Klimazone<br />
Den Prototyp für ein modulares Haus, das<br />
sich für eine Vielzahl an Standorten und<br />
Klimazonen eignet, entwarf die slowenische<br />
Firma OFIS Arhitekti. Der Bau besteht<br />
aus mehreren Modulen, die sich variabel<br />
zusammensetzen lassen. Sie können beispielsweise<br />
vertikal übereinander oder horizontal<br />
angeordnet werden – damit passt<br />
sich der Wohnbau dem Terrain und den<br />
Witterungsbedingungen an. Das Gebäude<br />
kann unter anderem als permanenter oder<br />
auch als temporärer Wohn- und Aufenthaltsraum<br />
genutzt werden. Die Basis-Einheit<br />
ist 2,5 Meter breit, 4,5 Meter lang und<br />
2,7 Meter hoch. Sie bietet ausreichend Platz<br />
für ein Bett, eine Küche und ein Bad. Beim<br />
Prototyp verfügt die Einheit über einen hölzernen<br />
Rahmen, wobei das Material je nach<br />
Einsatzgebiet austauschbar ist. Auch das<br />
Innere der Module besteht fast vollständig<br />
aus Holz. Die Einrichtung ist funktional und<br />
bietet ausreichend Möglichkeiten zur Personalisierung.<br />
Doch auch in Bezug auf die<br />
Bausubstanz sind Erweiterungen und Anpassungen<br />
möglich.<br />
© Janez Martincic<br />
Die Module fallen auf. Verantwortlich dafür<br />
ist nicht zuletzt der satte Schwarzton mit<br />
der konischen Struktur. Diese Mischung<br />
macht es zu einer Landmarke – ganz gleich,<br />
ob es sich im urbanen oder ländlichen Raum<br />
befindet. Quadratische Fenster an beiden<br />
Seiten gewähren Blicke auf die Umgebung.<br />
Die Basis ist mit dem flächenmäßig größten<br />
Fenster versehen, welches die Vorderseite<br />
fast zur Gänze ausfüllt. Ansonsten sind sie<br />
bewusst klein gehalten, um eine Überhitzung<br />
der Module zu verhindern. In seiner<br />
horizontalen Ausrichtung ist das modulare<br />
Haus platzsparend. Der sparsame Umgang<br />
mit dem Raum trifft den Zahn der Zeit. Die<br />
Module, die allesamt aus erneuerbaren<br />
Rohstoffen bestehen, fügen sich nahtlos<br />
in ihre Umgebung ein und bieten trotzdem<br />
Lebensqualität. In Ljubljana ist „The Cabin“<br />
derzeit als temporäre Bibliothek im Einsatz.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
48<br />
Wohnkapseln<br />
© oxygen<br />
Im Einklang mit der Natur<br />
Ein Rückzugsort inmitten der Natur ist die kompakte<br />
Hütte Lumipod der Entwickler Lumicene. Die Bewohner<br />
haben in ihr die Gelegenheit, Komfort auf kompaktem<br />
Raum zu genießen. Eine große Glasfront mit<br />
fünf Metern Durchmesser bildet das Herzstück der<br />
Hütte. Der Bereich lässt sich öffnen und sorgt für das<br />
Verschwimmen von Innen- und Außenbereich – die<br />
Natur wird damit zum Wohnzimmer. Ist Privatsphäre<br />
gewünscht, können die Bewohner die Fenster auch<br />
ganz verschließen und sich von der Außenwelt abschirmen.<br />
Der Grundriss der Hütte ist ein simpler Kreis mit einem<br />
Durchmesser von nur 5,45 Meter. Auf einer Fläche<br />
von 17 m² mit einer Höhe von 3,25 Meter wird den<br />
Bewohnern alles zur Verfügung gestellt, was sie für<br />
einen kurzen, komfortablen Aufenthalt brauchen. In<br />
der Kapsel befinden sich Schlafzimmer, Toilette und<br />
Dusche. Da die Unterseite des Gebäudes den Untergrund<br />
nur punktuell (vier Sockel) belastet, wird dieser<br />
nicht beeinträchtigt und die Wiese bleibt fast frei<br />
von Druckstellen.<br />
Außenwände aus dezent gefärbtem Holz verleihen<br />
der Hütte ein natürliches Aussehen. Beim Innenraum<br />
beschränkten sich die Designer ebenfalls auf<br />
das Wesentliche. Jeder Bereich hat eine Funktion,<br />
wobei Komfort trotzdem nicht zu kurz kommt. Minimalistisch<br />
ist auch die Beleuchtung. Glühbirnen und<br />
Leuchtdioden erhellen Wohnzimmer und Sanitärbereich.<br />
Das Design fällt abgesehen davon, hell und<br />
schlicht aus. Gerade Linien und rechte Winkel stehen<br />
im Gegensatz zum kreisrunden Fundament. Die Konstruktion<br />
lässt sich innerhalb von zwei Tagen zusammenbauen<br />
und wird innerhalb von sechs Monaten an<br />
den gewünschten Ort geliefert. Die Designer streben<br />
derzeit eine auf Energieautarkie ausgelegte Weiterentwicklung<br />
der Kapsel an.<br />
© oxygen
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
49<br />
Wohnkapseln<br />
© Rana Rmeily<br />
Nur ein Raum<br />
Abseits der Öffentlichkeit liefert der Pavillon von<br />
TheLoveTriangle einen Raum für experimentelle<br />
Kunst und Ausstellungen. Die Planer machten aus<br />
der abgeschiedenen Lage des Objekts eine Tugend.<br />
So ist seine Zurückgezogenheit im libanesischen Baabdat<br />
für den Bau identitätsstiftend. Fast unscheinbar,<br />
aber keinesfalls unbedeutend integriert er sich<br />
in die natürliche Umgebung. Das Design ist einfach<br />
und das Ergebnis ein Rechteck mit 96 m² Fläche. Das<br />
Rechteck schafft eine neutrale Grundlage für vielseitige<br />
Nutzungen.<br />
Pinienbäume umgeben den Bau und werden für ihn<br />
durch die großen Fenster zu einer wichtigen Kulisse.<br />
Die Umgebung präsentiert sich als neutraler Hintergrund<br />
und wirkt – genauso wie der Pavillon – wie<br />
ein unbeschriebenes Blatt Papier. Dabei reguliert<br />
die Natur mit dem dichten Baumwuchs das Klima im<br />
Gebäude. Sie schirmt den nach Nord-Süd ausgerichteten<br />
Pavillon im Sommer vor intensiver Sonneneinstrahlung<br />
ab. Im Winter trifft ihn die Sonne ungehindert<br />
und erwärmt die Südseite. Zurückhaltung ist<br />
auch im Innenraum Programm. Sowohl der Boden als<br />
auch die Raumdecke wird von hellem Beton gebildet.<br />
Dreidimensionale Strukturen an der Oberseite der<br />
Raumdecke sorgen mit einem Wechselspiel aus Licht<br />
und Schatten für Abwechslung.<br />
Der Pavillon kommt ohne elektrischen Anschluss<br />
und ohne Heizung und Warmwasser aus. Das Ziel der<br />
Planer war es, ein Gebilde zu schaffen, dessen Bedürfnisse<br />
die Natur erfüllt. Trotzdem wurden Grundlagen<br />
für elektrische Installationen geschaffen. Ein<br />
Stromaggregat müssen die Aussteller oder Künstler<br />
selbst organisieren. Es ist für eine Vielzahl an Nutzungen<br />
geeignet und liefert Raum für Experimente<br />
der Kunst und Nachhaltigkeit.<br />
© Rana Rmeily
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
50<br />
Wohnkapseln<br />
© Agnès Clotis<br />
© Agnès Clotis<br />
Flexibler Minimalismus in roher Hülle<br />
Eine Mischung aus modernem Komfort und traditionellen<br />
Materialien ist die vorgefertigte Hütte h-eva im Südwesten<br />
Frankreichs. Die Architekten von Studio A6A bedienten sich<br />
beim Bau nur einheimischer Holzarten. Um die Hölzer vor Insekten<br />
und Witterungseinflüssen zu schützen, wurden sie im<br />
Vorfeld mit Feuer versiegelt. Eine robuste und dunkle, beinahe<br />
rohe Außenhaut ist das Ergebnis.<br />
Auf 20 m² brachten die Planer die gesamte Ausstattung unter.<br />
Sie setzt sich aus einem Ess- und Wohnzimmer, einer Küche,<br />
einem Badezimmer und zwei Betten zusammen. Der Raum<br />
wurde so gestaltet, dass er das tägliche Leben mit dem Außenbereich<br />
verknüpft. Der Pavillon berührt die Erde nur leicht<br />
und belastet den Boden möglichst wenig. Nach seiner Entfernung<br />
lässt sich das Land schnell wieder seiner ursprünglichen<br />
Nutzung zuführen.<br />
Mit einem Kran lässt er sich schnell und leicht aufbauen. Der<br />
rechteckige Grundriss nimmt wenig Platz ein und lässt sich<br />
selbst auf knapp bemessenen Grundstücken aufstellen. Zwei<br />
Personen haben in der Hütte Platz – er lässt sich damit sowohl<br />
als minimalistischer Wohnraum als auch als Ferienhaus<br />
einsetzen. Wände, Decken, Fußböden und Möbel bestehen<br />
allesamt aus hellem Holz – sie tauchen die Räume in ein angenehmes<br />
Licht. Man verzichtete bewusst auf aufwendige<br />
Verzierungen und beschränkte sich beim Entwurf auf das<br />
Wesentliche – ohne Farben und übertriebene Formensprache.<br />
Für die Beleuchtung sorgen neben geschickt angebrachten<br />
Lampen im Ess- und Wohnbereich, die großen, leinwandähnlichen<br />
Fenster. Je nach Ausrichtung der mobilen Hütte dienen<br />
sie entweder als Kulisse oder als natürliche Lichtquelle. Durch<br />
die breite Fensterfront, die sich vollständig öffnen lässt, verwischen<br />
sich Innen- und Außenbereich.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
51<br />
Wohnkapseln<br />
© Nice Architects<br />
Energieautarkes Ei<br />
Smartes Design auf kompaktem Raum – mit diesen<br />
Eigenschaften könnte das innovative Projekt eines<br />
slowakischen Designbüros zum Vorreiter unter mobilen<br />
Wohnlösungen werden. Denn das Objekt funktioniert<br />
unabhängig von existierender Infrastruktur<br />
– damit ermöglicht es auch an abgelegenen Orten<br />
einen angenehmen Aufenthalt.<br />
Einen Lebensraum für zwei Erwachsene bietet die<br />
eiförmige Kapsel von nice&wise design. Das kompakte<br />
Objekt namens „Ecocapsule“ ist dabei nicht nur<br />
energieeffizient, sondern bietet auch Lebensqualität.<br />
Es enthält zwei Betten, ein Bad mit Warmwasser,<br />
eine kleine Kücheneinheit, eine trockene Toilette und<br />
großzügigen Stauraum. Dabei verbraucht die Einheit<br />
nur wenig Energie – den benötigten Strom bezieht<br />
sie aus Solar-Paneelen mit 880 Watt auf dem Dach<br />
und einem Windrad mit bis zu 750 Watt. Über die<br />
Oberfläche wird Regenwasser gesammelt und in einem<br />
Wassertank gespeichert. Dort steht es bei Bedarf<br />
gefiltert zur Verfügung.<br />
Durch ihr kompaktes Design eignet sich die Kapsel<br />
für den mobilen Einsatz. So kann sie mitunter als Unterkunft<br />
für Sportler sowie für Forscher dienen. Sie<br />
lässt sich in unterschiedlichen Klimazonen aufstellen,<br />
schützt die Bewohner vor Witterungseinflüssen<br />
und kann leicht transportiert werden. Vier kurze Beine<br />
verleihen ihr Standfestigkeit und verringern den<br />
Eco-Footprint.<br />
Die weißen Flächen bieten eine neutrale Kulisse für<br />
die Bewohner. Dem Inneren der Kapsel verleihen sie<br />
eine freundliche, helle Atmosphäre. Die Leuchtmittel<br />
sind versteckt und offenbaren sich erst nach Einschalten<br />
des Lichts. Dank der rechteckigen Fenster,<br />
die sich an beiden Seiten des Objekts befinden, wird<br />
der Innenraum untertags durch Tageslicht erhellt. Die<br />
mobile Lösung bietet Bewohnern den Luxus eines Hotelzimmers,<br />
wobei sie trotzdem Unabhängigkeit von<br />
existierender Infrastruktur gewährt. Da das Objekt im<br />
Hinblick auf Praktikabilität und Energieeffizienz entworfen<br />
wurde, ist es zu 100 Prozent energieautark.<br />
© Nice Architects
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
52<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Hans Hollein<br />
Architekt, Designer und Künstler<br />
„Alles ist Architektur“ ist der Slogan, mit dem Hans Hollein in die Geschichte einging.<br />
Tatsächlich war der Wiener nicht nur Architekt. Er wurde auch als Designer,<br />
Aussteller und Raumkünstler angesehen. Vielseitigkeit war bei Hollein Programm.<br />
Experimente gehörten zu seinem Tagesgeschäft. Damit schaffte er es, auch in<br />
Bezug auf Nachhaltigkeit Akzente zu setzen. Herausragend ist dabei vor allem die<br />
Zusammenarbeit mit Walter Pichler. Mit ihm schuf er immer wieder Situationen, die<br />
mit der Wirkung des Raums spielten. Enge und Breite sowie Weite und Höhe machte<br />
sich dieser Doyen der Architektur zunutze.<br />
Text: Dolores Stuttner<br />
Hans Hollein wurde in Wien geboren und<br />
war in der Hauptstadt Österreichs auch zu<br />
Hause. Da verwundert es nicht, dass viele<br />
seiner Bauten hier zu finden sind. In Wien<br />
gehört das 1990 eröffnete Haas Haus im<br />
1. Wiener Gemeindebezirk wohl zu den bekanntesten<br />
Bauten Holleins. Mit seinem<br />
einzigartigen Stil eckte der modernistische<br />
Bau durchaus an und sorgt noch heute für<br />
Diskussionen. Nicht umsonst wurde das<br />
Haas Haus als „Eckhaus der Nation“ bezeichnet.<br />
Mittlerweile ist es mit seiner unverkennbaren<br />
Fassade ein angesehener<br />
Klassiker postmoderner Architektur. Seit<br />
2012 steht das ursprünglich als Bausünde<br />
verschriene Gebäude unter Denkmalschutz.<br />
Bekannt war der Architekt nicht<br />
nur in Wien. Er machte sich vor allem international<br />
einen Namen. So entwarf er unter<br />
anderem die amerikanische Botschaft in<br />
Moskau, das Nationalmuseum Ägyptischer<br />
Zivilisation in Kairo und das Museum für<br />
Glas und Keramik in Teheran. Mit seinen<br />
Projekten schaffte er es, die Baubranche<br />
wieder mit Sinnlichkeit und Emotionalität<br />
zu verknüpfen.<br />
Geordneter Stilbruch<br />
Drastische Effekte scheute Hans Hollein<br />
nicht – Individualität und der Wiedererkennungswert<br />
standen bei seinen Projekten<br />
stets im Vordergrund. Sein Anliegen bestand<br />
auch darin, die Bauwerke der Umgebung<br />
anzupassen. Der Architekt und<br />
Stadtplaner arbeitete gerne mit Bezügen<br />
und betrachtete seine Bauwerke stets im<br />
Kontext des bebauten Raums. Er brachte<br />
mit seinem Spiel der Elemente Harmonie in<br />
den Raum.<br />
Hans Hollein, Haas-Haus, Wien, AT, 1985-1990, Baustelle 1989<br />
Architekturzentrum Wien, Sammlung<br />
Foto: Margherita Spiluttini<br />
Hans Hollein plante gerne fernab der Konventionen.<br />
Jenseits geltender Regeln wollte<br />
er der Architektur zu neuer Blüte verhelfen.<br />
Dafür bediente er sich schon mal gewagter<br />
Visionen – so plante er, die Stadt Wien mit<br />
Felsformationen zu überbauen. Letzten Endes<br />
beschränkte sich sein Schaffen in der<br />
Hauptstadt aber auf einzelne Gebäude –<br />
mit seinen Maßnahmen prägte er das Ortsbild<br />
Wiens trotzdem maßgeblich. Hollein<br />
verewigte sich unter anderem an der Albertina.<br />
Nach der Renovierung der grafischen<br />
Sammlung im Jahr 2001 schrieb die Stadt<br />
Wien einen Wettbewerb aus. Das Gebäude<br />
© Margherita Spillutini<br />
sollte ein neues Wahrzeichen bekommen.<br />
Hollein hob sich mit seinem Entwurf eines<br />
Flugdachs von seiner Konkurrenz ab. Auch<br />
hier bediente er sich einer modernen – und<br />
dabei nicht minder kritisierten – Form und<br />
kreierte inmitten historischer Bauten einen<br />
Stilbruch. Die Rampe zerteilt mit einer<br />
Länge von 53 Metern und einer Breite von<br />
12 Metern den Abschnitt vor dem Museum<br />
und ragt ins Stadtgebiet hinein. Als Symbol<br />
für Geschwindigkeit und Zukunft fungiert<br />
das Dach nunmehr als neues Wahrzeichen<br />
der Sammlung.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
53<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Das Bauwerk als Stadt im Kleinen<br />
„Architektur ist kultisch, sie ist Mal, Symbol,<br />
Zeichen, Expression. Architektur ist die<br />
Kontrolle der Körperwärme – schützende<br />
Behausung.“ Hans Hollein, 1967.<br />
Gebäude waren für ihn nicht nur Lebensund<br />
Arbeitsstätten. Er sah sie vielmehr als<br />
Miniaturstädte – also als Stadt in der Stadt<br />
– an. Daher zeichnen sich viele seiner Bauwerke<br />
durch eine vielseitige Handschrift<br />
sowie wechselnde Materialien auf engem<br />
Raum aus. Zu erwähnen ist hier wiederum<br />
das Haas Haus, an dem sich dieses Stilmittel<br />
deutlich erkennen lässt. Aus einem Mantel<br />
aus Quarzit und Gneis schälte Hollein<br />
hier einen Glaskörper aus. Darüber befindet<br />
sich eine pavillonartige Struktur. In der<br />
glänzenden Oberfläche des Haas Hauses<br />
spiegelt sich der Stephansdom, weshalb<br />
sich das Konstrukt trotz seiner neumodischen<br />
Erscheinung gut in die Wiener Innenstadt<br />
mit ihren Altbauten integriert. Und<br />
gerade wegen dem, auf den ersten Blick so<br />
unterschiedlichen, Baustil sticht das Gebäude<br />
aus seiner Umgebung heraus und ist<br />
für die Altstadt damit identitätsstiftend.<br />
Dass Hollein die Architektur als Kommunikationsmittel<br />
ansah, zeigte er durch die<br />
Realisierung von Leitsystemen. Finesse<br />
bewies er mit seinem 1972 realisierten Orientierungssystem<br />
im Olympiadorf in München.<br />
Schon damals galt sein Konstrukt<br />
aus Röhren als kommunikatives Ideal. Verschiedene<br />
Farben, Beleuchtungen, Dia-Projektoren<br />
und Fernsehschirme dienten der<br />
Orientierungshilfe. Fußboden- und Infrarot-Heizung<br />
samt Wassersprenklern erweiterten<br />
den Komfort. Damit bewies er, dass<br />
– zumindest für ihn selbst – Architektur<br />
tatsächlich alles ist.<br />
© Peter Reischer<br />
Planungsphase noch beim Bau überließ<br />
er etwas dem Zufall. Sogar über die Farbe<br />
des Bauzauns und über Schriftzüge machte<br />
er sich Gedanken. Aufschluss über den<br />
aufwendigen Arbeitsprozess geben seine<br />
detaillierten Studien. Sein Können als Designer<br />
machte sich der Architekt dabei zunutze,<br />
denn neben Häusern entwarf er auch<br />
Details wie Türklinken und Möbel.<br />
Nachhaltige Projekte entstanden aber auch<br />
in der Zusammenarbeit mit Walter Pichler.<br />
Letzterer war für seine bescheidene Lebens-<br />
und Arbeitsweise bekannt. Die Behausungen<br />
für seine Skulpturen schuf er<br />
stets selbst. Dies galt auch für seine erste<br />
Präsentationsmodell Bearbeitungsstand Frühjahr 1987<br />
Archiv Hans Hollein, Az W und MAK, Wien<br />
Foto: Elmar Bertsch<br />
Ausstellung, die er 1963 mit Hollein auf die<br />
Beine stellte. Dabei widmeten sich beide<br />
Visionäre utopischen Architekturmodellen.<br />
Damit waren sie auch erfolgreich – denn<br />
einige Entwürfe wurden 1967 sogar im Museum<br />
of Modern Art in New York gezeigt.<br />
Die Designs bezogen sich auch hier auf die<br />
sparsame Nutzung des Raums.<br />
Über Hans Hollein und eines seiner bedeutendsten<br />
Werke – das Haas Haus – informiert<br />
das Architekturzentrum Wien seine<br />
Besucher seit 13. Juni bis 19. August <strong>2019</strong><br />
im Rahmen der Ausstellung „Hans Hollein<br />
ausgepackt: Das Haas Haus“.<br />
Erste Schritte in<br />
Richtung Nachhaltigkeit<br />
Weitaus weniger bekannt sind die „nachhaltigen“<br />
Projekte des Planers – Begriffe<br />
wie Aktiv- oder Passivhaus sowie Ökologie<br />
standen für ihn nicht im Vordergrund, und<br />
doch gibt es sie. Während er zwar nicht<br />
klassisches „Green Building“ betrieb, verstand<br />
er es trotzdem, die Ressourcen und<br />
den Raum bewusst und sparsam zu nutzen.<br />
Zeugnis dafür ist unter anderem der<br />
erste Großbau des Architekten. Das 1982<br />
errichtete Museum in Mönchengladbach<br />
wurde regelrecht in einen Berg hinein komponiert<br />
und ist ein Musterbeispiel für den<br />
sparsamen Umgang mit Raum. Auch studierte<br />
Hollein vor der Realisierung eines<br />
Projekts stets die Umgebung. Weder in der
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
54<br />
Bau & Recht<br />
Naturalteilung durch Begründung<br />
von Wohnungseigentum<br />
Steht eine Liegenschaft im Eigentum mehrerer schlichter Miteigentümer, kommt<br />
allen Miteigentümern der Besitz der gemeinschaftlichen Sache insgesamt zu. Diese<br />
Rechtslage birgt erhebliches Konfliktpotenzial in sich, insbesondere wenn sich die<br />
Miteigentümer nicht auf eine alle zufriedenstellende Benützungsregelung einigen<br />
können. Eine Möglichkeit, einen solchen Konflikt zu lösen, besteht in der Begründung<br />
von Wohnungseigentum, wodurch jedem Miteigentümer das exklusive Recht<br />
zur Nutzung und Verfügung über ein bestimmtes Wohnungseigentumsobjekt der<br />
Liegenschaft eingeräumt wird.<br />
Text: Mag. Matthias Nödl, Ing. Mag. Julia Mörzinger<br />
Die Begründung von Wohnungseigentum<br />
erfolgt üblicherweise durch den Abschluss<br />
eines Wohnungseigentumsvertrages zwischen<br />
den Miteigentümern und bewirkt die<br />
Aufteilung der Nutzungs- und Verfügungsrechte<br />
an allen wohnungseigentumstauglichen<br />
Objekten der Liegenschaft, sohin<br />
an Wohnungen, sonstigen selbstständigen<br />
Räumlichkeiten (Geschäftsräumlichkeiten,<br />
Lager, etc.) und an Kfz-Stellplätzen. Die<br />
zentralen Bestimmungen des Wohnungseigentumsvertrages<br />
sind im Wohnungseigentumsgesetz<br />
(WEG) geregelt.<br />
Jedoch kann ein einzelner Miteigentümer<br />
den Abschluss eines Wohnungseigentumsvertrages<br />
verhindern, indem er seine<br />
Zustimmung hierzu verweigert. Dies wird<br />
insbesondere dann der Fall sein, wenn der<br />
jeweilige Miteigentümer andere Interessen<br />
als die Begründung von Wohnungseigentum<br />
verfolgt, z. B. die Liegenschaft veräußern<br />
möchte, um daraus einen Erlös zu lukrieren.<br />
In einem solchen Fall kann für jene<br />
Miteigentümer, welche die Begründung<br />
von Wohnungseigentum wünschen, unter<br />
Umständen die gerichtliche Teilung der<br />
Liegenschaft durch Begründung von Wohnungseigentum<br />
Abhilfe schaffen.<br />
Die Teilung einer Liegenschaft durch Begründung<br />
von Wohnungseigentum ist eine<br />
Sonderform der Naturalteilung (physische<br />
Aufteilung der Liegenschaft), welcher nach<br />
herrschender Rechtsprechung gegenüber<br />
der Zivilteilung (durch Veräußerung der<br />
Liegenschaft und Aufteilung des Erlöses)<br />
der Vorzug zu geben ist. Voraussetzung für<br />
eine solche Naturalteilung ist zunächst die<br />
formelle Aufhebung der Miteigentümerge-<br />
meinschaft, die mittels Klage geltend gemacht<br />
werden kann.<br />
Die Miteigentümergemeinschaft wird dadurch<br />
in eine Wohnungseigentümergemeinschaft<br />
umgewandelt, wenn die Begründung<br />
von Wohnungseigentum an der jeweiligen<br />
Liegenschaft faktisch möglich und tunlich<br />
ist. Die Naturalteilung durch Begründung<br />
von Wohnungseigentum ist faktisch möglich<br />
und tunlich, wenn eine ausreichende<br />
Anzahl von Wohnungseigentumsobjekten<br />
vorhanden ist und durch die Begründung<br />
von Wohnungseigentum keine Wertminderung<br />
der Liegenschaft eintritt.<br />
In der Regel wird die Anzahl der Wohnungseigentumsobjekte<br />
von der Rechtsprechung<br />
als ausreichend angesehen, wenn<br />
jeder Miteigentümer Wohnungseigentum<br />
an einem Wohnungseigentumsobjekt erhält,<br />
dessen Nutzwert- bzw. Mindestanteil<br />
seinem bisherigen Miteigentumsanteil<br />
entspricht. Wenn mehr Miteigentümer als<br />
Wohnungseigentumsobjekte vorhanden<br />
sind, können einzelne Miteigentümer auch<br />
auf Liegenschaftsanteile verzichten oder<br />
Eigentümerpartnerschaften mit anderen<br />
Miteigentümern bilden, um die Begründung<br />
von Wohnungseigentum zu ermöglichen.<br />
Die Miteigentümer der jeweiligen Liegenschaft<br />
können im Rahmen des Verfahrens<br />
auch Teilungsvorschläge unterbreiten.<br />
Die Zulässigkeit (Tunlichkeit) der Teilung<br />
durch die Begründung von Wohnungseigentum<br />
ist nicht davon abhängig, ob die<br />
Miteigentümer über die zukünftige Gestaltung<br />
eines oder mehrerer Wohnungseigentumsobjekte<br />
Einigung erzielen. Vielmehr ist<br />
die Zulässigkeit der Begründung von Wohnungseigentum<br />
anhand des „Ist-Zustandes“<br />
und der tatsächlichen Nutzungsverhältnisse<br />
der Liegenschaft zu beurteilen. Eine<br />
Wertsteigerung, die sich allenfalls künftig<br />
realisieren lässt (z. B. durch einen Dachgeschossausbau,<br />
Zu- oder Anbau), ist für diese<br />
Beurteilung nicht ausschlaggebend. Das<br />
Gericht ist bei seiner Entscheidung auch<br />
nicht an etwaige Teilungsvorschläge der<br />
Miteigentümer gebunden.<br />
Für den Fall, dass die Nutzwert- bzw. Mindestanteile<br />
von den bisherigen Miteigentumsanteilen<br />
abweichen, lässt die Rechtsprechung<br />
zu, dass solche Abweichungen<br />
durch Zahlungen ausgeglichen werden.<br />
Sind für diesen Wertausgleich jedoch unverhältnismäßig<br />
hohe Zahlungen erforderlich,<br />
wird die Teilung der Liegenschaft<br />
durch Begründung von Wohnungseigentum<br />
von der Rechtsprechung wiederum als<br />
unzulässig erachtet. Gleiches gilt für den<br />
Fall, dass die Realteilung unverhältnismäßig<br />
hohe Umbau- oder Teilungskosten voraussetzt.<br />
Der Oberste Gerichtshof hat etwa<br />
schon eine erforderliche Ausgleichszahlung<br />
in Höhe von 9,55 % des Verkehrswertes der<br />
Liegenschaft als unverhältnismäßig hoch<br />
angesehen und daher die Teilung durch<br />
Wohnungseigentumsbegründung abgelehnt.<br />
Eine erforderliche Ausgleichszahlung<br />
hindert die Wohnungseigentumsbegründung<br />
jedoch nicht, wenn der von der Anteilsminderung<br />
betroffene Miteigentümer<br />
auf die Ausgleichszahlung verzichtet und<br />
mit der Verminderung seines Anteils einverstanden<br />
ist.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
| BA12-16G |<br />
Bau & Recht<br />
Facility Manager.<br />
Eine Steuerung für alle Gewerke:<br />
Gebäudeautomation von Beckhoff.<br />
Die Frage der Tunlichkeit der Begründung von Wohnungseigentum<br />
ist durch einen Vergleich des Verkehrswertes<br />
der Liegenschaft vor der Begründung<br />
von Wohnungseigentum mit jenem nach der Begründung<br />
von Wohnungseigentum zu beantworten. Auch<br />
bei daraus resultierenden Wertschwankungen lässt<br />
die Rechtsprechung im Interesse der Begründung<br />
von Wohnungseigentum einen Wertausgleich in Geld<br />
zu, wiederum vorausgesetzt, dass es sich dabei nicht<br />
um unverhältnismäßig hohe Zahlungen handelt.<br />
Voraussetzung für die Begründung von Wohnungseigentum<br />
ist unter anderem ein Nutzwertgutachten<br />
und ein Gutachten über den Bestand an wohnungseigentumstauglichen<br />
Objekten. Die Nutzwertermittlung<br />
sowie die Erstellung der Gutachten erfolgt<br />
durch einen für den Hochbau zuständigen Ziviltechniker<br />
oder einen allgemein beeideten und gerichtlich<br />
zertifizierten Sachverständigen für das Hochbauoder<br />
Immobilienwesen. Das Gericht hat im Falle einer<br />
auf Wohnungseigentumsbegründung ausgerichteten<br />
Teilungsklage – aufgrund meist fehlender eigener<br />
Fachkenntnis – einen Sachverständigen aus dem<br />
Bereich Hochbau und/oder Immobilienwesen oder<br />
einen Ziviltechniker mit der Nutzwertermittlung und<br />
der Beurteilung der faktischen Möglichkeit und Tunlichkeit<br />
der Begründung von Wohnungseigentum zu<br />
beauftragen.<br />
Es liegt daher vielfach am Fingerspitzengefühl des<br />
involvierten Sachverständigen oder Ziviltechnikers,<br />
im Rahmen der technischen Schwankungsbreiten<br />
bei der Ermittlung der Nutzwerte und Verkehrswerte<br />
einer Liegenschaft ein für alle Miteigentümer möglichst<br />
ausgewogenes Ergebnis zu erzielen, wobei<br />
insbesondere der sich ständig weiter entwickelnden<br />
Rechtsprechung Rechnung zu tragen ist.<br />
Auch wenn die Teilung durch Begründung von Wohnungseigentum<br />
ein durchaus probates Mittel zur<br />
Verhinderung einer Zivilteilung und damit verbundenen<br />
Liegenschaftsveräußerung darstellen kann, ist<br />
zu beachten, dass sich ein Rechtsstreit über die Teilung<br />
einer Liegenschaft durch Begründung von Wohnungseigentum<br />
daher als ein riskanter – auch für<br />
den jeweiligen Sachverständigen bzw. Ziviltechniker<br />
haftungsträchtiger – Ritt auf der Rasierklinge erweisen<br />
kann, wenn die Aufteilung der Liegenschaft bzw.<br />
der einzelnen Wohnungseigentumsobjekte nicht einwandfrei<br />
und nicht ohne Wertverlust möglich ist.<br />
www.beckhoff.at/building<br />
Das ganze Gebäude zukunftssicher im Griff: Mit der integralen<br />
Gebäudeautomation von Beckhoff implementieren Sie eine PC-basierte<br />
Steuerungslösung, mit der Sie heute schon an den nachhaltigen<br />
Betrieb von morgen denken. Alle Gewerke der TGA werden von einer<br />
einheitlichen Hard- und Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob<br />
es um die nutzungsgerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation<br />
oder die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Die Steuerungslösung<br />
besteht aus leistungsstarken Industrie-PCs, Busklemmen zur<br />
Anbindung aller Datenpunkte und Subsysteme sowie der Automatisierungssoftware<br />
TwinCAT. Für alle Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine<br />
zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen.<br />
Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. Die<br />
Systemintegration erfolgt über die gängigen Kommunikationsstandards<br />
Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder Modbus TCP.<br />
Skalierbare Steuerungstechnik –<br />
von der ARM-CPU bis zur<br />
x86-CPU mit 2,3 GHz auf 4 Cores<br />
Embedded-PCs<br />
(ARM)<br />
Embedded-PCs<br />
(x86)<br />
Industrie-PCs<br />
(x86)
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
56<br />
Pocket-Parks<br />
Grüne Stadtoasen<br />
Das Sprießen der Pocket-Parks<br />
Brachflächen verwandeln sich in üppige Gemüsegärten, verlassene Hinterhöfe werden<br />
zu grünen Oasen, Parkbuchten laden zum Verweilen auf buntem Stadtmobiliar<br />
ein und aus jeder noch so kleinen nicht asphaltierten Stelle am Gehwegrand sprießen<br />
Blumen und Kräuter. Die Sehnsucht nach dem eigenen Fleckchen Erde ist bei<br />
den Städtern so groß wie nie. Dabei muss es nicht immer der Schrebergarten sein,<br />
unzählige Initiativen bieten den interessierten Bürgern mittlerweile die Beteiligung<br />
an gemeinnützigen grünen Projekten. Und wer nur zwischen den Beeten flanieren<br />
oder bei einem gemütlichen Bier Lärm und Hektik der Stadt entfliehen möchte, auch<br />
der ist herzlich willkommen.<br />
Text: Linda Pezzei<br />
Ob Wien, Berlin, Prag, London, Melbourne<br />
oder New York, egal in welche Metropole<br />
man dieser Tage blickt: Es grünt so grün.<br />
Das liegt zum einen an dem kommunalen<br />
Engagement der Städte- und Landschaftsplaner,<br />
zum anderen an einer Vielzahl gemeinnütziger<br />
Initiativen der Stadtbewohner<br />
selbst. Neben offiziellen Park- und Grünflächen<br />
werden immer mehr Brach- und<br />
Freiflächen zur (zwischengenutzten) Spielwiese<br />
der ambitionierten Freizeitgärtner.<br />
Solche ehemals „toten“ Räume werden als<br />
Pocket-Parks, also Westentaschen-Parks,<br />
bezeichnet. Je nach Flächenangebot und<br />
Umgebung variiert auch die Nutzung. Ob<br />
Spielfläche, Aufenthaltsraum, Nutz- oder<br />
Ziergarten – die liebevoll gestalteten Grünflächen<br />
werten unsere Stadtbilder zum<br />
Wohle aller nachhaltig auf.<br />
Im Zuge der stetigen Verdichtung in den<br />
städtischen Bereichen wird der Wert von<br />
Raum an sich immer mehr anerkannt. Aber<br />
auch die Nutzung des vorhandenen Raums<br />
zum Wohle aller spielt eine immer größere<br />
Rolle. Denn Freiräume bauen Barrieren<br />
ab, vernetzen Menschen unabhängig von<br />
gesellschaftlichen Schichten, werten die<br />
Nachbarschaft auf, bieten aber auch Raum<br />
zur persönlichen Entfaltung und Erholung.<br />
Was einst als Guerilla Gardening bezeichnet<br />
wurde, macht heute auch bei den Überlegungen<br />
von Städteplanern und Investoren<br />
Schule. Denn schon mit geringem finanziellen<br />
Aufwand lassen sich beträchtliche Ergebnisse<br />
erzielen.<br />
Gemeinschaftlicher Selbstbau der sogenannten Laube in den Prinzessinnengärten<br />
in Berlin. Dort finden Workshops und Events statt.<br />
© Marco Clausen
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
57<br />
Pocket-Parks<br />
Ein bekanntes und etabliertes Projekt<br />
stellen die Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg<br />
dar. 2009, lange bevor die<br />
Gegend um den Moritzplatz zu boomen begann,<br />
verwandelte das Kollektiv Nomadisch<br />
Grün gemeinsam mit Freunden, Aktivisten<br />
und Nachbarn eine bis dahin über ein halbes<br />
Jahrhundert lang verwilderte 6.000 m 2<br />
große Brachfläche in eine für alle offene<br />
Stadtoase. Seitdem sprießen biologisch<br />
angebaute Kräuter und Gemüse in den<br />
selbst gebauten Beeten, Bänke laden zum<br />
Verweilen ein und man verkauft Getränke<br />
und kleine Gerichte aus Zutaten, die der<br />
Garten bietet. Mit der „Laube“ setzten die<br />
Macher zudem ein architektonisches Statement.<br />
In dem Selbstbau finden Workshops,<br />
Versammlungen oder spontane Aktionen<br />
statt. „Bio ist in Deutschland immer noch<br />
ein Thema bessergestellter bürgerlicher<br />
Milieus und immer noch mit teurerem Essen<br />
konnotiert. Wir versuchen zu zeigen,<br />
dass sich das Soziale und das Ökologische<br />
nicht auseinanderdividieren lassen, dass<br />
unsere Lebensverhältnisse auch von unserem<br />
Verhältnis zur Natur abhängen,“ bringt<br />
Marco Clausen, einer der Initiatoren, die<br />
Wichtigkeit solcher Projekte auf den Punkt.<br />
Mittlerweile gibt es allein in Berlin mehr als<br />
113 dieser Gemeinschaftsgärten.<br />
Prinzessinnengärten in Berlin<br />
© Marco Clausen<br />
Prinzessinnengärten in Berlin<br />
© Christian Burkhard<br />
An der Entstehung des Gemeinschaftsgartens Prazelenina in Prag wirkten<br />
gerade die Nachbarn und zukünftigen Nutzer tatkräftig und maßgeblich mit.<br />
© Ondřej Štindl, Prazelenina<br />
Ein ähnliches Projekt ist der Prazelenina<br />
Gemeinschaftsgarten im hippen Prager<br />
Stadtteil Holešovice. Seit 2012 treffen sich<br />
auf der ehemaligen Gewerbefläche Bürger<br />
aller Schichten zum gemeinsamen Gärtnern.<br />
„Lasst uns, anstatt passive Kritik zu üben an<br />
der großen weiten Welt, aktiv in den Ereignissen<br />
um uns herum sein“ – lautet das Credo<br />
der Gründer. Auch bei diesem Leuchtturmprojekt<br />
geht es um das Verständnis für<br />
eine regionale und nachhaltige Anbauweise,<br />
um soziokulturelle Interaktionen und um einen<br />
besseren Klimaschutz durch die Reduktion<br />
von CO 2 . Neben dem Gartenbaukonzept<br />
versteht sich der Prazelenina aber auch als<br />
Treffpunkt der Nachbarschaft, was sich in<br />
dem bunten Veranstaltungsprogramm widerspiegelt,<br />
das Konzerte, Filmvorführungen<br />
unter freiem Himmel, Events für Kinder<br />
und Flohmärkte umfasst.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
58<br />
Pocket-Parks<br />
Die Grätzloase PartyZipation lädt Jung und Alt unter dem Motto “Nimm Platz & erlebe<br />
deine Stadt” zum gemeinsamen Nutzen und Erleben des öffentlichen Raumes ein.<br />
© Daniel Auer<br />
Auch in Wien tut sich in diesem Bereich<br />
eine ganze Menge. Hier sorgen sogenannte<br />
Parklets für gute Laune. Ehemalige Parkflächen<br />
werden in diesem Zusammenhang<br />
durch temporäre Stadtmöbel zu Aufenthaltsorten<br />
für Anwohner und Passanten.<br />
Die Parkbank mit Mehrwert könnte man sagen.<br />
Die einzelnen Installationen umfassen<br />
Sitzgelegenheiten, Pflanzen, Beleuchtung,<br />
Regenschutz oder Fahrradabstellmöglichkeiten.<br />
Die Initiative CityMaking!Wien zeigt<br />
interessierten Bürgern auf einer Onlinekarte,<br />
wo potenzielle Parklets entstehen könnten<br />
und animiert zur Einreichung eigener<br />
Ideen. „Wir würden gerne neue Dynamiken<br />
in der Stadt auslösen, indem die Bürger<br />
einfach und kurzfristig öffentliche Räume<br />
„buchen“ können. Das würde eine dynamische<br />
Mitgestaltung der Stadt ermöglichen,<br />
die sich stark von den modernen Top-down<br />
Planungsmethoden unterscheidet,“ ist sich<br />
der Projektgründer Juan Carlos Carvajal<br />
Bermúdez sicher.<br />
Seit 2015 unterstützen die Stadt Wien und<br />
der Verein Lokale Agenda 21 Wien das Aktionsprogramm<br />
Grätzloase, das Gruppen,<br />
Vereine, Schulen, lokale Unternehmen oder<br />
Einzelpersonen dazu auffordert, Ideen zur<br />
Belebung des öffentlichen Freiraums einzureichen.<br />
In den vergangenen vier Jahren<br />
konnten so bereits 215 Aktionen (davon<br />
89 Parklets) umgesetzt werden. Das Aktionsprogramm<br />
unterstützt in diesem Zusammenhang<br />
bei der Organisation der Bewilligungen,<br />
bietet fachliche Beratung und<br />
gewisse Finanzierungen.<br />
„Viele Wienerinnen und Wiener haben ganz<br />
konkrete Ideen, wie ihr Grätzl schöner und<br />
belebter werden kann. Dieses enorme kreative<br />
Potential wird mit der Aktion Grätzloase<br />
unterstützt. Interessierte in ganz Wien werden<br />
selbst aktiv und setzen ihre Ideen im<br />
öffentlichen Raum um. Dabei werden BürgerInnen<br />
zu Machern und Macherinnen und<br />
bereichern das Leben in ihrer unmittelbaren<br />
Nachbarschaft,“ bringt Maria Vassilakou,<br />
Vizebürgermeisterin der Stadt Wien, den<br />
Grundgedanken der Initiative auf den Punkt.<br />
© Juan Carlos Carvajal Bermúdez © Juan Carlos Carvajal Bermúdez
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
59<br />
Pocket-Parks<br />
Die Vielzahl an bereits realisierten Projekten<br />
zeigt ganz deutlich, dass die Bürger<br />
durchaus interessiert sind an der Mitgestaltung<br />
der Architektur ihrer Umwelt und sich<br />
mit vielen kreativen Ideen ehrenamtlich in<br />
einen aktiven Gestaltungsprozess mit einbringen<br />
möchten.<br />
Um es mit den Worten von Marco Clausen<br />
auf den Punkt zu bringen: „Wir können die<br />
Welt mit diesen kleinen Eingriffen nicht ändern,<br />
aber wir können die Perspektive der<br />
Menschen verschieben, indem sie am eigenen<br />
Leib erfahren, dass es Orte gibt, die<br />
anders sind und trotzdem funktionieren.<br />
Die Kraft dieser Orte besteht darin, infrage<br />
zu stellen, was uns beständig als alternativlos<br />
präsentiert wird. Sobald die Menschen<br />
erfahren, dass es auch anders geht, ändert<br />
sich ihr Blick auf das Mögliche.“<br />
© Daniel Auer<br />
© Juan Carlos Carvajal Bermúdez<br />
© Christian Fürthner/MA 21<br />
© Ines Ingerle/Radlobby<br />
© Stadtfein<br />
© Tehilla Gitterle<br />
© Juan Carlos Carvajal Bermúdez
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
60<br />
Grüne Architektur<br />
Grüne<br />
Architektur<br />
Veranstaltungen wie „Houston, we have a problem. Ökologie und Verantwortung“<br />
im DAZ letzten Jahres, oder „Anthropozänkitsch: Architektur als Ersatzhandlung“<br />
in der Gesprächsreihe „Wir müssen reden!“ zeigen, dass Handlungsbedarf besteht.<br />
Selbst wenn noch ein unbelehrbarer, westlicher Präsident den Klimawandel leugnet.<br />
Doch wir sollten mehr tun als nur reden!<br />
Text: Peter Reischer<br />
Nachhaltiges Bauen ist mehr als ein kurzfristiger<br />
Trend: Das Berücksichtigen von<br />
ökologischen, ökonomischen und sozialen<br />
Faktoren beeinflusst heute maßgeblich<br />
die Form und Funktion von Gebäuden. Die<br />
Nutzung erneuerbarer Energien, die Verwendung<br />
regenerativer und nachhaltiger<br />
Materialien oder flächensparendes Bauen<br />
sind Planungsansätze für eine zeitgemäße,<br />
nachhaltige Architektur. Grüne Architektur<br />
hat aber viele Gesichter – nicht nur<br />
die einer architektonisch gebauten Substanz<br />
– und „Green Building“ ist, durch die<br />
sich immer deutlicher abzeichnenden Auswirkungen<br />
des Klimawandels, unter Architekten,<br />
Projektentwicklern und Investoren<br />
zum geflügelten Wort geworden. Alles was<br />
nachhaltig, ökologisch oder energiesparend<br />
aussieht und den allgemeingültigen<br />
Standards für umweltfreundliche Architektur<br />
entspricht, wird unter dem Oberbegriff<br />
der „grünen Architektur“ zusammengefasst<br />
und vermarktet. Damit stellt sich auch die<br />
Frage, ob das ein neues Geschäftsmodell<br />
darstellt und ob das (moralisch) gut ist. Offenbar<br />
kann mit der Rettung unserer Umwelt<br />
Profit gemacht werden, eine wahrlich<br />
schizophrene Haltung, wenn gleichzeitig<br />
immer lamentiert wird, dass die Reduktion<br />
des CO 2 -Ausstoßes, die nachhaltige Sanierung<br />
von Gebäuden, die Verwendung<br />
schadstofffreier und „fairer“ Materialien zu<br />
viele Milliarden koste. Scheitert die Rettung<br />
unseres Planeten am Geldmangel?<br />
Auch die EU hat den Begriff „Grüne Architektur“<br />
in ihrem Programm, dabei handelt es<br />
sich allerdings um rein landwirtschaftsbezogene<br />
Agenden der Gemeinsamen Agrarpolitik<br />
(GAP). Jedoch gehen EU-weit wöchent-<br />
lich am Freitag (Fridays for Future) Schüler<br />
mittlerweile auf die Straße und demonstrieren<br />
für den Klimaschutz. Die Initiatorin dieser<br />
Proteste, die 16-jährige Greta Thunberg<br />
war auch schon in Wien und hat zusammen<br />
mit Terminator Arnold Schwarzenegger<br />
auf dem R20 Austrian World Summit gesprochen.<br />
Aber was werden die Politiker,<br />
Behörden und Wirtschaftstreibenden unternehmen,<br />
wann werden sie reagieren? Wie<br />
weit werden oder sollen sie die Architektur,<br />
die ja einen großen Anteil am weltweiten<br />
CO 2 -Ausstoß hat, in die Pflicht nehmen?<br />
Genügt es denn, Bauordnungen, Standards<br />
und Normen zu erfüllen und nach Zertifikaten<br />
zu streben und wie sieht eine Architektur<br />
aus, die ein Wohnen, ein Benutzen<br />
im Gleichgewicht mit der Umwelt zulässt?<br />
Initiativen wie Pocket-Parks, Parklets, Urban<br />
Gardening, Vertical Farming und viele<br />
andere auch, zählen eindeutig zur „Grünen<br />
Architektur“, vor allem mit ihrem Anspruch,<br />
die Welt ein Stückchen besser zu gestalten<br />
und die Umwelt zu schonen (siehe auch andere<br />
Berichte in dieser <strong>Ausgabe</strong>).<br />
Den Trend zur Grünen Architektur versinnbildlichte<br />
in Europa lange Zeit vor allem das<br />
Projekt Bosco Verticale vom Architekturbüro<br />
Boeri Studio und dem Bauherrn Manfredi<br />
Catella. Auf zwei Hochhäusern wachsen<br />
dort ebenso viele Bäume wie auf einer<br />
Waldfläche von 10.000 Quadratmetern –<br />
800 Stück sind es. Jedoch bereits zwei<br />
Jahre früher, 2012 wurde mit dem Projekt<br />
„25 Verde“ eine Zukunftsvision von grüner<br />
Architektur Wirklichkeit. Entworfen wurde<br />
Caixa Forum Madrid<br />
© Cillas
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
61<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Casa Ojalá<br />
© Architect Beatrice bonzanigo, IB Studio<br />
sie vom italienischen Architekten Luciano<br />
Pia und dieses Projekt stellen wir in einem<br />
eigenen Bericht (Seite 80) vor.<br />
Grüne Architektur meint sicher nicht nur<br />
begrünte Architektur (obwohl natürlich<br />
auch diese), auch nicht nur sogenannte<br />
nachhaltige oder (energie)effiziente Architektur.<br />
Vielmehr soll damit die Frage diskutiert<br />
werden, ob und wie weit Architektur<br />
zur Rettung der (noch) grünen Umwelt, Natur<br />
und unseres ganzen Planeten beitragen<br />
kann. Denn nicht alles, was vielleicht danach<br />
aussieht, ist wirklich gut für Mensch<br />
und Umwelt. So haben sich schon manche<br />
hoch zertifizierte Projekte als Etikettenschwindel<br />
herausgestellt, während umgekehrt<br />
Gebäude, die recht konventionell wirken<br />
(Alnatura Arbeitswelt Seite 86), höchst<br />
effizient im Ressourcenverbrauch sind und<br />
obendrein von einer hohen Lebensqualität<br />
und nachhaltiger Bauweise zeugen.<br />
Es gibt mittlerweile jede Menge von innovativen<br />
und wirklich guten Ideen für umweltverträgliche<br />
Architekturen. Viele davon<br />
sind zwar als Einzelideen gut, aber in der<br />
Masse – also bei Einbeziehung der demografischen<br />
Veränderung und dem Wachsen<br />
der Städte zum Beispiel – nicht durchdacht.<br />
Daran kann man erkennen, dass das<br />
Bewusstsein für die Notwendigkeit eines<br />
sofortigen Handelns auch im Bereich der<br />
Architektur, noch nicht in die Köpfe der<br />
Menschen eingedrungen ist. Psychologen<br />
erklären das mit dem Mechanismus, zu bedrohliche<br />
Szenarien auszublenden und zu<br />
verdrängen. Aber auch mit dem Gefühl der<br />
Ohnmacht des Einzelnen.<br />
Naturnah zeigt sich etwa die mobile Mini<strong>architektur</strong><br />
„Casa Ojalá“ der italienischen<br />
Architektin Beatrice Bonzanigo vom Mailänder<br />
IB Studio. Ihre Idee wurde auf der<br />
Milan Design Week <strong>2019</strong> als 1:10-Modell<br />
präsentiert. Auf 27 Quadratmetern hat sie<br />
alles, was für eine moderne Herberge benötigt<br />
wird, untergebracht. Der Bau enthält<br />
verschiedenste Variationsmöglichkeiten<br />
zur individuellen Auswahl. Sein runder<br />
Grundriss fasst zwei Schlafzimmer, eines<br />
mit Doppelbett, eines mit Einzelbett, ein Badezimmer,<br />
eine Terrasse, eine Küchenzeile<br />
und ein Wohnzimmer. Ermöglicht wird diese<br />
Grundrissflexibilität durch ein manuell zu<br />
bedienendes System aus Seilen, Rollen und<br />
Kurbeln, mittels derer man das Haus den<br />
gewünschten Bedingungen anpassen kann.<br />
Schiebewände aus zwei verschiedenen Materialien<br />
– zum einen aus Stoff, zum anderen<br />
aus Holz – unterteilen den Raum dieser<br />
off-the-grid-Wohnmöglichkeit variabel.<br />
Ausgangspunkt der Idee war auch, wie man<br />
mit größtmöglicher Mobilität leben und in<br />
Architektur wohnen kann. Durch die freie<br />
Wahl des Aufstellungsortes (totale Unabhängigkeit)<br />
ist diese Mobilität natürlich<br />
gegeben – aber auch ein typisches Beispiel<br />
einer neoliberalen Geisteshaltung. Müssen<br />
wir 100% mobil sein, was bedeutet das an<br />
Energie, wer kann sich das leisten? Als Tourismuskonzept<br />
für Luxusherbergen sicherlich<br />
geeignet, jedoch zur Lösung unserer<br />
Probleme trägt diese Idee nichts bei. Und<br />
ob das der richtige Weg ist, mit Ressourcen<br />
wie Landschaft, Architektur und Gemeinwohl<br />
umzugehen, ist eine andere Frage. u<br />
Casa Ojalá<br />
© Architect Beatrice bonzanigo, IB Studio
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
62<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Gardens by the Bay von Grant Associates in Singapur<br />
Überall planen Architekten grüne Gebäude,<br />
vor allem in den urbanen Ballungszentren.<br />
Mit Pflanzen an Fassaden, auf Terrassen,<br />
Balkonen und Dächern. Denn eine begrünte<br />
Fassade reduziert die Hitze, wirkt auch<br />
gegen städtische Hitzeinseln. Pflanzen sind<br />
der natürlichste Schutz vor Sonneneinstrahlung<br />
und außerdem produzieren sie<br />
Sauerstoff.<br />
Singapur versteht sich als „Stadt in einem<br />
Garten“ und aus diesem Grund haben Architekturbüros<br />
schon vor vielen Jahren<br />
– als man in Europa noch kaum daran gedacht<br />
hat – begonnen, die Stadt grün zu gestalten.<br />
Pflanzen sollten möglichst in jedes<br />
Gebäude integriert werden. Mit dem Bauen<br />
in die Höhe wächst auch das Grün mit in die<br />
Höhe. Neun Prozent der Landfläche Singapurs<br />
wurden für Parks und Naturreservate<br />
frei gehalten. Nach und nach werden diese<br />
Gebiete miteinander verbunden, damit die<br />
Leute überall in der Stadt im Grünen spazieren<br />
gehen, joggen und Fahrrad fahren<br />
können. Singapur ist die grünste Stadt Asiens<br />
– und hat das ehrgeizige Ziel, die grünste<br />
Stadt der Welt zu werden.<br />
In Singapur findet man auch ungewöhnlich<br />
viele, wie mit einer zotteligen Perücke überzogene<br />
Bauten – sie stammen meist vom<br />
Architekturbüro WOHA (Wong Mun Summ<br />
und Richard Hassell). Diese Architekten<br />
setzen neben auskragenden Fassadenelementen<br />
vor allem Pflanzen ein. Dabei geht<br />
es ihnen nicht um Dachgärten, die wie ein<br />
grüner Deckel dekorativ obenauf sitzen,<br />
sondern um kühlende Begrünungen und<br />
Berankungen, die Teil der Gebäudestruktur<br />
und -technik sind. Diese WOHA-Bauten lösen<br />
sich nicht nur nach außen hin auf. Sie<br />
sind auch im Inneren porös. Offene, luftige<br />
Strukturen aus vielen schmalen Türmen,<br />
offene Gänge, brücken- und balkonartige<br />
Terrassen und in luftiger Höhe eingezogene,<br />
sogenannte Sky Gardens machen aus<br />
massiven Blöcken locker verhäkelte, winddurchlässige<br />
und weitgehend natürlich gekühlte<br />
Komplexe. So sind sie ganz anders<br />
als der sonst in Südostasien dominierende<br />
Wohnblocktyp, der undurchlässig gegenüber<br />
Wind und Wetter ist und künstlich klimatisiert<br />
werden muss.<br />
Die „School of the Arts“ zum Beispiel, ist<br />
eine Windmaschine, ebenfalls entworfen von<br />
WOHA. Sie ist derart gestaltet, dass die leichten<br />
Brisen, welche die Stadt durchziehen, in<br />
der Architektur kanalisiert und intensiviert<br />
werden. Die Luftdurchzugskorridore in ihrem<br />
Inneren bieten eine angenehme, komfortable<br />
Atmosphäre und auch Interaktionsraum<br />
für die Nutzer. Das Design zur Windführung<br />
und -leitung hat sich als sehr wirkungsvoll<br />
erwiesen und sorgt für eine ständige Kühlung<br />
im tropischen Klima der Stadt mit ihrer,<br />
fast immer 100%igen Luftfeuchtigkeit<br />
im Außenraum. Die Dachfläche ist als ein<br />
großer Erholungspark gestaltet und enthält<br />
auch eine 400 Meter lange Laufstrecke. Der<br />
Bau wurde bereits 2007 begonnen und 2010<br />
größtenteils fertiggestellt.<br />
Der spezifisch tropische Hochhausbau des<br />
Singapurer Büros orientiert sich an traditionellen<br />
Wohnformen Südostasiens: An den<br />
Kampongs genannten Dörfern, in denen<br />
Bäume und große Dächer pavillonartigen<br />
Bauten Schatten spenden, während Wände<br />
aus mobilen, durchlässigen Paneelen und<br />
spezielle Korridore jeden leichten Luftzug<br />
weiterleiten und intensivieren. Einige dieser,<br />
sogenannten passiven Ansätze für grüne<br />
Architektur sind so alt wie die Geschichte<br />
der Architektur selbst, andere basieren<br />
auf allerneuesten „grünen“ Technologien.<br />
Der amerikanische Architekturkenner Philip<br />
Jodidio beschreibt in dem Doppelband<br />
„100 Contemporary Green Buildings“ viele<br />
visionäre, aber auch gebaute Entwürfe, die<br />
sich des Einsatzes „grüner“ Technologie<br />
bedienen. Er merkt aber auch nachdenklich<br />
an, dass die Nebenwirkungen dieser<br />
neuen Technologie und der eingesetzten<br />
Produkte nicht endgültig geklärt sind und<br />
aufgrund erheblicher Profite vielleicht nie<br />
geklärt werden können/sollen. Es ist eine<br />
Tatsache, dass Solarzellen Schwermetalle<br />
enthalten und auch die Herstellung von<br />
Biozement enorme Ressourcen verschlingt.<br />
Ebenso meint er, dass es schon bemerkenswert<br />
sei, dass heute wieder Architekten historische<br />
Rückbezüge wagen und manchmal<br />
in die Vergangenheit blicken. Wenn Gropius<br />
von der Tabula rasa sprach, ist diese<br />
Einstellung heute eindeutig überholt. Dass<br />
die Baukunst heute wieder auf Jahrtausende<br />
alte Weisheiten zurückgreift, ist ein Befreiungsschlag<br />
vom Diktat der Technik und<br />
wird dem Begriff und der Verbreitung der<br />
Nachhaltigkeit und einer „Grünen Architektur“<br />
sicherlich förderlich sein.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
63<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
School of the Arts
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
64<br />
Grüne Architektur<br />
Einen Vorschlag zum Neuaufbau<br />
des durch ein Feuer zerstörten<br />
Daches der Notre-Dame, der<br />
gleichzeitig eine nachahmende<br />
oder museumsähnliche Architektur<br />
vermeiden soll, hat Vincent<br />
Callebaut entwickelt. Er birgt<br />
neben ästhetischer Architektur<br />
auch einen Weg zur Erhaltung<br />
von Biodiversität, Urban Farming,<br />
Nachhaltigkeit, Soziales und eine<br />
spirituelle Komponente.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
65<br />
Vincent Callebaut Architectures<br />
Ein<br />
biomimetischer<br />
Wald<br />
Palingenesis / Paris / Vincent Callebaut Architectures<br />
Renderings: Vincent Callebaut Architectures
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
66<br />
Grüne Architektur<br />
Am 15. April <strong>2019</strong> erlebten die Pariser Bürger eine<br />
Katastrophe und die Kathedrale Notre-Dame, die seit<br />
Jahrhunderten über die christliche und westliche<br />
Kultur gewacht hatte, beinahe ihr Ende. Ein Feuer<br />
zerstörte das Dach über dem Hauptschiff, ein Teil der<br />
Gewölbe stürzte sogar ein. Das Feuer war noch kaum<br />
gelöscht, begannen schon einige Architekten und<br />
Büros mit der medialen Publikation von Vorschlägen<br />
für den Wiederaufbau.<br />
Die verschiedensten Visionen tauchten auf, von einem<br />
Penthouse für Quasimodo, einem mehrgeschossigen<br />
Parkhaus, einer McDonald´s Filiale bis zum<br />
Schwimmbecken auf dem Dach der ehrwürdigen<br />
Dame reichten sie. Stahl und Glas waren die bevorzugten<br />
Baumaterialien der eingereichten Entwürfe.<br />
Der französische Senat allerdings ließ verlauten,<br />
dass die Notre-Dame in ihrem „zuletzt bekannten<br />
Zustand wieder aufgebaut werden müsse“. Man wird<br />
also sehen, ob sich Denkmalschützer, Konservative<br />
und Utopisten auf einen Nenner einigen können.<br />
Ein Vorschlag kam auch von dem – für seine utopischen<br />
und grünen Visionen bekannten – Architekten<br />
Vincent Callebaut. Seine Vision liegt auf jeden Fall<br />
im Trend: Der Projektname „Palingenesis“ steht in<br />
diesem Zusammenhang für Wiedergeburt, Wiedererschaffung<br />
nach einer Katastrophe und würde es also<br />
den Bewahrern recht machen. Seine Idee, das Dach<br />
der Kathedrale mit einem naturähnlichen Wald zu<br />
bepflanzen entspricht den derzeitigen Bemühungen<br />
um „grüne Architektur“. Die momentane Identifikationskrise<br />
der Kirche und die Klimakrise verlangen beide<br />
nach Reaktionen, die in diesem Fall eine direkte<br />
Folge der derzeitigen Herausforderungen sein können.<br />
Die Kirche muss sich genauso wie die Architektur<br />
neu positionieren, es kann nicht so weiter gehen<br />
wie gehabt.<br />
Callebaut trachtet nun in seinem Vorschlag der Rekonstruktion<br />
der Notre-Dame sowohl Fragen der<br />
menschlichen Intelligenz, der zeitgenössischen<br />
Geschichte aber auch die der Wissenschaft, Kunst,<br />
Transzendenz und Spiritualität zu vereinen. Sein Projekt<br />
vertritt die Symbolik einer Resilienz und einer<br />
ökologischen Zukunft in der Stadt. Er verordnet Paris<br />
sozusagen einen Cocktail aus Biomimetik und Biomimicry,<br />
der sich hier als allgemeine Ethik für eine faire,<br />
symbiotische Beziehung zwischen Mensch, Stadt<br />
und Natur offenbart.<br />
Ein aus Ökoressourcen entstehender neuer Turm, als<br />
Beispiel einer spirituellen Anbetung, versucht sich<br />
mit dem ehrwürdigen, steinernen Kirchenschiff zu<br />
verbinden, sich mit ihm wie ein vegetativer Baumsteckling<br />
zu verschmelzen. Eine einzige gebogene<br />
Kurve soll alles zu einer Einheit zusammenfassen –<br />
Dach und Turm. Von den vier Giebelwänden ausgehend<br />
gleicht sich die Konstruktion an die ehemalige<br />
Höhe an und steigt gegen den Vierungspunkt dann<br />
in einem 55-Grad-Winkel an, um den zentralen Turm<br />
zu bilden. Auf diese Weise werden die vorgegebenen<br />
Prinzipien der Lastabtragung des Bauwerks auf die<br />
Strebebögen und die innen liegenden Pfeiler eingehalten<br />
und die vier Dachlinien der Firste vereinen<br />
sich in einem eleganten, parametrischen, gegen den<br />
Himmel ragenden Turm in einer leichten Geometrie.<br />
Die Konstruktion soll aus kreuzweise verleimten<br />
Holzbalken, die mittels Glasfaserstäben vorgespannt<br />
sind, errichtet werden. Das neue Rahmenwerk aus Eiche<br />
versucht, mit einem minimalen Materialaufwand<br />
auszukommen, um den ökologischen Fußabdruck so<br />
gering wie möglich zu halten und gleichzeitig eine<br />
größtmögliche Transparenz für die Kathedrale zu<br />
generieren. Diese Durchlässigkeit, das Teilen und die<br />
Öffnung zur Gesellschaft sind die grundlegenden Entwurfskriterien<br />
für diesen diaphanen Wald auf der Notre-Dame<br />
– sie sollen auch das neue Erscheinungsbild<br />
der Kirche im 21. Jahrhundert ausmachen. u<br />
Ulf Mejergren Arkitekter<br />
Swimmingpool auf der Notre-Dame<br />
whocaresdesign<br />
Penthouse für Quasimodo
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
67<br />
Vincent Callebaut Architectures<br />
David Deroo<br />
Parametrischer Wiederaufbau<br />
Studio NAB<br />
Bienenstöcke im Turm<br />
© www.bnutsvisual.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
68<br />
Grüne Architektur<br />
Die ephemere Konstruktion und die im Geviert<br />
eingesetzten Glasplatten schaffen zusätzliches<br />
Naturlicht in dem Innenraum der Kathedrale.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
69<br />
Vincent Callebaut Architectures<br />
Natürlich beinhaltet die Idee von Architekt Callebaut<br />
auch jede Menge Effizientes zum Thema Energie.<br />
Der Sprössling auf dem Dach soll dazu beitragen, die<br />
Notre-Dame in ein Gebäude zu verwandeln, das mehr<br />
Energie liefert, als sie selbst verbraucht. Durch eine<br />
energietechnische Verbindung mit dem historischen<br />
Körper der Architektur soll der dreidimensionale<br />
Glaskörper die gesamte Elektrizität, Wärme und passive<br />
Ventilation produzieren, die die Kathedrale für<br />
den Betrieb benötigt. Und zwar sowohl mittels passiver<br />
Systeme, wie auch durch die Benutzung erneuerbarer<br />
Energiequellen. Die Holzkonstruktion ist mit<br />
einer dreidimensionalen Glashülle versehen, diese<br />
teilt sich in diamantförmige Elemente. Diese Kristalle<br />
bestehen aus einer organisch aktiven Schicht aus<br />
Kohlenstoff, Hydrogen, Wasserstoff und Sauerstoff –<br />
sie absorbiert Licht und wandelt es in Energie um.<br />
Diese Energie soll in Wasserstoffzellen gespeichert<br />
und direkt an die Architektur zur Nutzung abgegeben<br />
werden.<br />
Um einen Glashauseffekt zu vermeiden sind diese<br />
kristallinen Einheiten (Trägerhüllen) am Boden entlang<br />
der Akroterien des Längs- und des Querschiffes<br />
offen – so erzeugen sie einen natürlichen Luftstrom in<br />
Richtung Turmspitze wie bei einem Windkamin. Diese<br />
natürliche Ventilation - sie funktioniert ähnlich, wie in<br />
einem Termitenbau - sorgt für eine exzellente Luftqualität<br />
im Inneren. Weiters stellt der Turm der Kathedrale<br />
in den Winterzeiten einen thermischen Pufferspeicher<br />
für die warme, aufsteigende Luft dar. Im Sommer dient<br />
er als Generator für frische und kühle Luft durch die<br />
Verdunstungsoberflächen der Pflanzen. So würde der<br />
Bau ein Musterbeispiel einer Öko-Ingenieurskunst und<br />
die Kirche gleichzeitig ein echter Pionier für eine umweltbezogene<br />
Resilienz werden.<br />
In seinem Zentrum stellt das Palingenesis-Projekt einen<br />
Garten, welcher der Kontemplation und Meditation<br />
gewidmet ist, dar. Der Garten hat aber nicht nur<br />
ästhetische, sondern auch ganz praktische Aspekte:<br />
Er soll von Freiwilligen und karitativen Organisationen<br />
betreut werden und den Obdachlosen und ärmsten<br />
Bevölkerungsschichten der Stadt Nahrung zur Verfügung<br />
stellen. Aquaponik und Permakulturen können<br />
bis zu 25 Kilo Früchte pro m 2 produzieren. Also wäre<br />
eine Ernte von bis zu 21 Tonnen Gemüse und Früchte<br />
pro Jahr auf dieser Fläche möglich. Ein Wochenmarkt<br />
könnte im Vorhof der Notre-Dame stattfinden und für<br />
die direkte Verteilung sorgen. Diese urbane Farm liegt<br />
über dem Kreuzungspunkt der Kirchenschiffe. Der<br />
geometrische Garten „à la française“ lässt Grünpflanzen<br />
entlang der Ost-West-Richtung wachsen und<br />
nord-süd-gerichtet sind die Fischteiche angeordnet.<br />
In deren Wasserfläche würden sich auch die Rosettenfenster<br />
der beiden Stirnseiten spiegeln.<br />
Die Öffnung in der Mitte des Gewölbes, die durch den<br />
teilweisen Einsturz während des Feuers entstand, will<br />
der Architekt mit Glas verschließen und so zusätzliches<br />
natürliches Licht in die Mystik des gotischen<br />
Innenraumes leiten. So soll eine Erinnerung an das<br />
schreckliche Feuer und gleichzeitig eine neue „göttliche“<br />
Atmosphäre entstehen.<br />
(rp)
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
70<br />
Grüne Architektur<br />
Grüner Flughafen<br />
Oxymoron oder Schritt in die richtige Richtung<br />
Oslo International Airport / Gardermoen / Nordic – Office of Architecture<br />
Fotos: Ivan Brodey, Dag Spant, Knut Ramstad
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
71<br />
Nordic – Office of Architecture<br />
Das Architekturbüro Nordic –<br />
Office of Architecture machte<br />
aus dem Lufthavn Oslo-Gardermoen<br />
in Norwegen im Zuge einer<br />
Sanierung und Erweiterung den<br />
grünsten Flughafen der Welt,<br />
ausgezeichnet mit dem BREEAM<br />
Nachhaltigkeitszertifikat. Sie renovierten<br />
den Bestandsbau effizient,<br />
hielten die Distanzen trotz<br />
Verdopplung der Nutzfläche<br />
minimal und halbierten gleichzeitig<br />
den Energieverbrauch.<br />
Es scheint wie ein Oxymoron, den Dreh- und Angelpunkt<br />
eines per se alles anderen als grünen Industriesektors,<br />
als grün zu bezeichnen. Die Rahmenbedingungen<br />
waren dem Architekturbüro aus Oslo bereits<br />
bestens bekannt, da sie doch schon den Wettbewerb<br />
zum Bau des Flughafens in den 1990er-Jahren gewonnen<br />
hatten. Nun konnten sie auch den aktuellen<br />
Wettbewerb zur Sanierung für sich entscheiden. Sie<br />
widmen sich dem kontroversen Thema mit einem<br />
Vorschlag, der behutsam an den Bestand anknüpft,<br />
dessen Design zeitgemäß interpretiert und auf innovative,<br />
nachhaltige Art und Weise weiterführt. Die<br />
Sanierung und Erweiterung umfasst 52.000 m 2 , der<br />
neue Trakt 63.000 m 2 . Damit steigert der Entwurf von<br />
Nordic – Office of Architecture die Passagierzahl von<br />
19 auf 30 Mio. jährlich und lässt Raum nach oben für<br />
zukünftiges Wachstum.<br />
Der Osloer Flughafen zeichnete sich bis dato vor<br />
allem durch sein kompaktes Layout aus. Diese Qualität<br />
sollte auch nach dem Umbau erhalten bleiben.<br />
Der rechteckige Grundriss des bestehenden Traktes<br />
erstreckt sich von Ost nach West. Während seine<br />
südliche Längsseite zur erschließenden Straße hin<br />
orientiert ist, reihen sich entlang der Nordfassade<br />
die Gates aneinander. Das Hauptgebäude wurde im<br />
Zuge der Erweiterung nach außen hin verlängert,<br />
verändert sich in seiner ursprünglichen Form sonst<br />
aber nicht. Den neuen Terminal dockten die Architekten<br />
direkt an den Bestand an. So gelingt es, die<br />
Wege, welche die Passagiere zurücklegen müssen,<br />
trotz doppelter Nutzfläche auf maximal 500 m zu begrenzen.<br />
Der neue, fingerförmige Trakt ist zentral an<br />
der Nordfront positioniert und scheint seine Fühler<br />
nach Norden auszustrecken. Er bietet auf drei Geschossen<br />
reichlich Platz für nationale und internationale<br />
Gates sowie die Gepäckausgabe. Das konische<br />
Volumen weitet sich im Bereich der Schnittstelle zum<br />
Hauptgebäude zu einer großen Ankunftshalle, in der<br />
sich die Bahnstation befindet.<br />
u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
72<br />
Grüne Architektur<br />
Durch Stapelung der<br />
Funktionen wird der Platz<br />
im 300 m langen Terminal<br />
optimal genutzt. Großflächige<br />
Verglasungen bringen<br />
viel Licht ins Innere<br />
und geben den Blick auf<br />
den Flugverkehr frei.<br />
In seiner architektonischen Sprache orientiert sich<br />
der neue Teil am Haupttrakt. Die Konstruktion beruht<br />
auf mächtigen Leimbindern, ergänzt durch Stahlbetonelemente.<br />
Diese tragen das gekrümmte Dach, das<br />
den 300 m langen Terminal überspannt, sowie das<br />
der mächtigen Ankunftshalle. In Letzterer bleibt die<br />
Holzstruktur von unten frei einsehbar. Großflächige<br />
Verglasungen formen die seitlichen Abschlüsse und<br />
das nördliche Ende der Röhre. Sie bringen viel Tageslicht<br />
nach innen und geben den Blick auf die ankommenden<br />
und abfliegenden Flugzeuge vor der Kulisse<br />
der rauen, norwegischen Landschaft frei.<br />
Auch im Inneren folgt der Trakt der Hierarchie des<br />
Bestands. Seine simple Form wirkt selbsterklärend<br />
und erleichtert Lesbarkeit und Orientierung. Die Intention<br />
der Architekten war es, die Wegführungen<br />
für die Passagiere auch ohne exzessive Beschilderung<br />
zu erschließen. Die Gestaltung der Innenräume<br />
ist geprägt von lokalen Materialien. Holzoberflächen<br />
und Marmorböden ergänzen grün bepflanzte Wände,<br />
Wasser und Steinelemente sorgen für einen Naturund<br />
Ortsbezug.<br />
Seine Kompaktheit macht den Lufthavn Oslo-Gardermoen<br />
um ein Vielfaches kosteneffizienter als<br />
vergleichbare Projekte. Bereits im Bau reduziert die<br />
Materialwahl den CO 2 -Verbrauch um 34%. Neben<br />
skandinavischer Eiche kommen norwegischer Marmor,<br />
recycelter Stahl und Vulkanasche als Betonzuschlag<br />
zum Einsatz. Dank eines optimierten Energiekonzepts<br />
auf Passivhausniveau ist der Flughafen<br />
auch im Betrieb deutlich nachhaltiger.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
73<br />
Nordic – Office of Architecture<br />
Dank ganzheitlicher, auf Nachhaltigkeit bedachte<br />
Planung, bringen die Architekten Nordic – Office of<br />
Architecture den Flughafen auf Passivhausniveau<br />
und senken damit auch die laufenden Betriebskosten.<br />
Die gekrümmte Geometrie des neuen Nordterminals<br />
umschließt bei minimaler Außenhülle den<br />
größtmöglichen Innenraum und bietet damit die geringste<br />
Angriffsfläche für eisige Winde im Winter und<br />
Hitze im Sommer. Ergänzend sind die Fassaden und<br />
Dachflächen hoch isoliert und sämtliche Glasflächen<br />
in 3-fach Verglasung ausgeführt.<br />
u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
74<br />
Grüne Architektur<br />
Die Farbe Grün hält nicht<br />
nur in Form von nachhaltiger<br />
Energieplanung<br />
Einzug im Flughafen,<br />
sondern schmückt auch<br />
als Bepflanzung die<br />
Wände und sorgt für ein<br />
angenehmes Ambiente.<br />
Diverse passive Erträge machen den Bau über weite<br />
Strecken energieautark. Die Sonnenenergie wird<br />
zum einen über Solarpaneele auf dem Dach, zum<br />
anderen als natürliche Lichtquelle maximal genutzt.<br />
Die verminderte künstliche Beleuchtung wirkt sich<br />
zudem positiv auf die Atmosphäre der Innenräume<br />
aus. Geheizt wird mittels Wärmerückgewinnung aus<br />
dem Abwasser der Nachbargemeinde. Außerdem<br />
gelingt es, die thermische Energie aus Mechanik und<br />
Lüftung zu 83 % wieder in Wärme umzuwandeln und<br />
somit den Primärenergiebedarf deutlich zu senken.<br />
Zum Herzstück der ökonomischen Planung wird ein<br />
riesiges Schneedepot. In diesem wird der in den Wintermonaten<br />
anfallende Schnee der Start- und Landebahnen<br />
gelagert und damit die Kühlung des Flughafens<br />
– laut Architekten – bis in den August hinein<br />
natürlich gespeist.<br />
BREEAM, das britische Zertifizierungssystem für<br />
nachhaltiges Bauen, prämiert den Lufthavn Oslo-Gardermoen<br />
mit dem Gütesiegel „Excellent“ und<br />
macht ihn damit zum grünsten Flughafen der Welt.<br />
Überzeugen konnte das Projekt vor allem durch<br />
sein ganzheitliches Konzept. Das effiziente Zusammenspiel<br />
der einzelnen Komponenten der Energieplanung<br />
ergänzt das Design und die Materialwahl<br />
stimmig und sorgt somit für eine ökonomische Gesamtperformance.<br />
Nordic – Office of Architecture erweiterten den Lufthavn<br />
Oslo-Gardermoen zu einem überzeugenden Ensemble<br />
aus Alt und Neu, das sich den Titel „grünster<br />
Flughafen“ mittels intelligenter, an den Ort angepasster<br />
Planung aus bautechnischer Sicht redlich verdient.<br />
Über die typologische Komponente und die Industrie,<br />
die sich hinter und vor den grünen Fassaden des Baus<br />
abspielen, kann man natürlich diskutieren. (eo)
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
75<br />
Nordic – Office of Architecture<br />
New areas<br />
Neue New areas Bereiche<br />
Domestic<br />
Domestic Inland<br />
International<br />
International<br />
Non-Schengen<br />
International<br />
International<br />
Non-Schengen<br />
Int. Non-Schengen<br />
Snow Schneedepot<br />
Sunlight provides<br />
natural light as well as heat<br />
Sonnenlicht als Natürliche Licht- und Wärmequelle<br />
Fernheizwerk<br />
District heating plant<br />
Recovered heat from<br />
waste water<br />
Abwasser Wärmerückgewinnung<br />
Ground source<br />
heat<br />
Erdwärme<br />
technology<br />
Heat Wärmerückgewinnung<br />
recovery<br />
Oslo International Airport<br />
Oslo-Gardermoen, Norwegen<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Mitarbeiter:<br />
Avinor Oslo Lufthavn<br />
Nordic — Office of Architecture, NSW Architects<br />
Gudmund Stokke, Erik Urheim (PGL), Roald Sand,<br />
Christian Henriksen, Geoffrey Clark, Ole Tørklep,<br />
John Arne Bjerknes, Bjørn Olav Susæg,Ingrid Motzfeld,<br />
Ivar Ivarsøy<br />
Bebaute Fläche: 115.000 m 2<br />
Planungsbeginn: 2009<br />
Fertigstellung: 2017<br />
Baukosten: 1,4 Milliarden €
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
76<br />
Grüne Architektur<br />
Die Verlassenheit<br />
von Weihai<br />
Rocknave Teahouse / Weihai, Shandong / Trace Architecture Office (TAO)<br />
Fotos: Hua Li<br />
Das Rocknave Teahouse<br />
lädt Besucher des in der<br />
chinesischen Provinz<br />
Shandong gelegenen Tashan<br />
Parks zum Verweilen<br />
ein. In einem ehemaligen<br />
Steinbruch schufen TAO<br />
(trace architecture office)<br />
ein zurückhaltendes Bauwerk,<br />
das nicht nur den<br />
Stein aus der unmittelbaren<br />
Umgebung als authentisches<br />
Gestaltungsmittel<br />
in Szene setzt, sondern<br />
auch in seinen Raumstrukturen<br />
auf die Naturlandschaft<br />
reagiert.<br />
Für einen Moment scheint die Zeit im Tashan Park<br />
stillzustehen. Die endlosen Betonblöcke der nahe gelegenen<br />
Stadt Weihai rücken in die Ferne, der Fokus<br />
richtet sich ganz auf die nahezu unberührt scheinende<br />
Naturlandschaft im Hier und Jetzt. Die fruchtbare<br />
Erde leuchtet in der warmen Sommersonne in den<br />
verschiedensten Rottönen und bildet zu dem satten<br />
Grün der Baumwipfel einen herrlichen Kontrast.<br />
Erst bei näherem Hinsehen nimmt die Mischung aus<br />
Farben und Texturen eine erkennbare Gestalt an<br />
und vor der Kulisse einer mächtigen Steinwand lädt<br />
eine Plattform aus rostrotem Cortenstahl zum unbeschwerten<br />
Verweilen ein.<br />
Das eigentliche Funktionsgebäude liegt sozusagen<br />
eine Etage tiefer. Das in Peking ansässige Architekturbüro<br />
Trace Architecture Office (TAO) steht für die<br />
Architektursprache eines sich entwickelnden Organismus,<br />
der nicht nur ein formales Objekt, sondern ein<br />
untrennbares Ganzes mit seiner Umwelt darstellt. Folgerichtig<br />
haben die Architekten ihre Interpretation eines<br />
Teehauses bewusst an die bestehende Topografie<br />
angepasst. Während die Aussichtsplattform vom Weg<br />
aus ebenerdig über einen Steg erschlossen wird, führen<br />
mehrere natürliche Steintreppenstufen hinab ins<br />
Innere des Pavillons. Teehaus, WC-Anlage und Lounge<br />
sind für die Besucher des im Nordosten Chinas gelegenen<br />
Naturlandschaftsparks öffentlich zugänglich.<br />
Die besondere Kulisse des Bauplatzes rührt von einem<br />
ehemaligen Steinbruch aus den 1970er und 80er<br />
Jahren her. Die Gegend wird in China als „Shiwozi“<br />
bezeichnet und die lokale Regierung der Provinz<br />
Shandong machte es sich zur Aufgabe, derartige<br />
verlassene Felsformationen zu Parks und Naherholungsgebieten<br />
für die Bevölkerung umzugestalten.<br />
Die Planer von TAO erkannten von Anfang an die<br />
einmaligen Möglichkeiten, an dieser Stelle mit der<br />
Naturlandschaft und den vorhandenen Materialien<br />
zu interagieren. Es ging den Architekten vielmehr
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
77<br />
Trace Architecture Office (TAO)<br />
darum einen Ort zu bewahren, als ein Gebäude zu<br />
errichten. Einen Ort der „Verlassenheit“, den sich die<br />
Natur vom Menschen langsam wieder zurückerobert<br />
hat. „Verlassen zu sein ist in der Tat ein primitiver und<br />
künstlerischer Zustand, der von der Natur geprägt<br />
ist und nicht durch künstliche Werke ersetzt werden<br />
kann”, beschreiben die Architekten das Wesen ihres<br />
Entwurfsgedankens.<br />
Baulich spiegelt sich das in der Positionierung des<br />
Gebäudes wider: Das relativ flache Gelände in der<br />
südwestlichen Ecke der ausgewiesenen Baufläche<br />
schien den Architekten bestens geeignet, um größere<br />
Eingriffe in die Landschaft zu vermeiden. Die Raumfolge<br />
hingegen ergab sich aus der Horizontalen, entwickelt<br />
ganz natürlich aus den bestehenden Felsen<br />
und dem Baumbestand, der unbedingt erhalten werden<br />
sollte. In der Vertikalen hatte die Topo grafie des<br />
Geländes ein optisches Absenken des Teehauses zur<br />
Folge, das nun verborgen zwischen rauen Felswänden<br />
liegt und dessen Dach als Aussichtsdeck dient,<br />
welches direkt vom Spazierweg begehbar ist.<br />
Aufgrund der Anforderungen einer minimalinvasiven<br />
Bauweise wurde die Konstruktion als leichter Stahlbau<br />
aus vorgefertigten Elementen errichtet. Alle tragenden<br />
Strukturen sind in sechs soliden Baukörpern<br />
verborgen, sie bergen alle Funktionsbereiche wie<br />
WC-Anlagen, Technik, Ruheraum. So gibt es keine<br />
sichtbaren Stützen, was wiederum die Wand zum bestimmenden<br />
Element im Raum erklärt. Als Referenz<br />
an die Umgebung, die Geschichte und aus Respekt<br />
für Ressourcen wurde für die Gestaltung der Wände<br />
und Böden der Stein verwendet, der direkt aus<br />
dem hiesigen Steinbruch stammt. Sämtliche Fenster<br />
und Türen lassen sich in Form von Schiebeelementen<br />
unsichtbar in den Boxen versenken. So entsteht<br />
eine offene und durchlässige Raumfolge, welche die<br />
Grenzen zwischen Innen und Außen, Natur und Gebautem,<br />
verschwimmen lässt. Die schützenden, rauen<br />
Steinwände scheinen auch vom Innenraum zum<br />
Greifen nah und vermitteln einen höhlenartigen, fast<br />
archetypischen Charakter.<br />
u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
78<br />
Grüne Architektur<br />
Zwei Innenhöfe zum Schutz bestehender Bäume verstärken<br />
dieses Gefühl des Eins-Seins mit der Natur<br />
noch. Gewohnte Denkmuster werden durchbrochen,<br />
der Rhythmus des Wechsels von Innen- und Außenräumen<br />
konzentriert. In seiner Reduktion steht das<br />
Teehaus von TAO für eine moderne chinesische Architektursprache.<br />
Die Kultur des Teehauses an sich kann im asiatischen<br />
Raum auf eine lange historische Tradition zurückblicken.<br />
In China im 20. Jahrhundert aus politischen<br />
Gründen ausgebremst, erwacht dieses kulturelle<br />
Erbe langsam wieder zu neuem Leben. Das Rocknave<br />
Teahouse stellt in seiner Formensprache eine Besonderheit<br />
der Teehaus<strong>architektur</strong> dar, die in China<br />
– im Gegensatz zu Japan – zumeist üppig verziert<br />
zu finden ist. TAO hingegen konzentrieren sich ganz<br />
auf die Natur, auf die Geschichte, eben jene Verlassenheit<br />
des Ortes und verstärken diese Wirkung<br />
noch durch den reduzierten Einsatz von Oberflächen<br />
(Cortenstahl, Stein und Holz) und Strukturen. Im gleichen<br />
Maße stellt die Materialwahl eine direkte und<br />
greifbare Beziehung zur Umgebung dar, die Grenzen<br />
zwischen Gebautem und Landschaft verschwimmen:<br />
Das verrostete Stahldach fügt sich mit seinen schimmernden<br />
Rottönen nahtlos in die leuchtende Erdlandschaft<br />
ein, das Holz der Fensterrahmen nimmt<br />
Bezug auf die umgebende Bewaldung und der Stein<br />
könnte an eben jenen Stellen schon immer genau so<br />
als trutzige Felswand gestanden haben.<br />
Während im Inneren des Teehauses geborgene<br />
Rückzugsräume gerahmt von massiven Steinwänden<br />
und eindrucksvollen Blickwinkeln in den archaischen<br />
Steinbruch Schwere und Erdung suggerieren,<br />
vermittelt der Anblick aus der Ferne eine gewisse<br />
Leichtigkeit. Die klaren horizontalen Linien des Daches<br />
verweben sich mit den grazilen Vertikalen des<br />
Waldes. Der massive tragende Sockel tritt aufgrund<br />
seiner topografischen Lage optisch zurück, das Dach<br />
hingegen erscheint nahezu schwebend, wie eine an<br />
Fäden aufgehängte Plattform inmitten des Waldes.<br />
Das an sich schwere Material Stahl wird so zu einem<br />
gewissen Grad entmaterialisiert und das Gebäude<br />
erhält eine Leichtigkeit. Dieser Eindruck verstärkt<br />
sich noch beim Betreten der Plattform. Wie auf einem<br />
fliegenden Deck eröffnet sich urplötzlich ein<br />
atemberaubender Blick auf die menschengemachte<br />
massive Felswand inmitten der Waldlandschaft des<br />
Tashan Parks. Für die nötige Bodenhaftung bei einem<br />
solchen Anblick sorgen die Baumwipfel, die durch die<br />
Innenhöfe grazil nach oben wachsen und das Aussichtsdeck<br />
in Balance halten.<br />
Ein Ort der Verlassenheit ist auch immer ein Ort der<br />
Zeitreise. Schließlich bedeutet verlassen zu sein, dass<br />
einmal etwas da war. Mit diesem Gedanken im Kopf<br />
erscheint der rostrot verwitterte Cortenstahl plötzlich<br />
nicht mehr nur als Reminiszenz an die natürliche Umgebung,<br />
sondern auch an die Vergänglichkeit oder die<br />
Veränderung unserer Umgebung. Genauso wie sich<br />
die Palisaden vor Ort nach jahrelanger Winderosion<br />
braunrot verfärbt haben, so hat sich die Oberfläche<br />
des Decks im Laufe der Zeit verändert. Aber nicht<br />
nur die äußeren Schichten durchleben im Laufe der<br />
Jahre und Jahrzehnte einen Wandel, auch Orte selbst<br />
verändern und entwickeln sich. Und das nicht unbedingt<br />
gegen, sondern vielmehr im Einklang mit der<br />
Natur. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür stellt<br />
das Teehaus in Weihai dar, in seiner ganzen Schlichtheit<br />
und dabei umso größeren Ausdrucksstärke. TAO<br />
geht es eben immer um die Essenz des Ortes, welche<br />
die Architektur unter Berücksichtigung der örtlichen<br />
Gegebenheiten tief in ihrem kulturellen und ökologischen<br />
Kontext verankern soll.<br />
(lp)
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
79<br />
Trace Architecture Office (TAO)<br />
Rocknave Teahouse<br />
Weihai, Shandong, China<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Mitarbeiter:<br />
Weihai Bureau of Landscape and Forestry<br />
Trace Architecture Office (TAO)<br />
Hua Li, Jiang Nan, Liang Wenyu, Lai Erxun<br />
Grundstücksfläche: 202 m 2<br />
Bebaute Fläche: 141 m 2<br />
Planungsbeginn: 2012 - 2013<br />
Bauzeit: 2014 - 2015<br />
Fertigstellung: 2015
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
80<br />
Grüne Architektur<br />
Ein Baumhaus<br />
als urbaner Wohnraum<br />
25 Verde / Turin, Italien / Luciano Pia<br />
Fotos: Beppe Giardino
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
81<br />
Luciano Pia<br />
Das Projekt „25 Verde“<br />
von Luciano Pia in Turin<br />
schafft es, die Vorteile<br />
von Stadt und Land zu<br />
verbinden. Als urbane<br />
Wohnform wertet es mit<br />
seiner Fassaden- und<br />
Dachbegrünung das<br />
ehemalige Industrieviertel<br />
auf. Gleichzeitig<br />
verbessern die bis zu acht<br />
Meter hohen Bäume das<br />
Mikroklima im Gebäude<br />
und im Stadtteil.<br />
Nicht immer muss ein Baumhaus im Wald stehen. Architekt<br />
Luciano Pia zeigt mit seinem 2012/2013 realisierten<br />
Projekt „25 Verde“, dass es auch als urbane<br />
Wohnform infrage kommt. Das Ergebnis kann sich<br />
sehen lassen. Ein gekonntes Zusammenspiel aus hölzernem<br />
Fundament und Bäumen bietet den Bewohnern<br />
hier eine hohe Lebensqualität.<br />
Auf den ersten Blick wirkt das Objekt, das mitten im<br />
Industrieviertel von Turin steht, experimentell. Denn<br />
das moderne Wohnhaus mit fünf Stockwerken besteht<br />
fast vollständig aus Holz und beheimatet obendrein<br />
150 Bäume an seiner Fassade. Platziert sind sie<br />
in stabilen, großen Töpfen auf den Balkonen und am<br />
Gerüst des Baus. Damit steht dieser in einem klaren<br />
Kontrast zum Umfeld. Das graue Stadtviertel – früher<br />
die Heimat der Arbeiterschicht Turins – beinhaltet<br />
neben monotonen Wohnblöcken die Fiat-Werke<br />
und verlassene Fabrikshallen. Aus der fantasielosen<br />
Ansammlung von Industriehäusern sticht das Baumhaus<br />
hervor. Architekt Pia sah es vor diesem Hintergrund<br />
als eine Herausforderung an, ein Wohnhaus zu<br />
errichten, in dem sich die Bewohner, abgesehen von<br />
dessen Standort, wohlfühlen.<br />
Mit einem richtigen Baumhaus hat das Projekt tatsächlich<br />
wenig gemeinsam – dafür ist es zu raffiniert.<br />
Denn der Planer berücksichtigte beim Entwurf<br />
nicht nur umwelttechnische Aspekte. Das Haus wurde<br />
auch im Hinblick auf die Lebensqualität und ein<br />
harmonisches Zusammenspiel mit dem bebauten<br />
Umfeld entworfen. Mit seinem fantasievollen Design<br />
sticht es zwar aus der Masse hervor, wirkt aber keinesfalls<br />
fehl am Platz.<br />
u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
82<br />
Grüne Architektur<br />
Ein lebendiger Bau<br />
Das Gebäude setzt sich aus 63 Wohnungen zusammen.<br />
Alle Wohneinheiten sind entweder mit einem<br />
großen Balkon oder einer Dachterrasse ausgestattet.<br />
Bei einer Brutto-Grundfläche von 7.500 Quadratmetern<br />
verfügt der Bau zusätzlich über einen Innenhof<br />
mit 1.500 Quadratmetern sowie einen Dachgarten<br />
mit 1.200 Quadratmetern. Das Projekt fördert nicht<br />
nur ein gutes Stadtklima, sondern hat auch einen<br />
optischen Nutzen. Mit seinem einzigartigen, harmonischen<br />
Aussehen wertet es das Ortsbild Turins auf<br />
und mit seiner unverkennbaren Fassade ist es für den<br />
Stadtteil identitätsstiftend. Die gesichtslosen Straßen<br />
lockert der Bau mit seinen verspielten Terrassen<br />
auf. Die mit Lärchenholz verkleidete Fassade bildet<br />
einen Kontrast zur umliegenden Bebauung und wirkt<br />
fast wie eine Architektur der Übertreibung. Von Pia<br />
ist dieses Image durchaus gewollt. Als praktisch erweist<br />
sich in diesem Kontext, dass das Gebäude und<br />
dessen Vegetation einem steten Wandel unterworfen<br />
sind. Die Bäume wachsen, verändern sich und lassen<br />
die Bewohner am natürlichen Zyklus der Jahreszeiten<br />
teilhaben. Die Konstante ist hier die Veränderung,<br />
welche den Bau belebt und ihn zu einem bemerkenswerten<br />
Naturschauspiel macht. Damit bereichert das<br />
Baumhaus nicht nur seine Residenten, sondern auch<br />
sein Umfeld.<br />
Das Objekt ist nicht nur schön anzusehen, sondern<br />
auch stabil. Gestützt wird das Konstrukt mit seinen<br />
fünf Stockwerken durch eine Struktur aus Stahl. Um<br />
den natürlichen Eindruck zu verstärken, sind die<br />
Stahlträger in Baum-Optik gehalten. Um mit seinem<br />
Bau einen guten energetischen Wirkungsgrad zu<br />
erreichen, versah der Architekt das Haus mit einer<br />
äußeren Isolationsschicht, belüfteten Wänden und<br />
Heiz- und Kühlsystemen, die mit Grundwasser betrieben<br />
werden. Die Grünanlagen werden durch wiederverwendetes<br />
Regenwasser bewässert. Mit diesen<br />
Maßnahmen erreichte er bei seinem Baumhaus eine<br />
hohe Energieersparnis.<br />
Derzeit gilt das urbane Baumhaus als Luxusimmobilie.<br />
Zu erkennen ist dies vor allem am Preis. Ein Appartement<br />
mit 110 Quadratmetern wird derzeit um<br />
rund 600.000 Euro angeboten. In die Rubrik sozialer<br />
Wohnbau fällt dieses Projekt damit sicherlich nicht.<br />
Dafür sind auch die Erhaltungskosten zu hoch. Trotzdem<br />
ist es ein wichtiges Beispiel für grüne Architektur<br />
im urbanen Raum. Es zeigt auf, wie sich nachhaltiges<br />
Bauen auch in dicht besiedelten Gebieten<br />
realisieren lässt.<br />
u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
83<br />
Luciano Pia
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
84<br />
Grüne Architektur<br />
Die Bäume im Innenhof<br />
des Baus wirken wie eine<br />
natürliche Klimaanlage<br />
und kühlen den Wohnbau<br />
an heißen Tagen.<br />
Mitten in der Stadt – mitten in der Natur<br />
„25 Verde“ schafft es, eine natürliche Brücke zwischen<br />
Mensch, Stadt und Natur zu schlagen. Das<br />
Zukunftsmodell des nachhaltigen Wohnens vereint<br />
gekonnt die Vorteile des urbanen und des ländlichen<br />
Umfelds. Die Vegetation an der Fassade nimmt in<br />
der Stunde fast 200.000 Liter Kohlendioxid auf und<br />
verbessert dadurch das Klima. Schädliche Giftstoffe,<br />
die durch Autos in die Luft gelangen, werden durch<br />
die Bäume absorbiert. Sie regulieren auch die Temperatur<br />
in den Wohnräumen. Im Innenhof des Baus<br />
wurden ebenfalls 50 Bäume gepflanzt. Dort fungieren<br />
Sie als Klimaanlage und schaffen ein gesundes<br />
Mikroklima. Die Bepflanzung erreicht eine Höhe zwischen<br />
2,5 und 8 Metern. Die Auswahl der Pflanzenarten<br />
erfolgte bewusst – der Planer setzte auf eine<br />
ausgewogene Mischung aus verschiedenen Farben,<br />
Blüten und Blättern. Und das Potpourri ist geglückt.<br />
Das Bauwerk strahlt eine natürliche Atmosphäre aus<br />
und wirkt spannend.<br />
Durch die dicht begrünte Fassade sind die Wohnungen<br />
vor dem Außenlärm geschützt. Die Bepflanzung<br />
wirkt zwischen den Wohnräumen und der Straße wie<br />
ein Puffer und sichert dadurch die Lebensqualität<br />
der Bewohner. Auch schirmt sie intensive Sonneneinstrahlung<br />
ab. Verlieren die Bäume im Winter ihre<br />
Blätter, wird der natürliche Sonnenschutz lichtdurchlässig,<br />
sodass in der kalten Jahreszeit Licht in die<br />
Wohnungen fällt.<br />
Die echte Wildnis können Projekte wie „25 Verde“<br />
natürlich niemals ersetzen. Das wollen sie auch gar<br />
nicht – begrünte Bauten können aber durchaus die<br />
Grenze des vorherrschenden Stadtbilds versetzen<br />
und ein neues Bild des urbanen Raums vermitteln.<br />
Bisher wurden Wildnis und Zivilisation als Gegensätze<br />
angesehen – also zwei Faktoren, die sich gegenseitig<br />
ausschließen. Diese Definition gilt es, neu<br />
zu überdenken. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass<br />
Stadt ohne Natur nicht funktioniert. Ohne intakte<br />
Ökosysteme gibt es weder saubere Luft noch frisches<br />
Wasser. Die heutige Avantgarde der Baukunst<br />
nähert Mensch und Natur einander an.<br />
Architektur führt Mensch und Natur zusammen<br />
Auch „25 Verde“ ist ein Beispiel für eine ausgewogene<br />
Mischung aus Natur und Urbanität. Die Menschen<br />
haben die Natur damit vor ihrer Haustüre und müssen<br />
nicht erst aufs Land flüchten, um sich im Grünen<br />
zu erholen. Das moderne Baumhaus hat damit nicht<br />
nur als Lebens-, sondern auch als Erholungsraum<br />
seinen Reiz. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Wohnform<br />
langfristig durchsetzt. In Turin sorgt sie jedenfalls<br />
für Zufriedenheit.<br />
Italien ist für urbane Experimente offen. 2012 fasste<br />
die grüne Architektur mit Luciano Pias Projekt in<br />
Turin Fuß. Nur zwei Jahre darauf erfolgte in Mailand<br />
die Realisierung des Projekts „Bosco Verticale“. Dass<br />
ein innovatives Projekt nicht nur den Bewohnern der<br />
Immobilie, sondern gleich der ganzen Stadt zugutekommt,<br />
lässt sich an beiden Beispielen beobachten:<br />
Die begrünten Hoch- und Wohnhäuser gelten als<br />
Sensation und locken jedes Jahr viele Touristen an.<br />
(ds)
D<br />
131<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
SPLIT<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
C<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
85<br />
Luciano Pia<br />
3_D5S<br />
IPE1<br />
P209.1<br />
EG OG 3<br />
Condomino 25 Verde<br />
Italien, Turin<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Statik:<br />
GRUPPO CORAZZA, MAINA COSTRUZIONI, DE-GA S.p.A.<br />
Luciano Pia<br />
Giovanni Vercelli<br />
Grundstücksfläche: 9000 m²<br />
Bebaute Fläche: 7500 m²<br />
Planungsbeginn: 2007<br />
Bauzeit:<br />
6 Jahre<br />
Fertigstellung: 2013<br />
Baukosten:<br />
22 Millionen Euro
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
86<br />
Grüne Architektur<br />
Zurück zur Natur<br />
Alnatura Arbeitswelt / Darmstadt / haascookzemmrich STUDIO2050<br />
Fotos: Roland Halbe<br />
Die berühmte Aufforderung „Retour à la nature!“<br />
findet sich bei Jean-Jacques Rousseau zwar nicht<br />
wörtlich, wurde ihm aber fälschlicherweise zugeschrieben.<br />
Der Philosoph, Naturforscher und Pädagoge<br />
Rousseau meinte allerdings, dass, „wenn man<br />
zu früh damit anfängt, die natürlichen Gefühle, Neigungen<br />
und Bedürfnisse mit aufgepfropften Idealen,<br />
anerzogenen Gewohnheiten und unverstandenen<br />
Pflichten zu unterdrücken“ – man einen entzweiten<br />
Menschen schüfe! Sein pädagogischer Ausgangspunkt<br />
lag dabei auf der Bildung der Organe und Sinne<br />
in der Erziehung. Mit dem neuen Alnatura Campus<br />
in Darmstadt, entworfen vom Architekturbüro haascookzemmrich<br />
STUDIO2050 auf dem Gelände der<br />
ehemaligen Kelley-Barracks, ist eine Architektur entstanden,<br />
welche genau diesen Kriterien gerecht wird.<br />
Ein Bau, der alle Sinne anspricht, Nachdenken fordert<br />
und einen neuen Weg in der Planung und Errichtung<br />
von Architektur beschreibt. Und auch vielleicht der<br />
ständigen Diskussion, ob „Abreißen oder Neubauen“<br />
neue Inputs liefert.<br />
u<br />
Es ist kein „wildes“, ins Auge stechendes Projekt, das<br />
die Architekten haascookzemmrich STUDIO2050 in<br />
Darmstadt für Alnatura entworfen haben. Eher unaufgeregt,<br />
aber von einer sehr weitreichenden und verantwortungsvollen<br />
Konzeption geprägt, weist diese Architektur<br />
einen neuen Weg für nachhaltiges, grünes Bauen.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
87<br />
haascookzemmrich STUDIO2050
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
88<br />
Grüne Architektur<br />
Ein ressourcenneutraler Neubau<br />
Alnatura entwickelt Bio-Produkte und betreibt<br />
eigene Bio-Supermärkte, liegt also im<br />
Trend. Trendig ist auch die Architektur des<br />
neuen Campus der Firma in Darmstadt, der<br />
eine Arbeitswelt für (fast) alle ist: nicht nur<br />
für Mitarbeiter, sondern auch für Besucher.<br />
Weit weg vom üblichen Image einer grün<br />
angehauchten Architektur. Schon beim<br />
Eingang wird der Besucher verführt, in das<br />
links vom Haupteingang gelegene vegetarische<br />
Restaurant „tibits“ abzuzweigen. Widersteht<br />
man der kulinarischen Verlockung<br />
und geht geradeaus, gleitet der Blick über<br />
die geschwungenen Ebenen nach oben in<br />
ein lichtdurchflutetes Holzdach.<br />
Man wird an einem geschwungenen, hölzernen<br />
Empfangstresen begrüßt und darf es<br />
sich in der Wartelounge bequem machen.<br />
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet<br />
sich das Konferenzzentrum mit den dienenden<br />
Funktionen wie den Garderoben und<br />
Schließfächern. Der Übergang zwischen<br />
öffentlichem und internem Bereich ist fließend<br />
und fügt sich in das Gesamtkonzept<br />
ein. Dieses zieht sich als Wegegeflecht<br />
durch den Körper und schafft horizontale<br />
und vertikale Nachbarschaften. Spielerisch<br />
werden so die auf den drei Ebenen liegenden<br />
Bürobereiche miteinander vernetzt. Es<br />
gibt keine Barrieren. Die Arbeitswelt verliert<br />
sich nicht in einzelnen Abteilungen,<br />
abgeschlossenen Räumen und unübersichtlichen<br />
Gängen: Ein großer Raum, der<br />
sich vom Erdgeschoss bis unter das Dach<br />
zwischen den Fassaden – ohne störende<br />
Trennwände – aufspannt, bietet den Mitarbeitern<br />
und dem Unternehmen eine unbegrenzte<br />
Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten<br />
und bricht mit dem Dogma starrer<br />
Bürostrukturen. Auf allen Ebenen befinden<br />
sich daher offene Teeküchen, die auch als<br />
Besprechungsorte genutzt werden.<br />
Der Begriff Teeküche beschreibt allerdings<br />
diese Meeting-Points nur unzureichend. Die<br />
Arrangements von Küchen, Holztischen,<br />
Sesseln und Sofas wirken entspannt und<br />
einladend und bilden eine Plattform für anregende<br />
Treffpunkte. Hier liegt die Post bereit,<br />
man holt sich einen Kaffee oder macht<br />
eine Kopie. Denn es sind diese spontanen<br />
Begegnungen, die zufälligen Impulse, die<br />
Arbeitswelten attraktiv machen und die<br />
Kreativität der Mitarbeiter fördern können.<br />
Der Arbeitsplatz in der neuen Arbeitswelt<br />
ist – überall. Vom Lümmelbrett entlang<br />
der Galeriebrüstung, der Sitznische in den<br />
Lehmwandfenstern, bis zum Holzdeck am<br />
Seerosenteich gehören das Gebäude und<br />
der Campus den Mitarbeitern. Diese flachen<br />
Hierarchien spiegeln sich in der offenen<br />
Struktur des neuen Hauses wieder. Ob<br />
Restaurant, Meeting Point, Konferenzräume<br />
oder die Bürolandschaft – es existiert<br />
eine Vielfalt an Räumen, die eine lebendige<br />
und flexible Arbeitsatmosphäre ermöglicht.<br />
Konzentrierte, „private“ Arbeitsbereiche<br />
wie die Alkoven, stehen „öffentlichen“ Flächen<br />
gegenüber. Es gibt keine trennenden<br />
Türen. Mit akustisch wirksamen Vorhängen<br />
können Besprechungsbereiche bei Bedarf<br />
abgetrennt werden. Jeder Arbeitsplatz bietet<br />
einen besonderen Ausblick und alle Mitarbeiter<br />
können durch das Atrium und die<br />
Schaufassade im Westen auf den Freiraum<br />
mit seiner vielfältigen Naturwelt blicken.<br />
Das ganze Erdgeschoss funktioniert als<br />
Treffpunkt, als Raum für Kommunikation,<br />
der die unkomplizierte Begegnung von Besuchern<br />
und Mitarbeitern ermöglicht. Wer<br />
in das Atrium der neuen Arbeitswelt tritt,<br />
fühlt sich beinahe wie unter freiem Himmel.<br />
Das Dach und die transparenten Stirnfassaden<br />
lassen so viel Sonnenlicht hereinströmen,<br />
dass der gesamte Innenraum taghell<br />
erleuchtet wird. Und die Materialien Holz,<br />
Lehm und der unbehandelte Beton geben<br />
dem Gebäude eine natürliche, unprätentiöse,<br />
frische und freundliche Anmutung.<br />
Das Atrium ist ein Ort, der atmen und damit<br />
eine besondere Anziehungskraft auf alle,<br />
die sich im Gebäude aufhalten, ausüben<br />
soll. Es teilt den längs gerichteten Baukörper<br />
in zwei Hälften, reicht bis zum Dach, wo<br />
die 91,4 Meter langen Haushälften durch ein<br />
Glasband wieder verbunden sind. Verschiedenste<br />
Stege, geschwungene Rampen,<br />
Treppen und Verbindungen schaffen die<br />
kommunikative und logistische Verbindung<br />
der beiden Bürohälften in den Geschossen.<br />
Ganz gleich, auf welcher Ebene man sich<br />
befindet, der Blick ist von allen Standpunkten<br />
spannend und abwechslungsreich.<br />
Das Tragwerk für die Holzsatteldachkonstruktion<br />
bilden markante Brettschichtholzträger<br />
mit einer Gesamtlänge von 22 m.<br />
Die Trägerhöhe von 2,3 m über der Stütze<br />
ist auf die weite Auskragung von 11,6 m zurückzuführen.<br />
Das großzügige Raumgefühl<br />
wird auf diese Weise unterstrichen. Aufgrund<br />
des Standorts des Gebäudes in einer<br />
Erdbebenzone lag besonderes Augenmerk<br />
auf der Planung der Verbindungsdetails.<br />
Insbesondere die Anschlussbereiche von<br />
Oberlicht und Fassade an das Tragwerk<br />
müssen im Erdbebenfall auftretende Differenzverformungen<br />
aufnehmen können.<br />
Schlichter Körper<br />
Der äußere Eindruck ist eher seriell, eben<br />
büro- oder verwaltungsmäßig – umso mehr<br />
wird man im Inneren von den bewegten, geschwungenen<br />
und ineinander verwobenen<br />
Ebenen überrascht. Auch die Dachschrägen<br />
bewirken nicht den üblichen begrenzenden<br />
Eindruck, das mag an der Wärme, die das<br />
verwendete Holz ausstrahlt, liegen, oder<br />
auch an der Großzügigkeit der Raumgefüge.<br />
Die Lage und die Ausrichtung des Gebäudes<br />
sind nach mikroklimatischen Gesichtspunkten<br />
festgelegt. Um bestmögliche<br />
Tageslichtbedingungen im Inneren der Arbeitswelt<br />
zu bieten, ist der Baukörper mit<br />
seinen Längsseiten Nord/Süd orientiert.<br />
Damit wird sichergestellt, dass durch das<br />
Oberlichtband des Atriums reines Nordlicht<br />
ins Gebäude geleitet wird. Ungewollte solare<br />
Wärmeeinträge können so vermieden<br />
werden. Um das Atrium herum gruppieren<br />
sich auf drei Geschossen ca. 10.000 m 2<br />
Bürofläche für bis zu 500 Mitarbeiter. Die<br />
Geschosshöhe von 4 m im Erdgeschoss<br />
und 3,5 m im Obergeschoss ermöglicht eine<br />
durchgehende Tageslichtnutzung, auch in<br />
den tiefer liegenden Bürobereichen. Helle<br />
Oberflächen und ein heller Bodenbelag<br />
unterstützen die tageslichtfreundliche Arbeitsatmosphäre.<br />
Alle Fenster sind mit einem Blend- und<br />
Sonnenschutz ausgestattet, der individuell<br />
gesteuert werden kann. Auf der sonnenbeschienenen<br />
Südseite des Gebäudes befindet<br />
sich mit dem Teich ein natürlicher Klimapuffer,<br />
der das Mikroklima des Standortes<br />
im Sommer positiv beeinflusst. Die schönen<br />
hohen Bestandskiefern auf der Südseite<br />
des Gebäudes liefern im Sommer die gewünschte<br />
Verschattung. Und natürlich wird<br />
das Sonnenlicht über eine 480 m 2 große<br />
Fotovoltaikanlage auf dem Dach auch zur<br />
Energiegewinnung genutzt. An der kühleren<br />
Nordseite befinden sich mit dem Konferenzbereich<br />
im Erdgeschoss hingegen Räume,<br />
welche hohe Luftwechselraten benötigen<br />
und von der kühleren Umgebung profitieren.<br />
Die West- und Ostseite der Arbeitswelt sind<br />
transparent gestaltet. Ein Ausblick in beide<br />
Welten, welche der Campus so gut miteinander<br />
verbindet: im Westen, der Wald und die<br />
naturnahe Umgebung, im Osten die gebaute<br />
Umwelt und die Stadt.<br />
u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
89<br />
haascookzemmrich STUDIO2050
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
90<br />
Grüne Architektur
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
91<br />
haascookzemmrich STUDIO2050<br />
Frischluft aus dem Wald<br />
Es war von Anfang an ein Planungsziel, das Gebäude<br />
ganzjährig natürlich zu belüften und auf Ressourcen<br />
verbrauchende und wartungsintensive Klima- und<br />
Lüftungsgeräte zu verzichten. Der westlich gelegene<br />
Wald bietet hierfür optimale Voraussetzungen. Im<br />
Sommer entsteht über die Verdunstung an den Blattoberflächen<br />
ein natürlicher Klimatisierungseffekt. Die<br />
Frischluft für die Arbeitswelt wird daher über zwei<br />
Ansaugtürme am Waldrand in einen Erdkanal geleitet<br />
und von dort ins Gebäude geführt. Das Erdreich<br />
bietet eine stabile Durchschnittstemperatur, dadurch<br />
wird die ins Gebäude strömende Luft auf natürlichem<br />
Wege vorkonditioniert – im Winter erwärmt und im<br />
Hochsommer gekühlt. Die frische Luft wird im Gebäude<br />
an den Kernen in die Geschosse geleitet. Für<br />
den Antrieb dieses Luftstroms sorgt der Kamineffekt<br />
des Atriums, eine Thermik, die sich unter dem Oberlichtband<br />
einstellt. Bei besonderen Wetterereignissen,<br />
Inversionswetterlagen und Gewittern können Ventilatoren<br />
im Inneren des Kanals zugeschaltet werden.<br />
Darüber hinaus können die Mitarbeiter aus Komfortgründen<br />
die Fenster der Fassade individuell öffnen.<br />
Erdwärme<br />
Durch die vorkonditionierte Zuluft des Erdkanals ist<br />
der zusätzliche Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes<br />
sehr gering. Die Speichermasse der Lehmwände und<br />
der Betondecke sorgen für ein stabiles, ausgeglichenes<br />
Temperaturniveau. An heißen Sommertagen helfen<br />
die extra hohen Räume und die Verdunstungskühlung<br />
des Lehms, Wärmeinseln im Arbeitsbereich zu<br />
vermeiden. So kommt die Architektur mit den 69 cm<br />
dicken Lehmwänden sehr gut ohne mechanische<br />
Kühlgeräte durch den Sommer. Im Winter braucht<br />
es allerdings zusätzliche Wärme. Die effizienteste<br />
Art Räume zu beheizen ist, über Strahlung Wärme<br />
zu verbreiten. Daher sind in die Lehmwände des Gebäudes<br />
Heizschlangen eingestampft, die mit Warmwasser<br />
aus regenerativen Quellen wie den Geothermiesonden<br />
und aus der Abwärmerückgewinnung der<br />
Küchentechnik gespeist werden.<br />
u<br />
Helle freundliche Räume,<br />
Holz, Lehm und viel<br />
Naturlicht prägen diese<br />
Architektur.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
92<br />
Grüne Architektur<br />
Die Wassernutzung<br />
Der Wechsel zwischen lang anhaltenden<br />
Trockenphasen und plötzlichen Starkregenereignissen<br />
ist ein weiterer Hinweis auf die<br />
Auswirkungen des Klimawandels. Auf dem<br />
Campus wird mit Regen und Wasser daher<br />
sehr bewusst gewirtschaftet. Die Modellierung<br />
des Geländes führt das Wasser gezielt<br />
über Bachläufe und Aufkantungen weg vom<br />
Gebäude in eine über 1000 m 3 große unterirdische<br />
Zisterne. Auch die Dachentwässerung<br />
mündet hier, um dann für die Bewirtschaftung<br />
der Partner- und Schulgärten<br />
sowie als Grauwasser gezielt genutzt zu<br />
werden.<br />
Die Akustik<br />
In der Planung wurde von Anfang an ein<br />
besonderes Augenmerk auf die Bedämpfung<br />
unangenehm empfundener Geräuschquellen<br />
gelegt. Um die thermische Speicherfähigkeit<br />
der Decken und Wände nicht<br />
zu beeinträchtigen, war der Einsatz von<br />
Vorsatzschalen und abgehängten Decken<br />
ausgeschlossen. Eine besondere Lösung<br />
stellt daher der Einsatz der Absorberstreifen<br />
in der Betondecke dar. Die geschäumte<br />
Betonstruktur der in den Rohbau eingelegten<br />
Fertigteile sorgt für eine wirksame Brechung<br />
der Schallwellen und trägt wesentlich<br />
zur Bedämpfung der Arbeitswelt bei.<br />
Neben dieser Neuentwicklung des Fraunhofer<br />
Instituts ist das Holzdach mit der<br />
schallwirksamen Holzlammellendecke ein<br />
weiterer wichtiger Baustein. Auch die hölzerne<br />
Fensterrahmung und die Mikroperforierung<br />
der Kernwandverkleidung wirken<br />
dämpfend auf den Raum. Darüber hinaus<br />
trägt die offenporige Struktur der Stampflehmwand<br />
zu der guten Geräuschkulisse<br />
des Hauses bei.<br />
Renaturierung<br />
Bei der Umgestaltung des ehemaligen Kasernenareals<br />
wurden versiegelte Flächen,<br />
wo immer möglich, rückgebaut und renaturiert.<br />
Die alten Fahrbahnplatten wurden<br />
vor Ort gebrochen und als Sitzstufen und<br />
Bachlaufkanten oder als Füllkies direkt wiederverwertet.<br />
Lediglich für die baurechtlich<br />
notwendigen Stellplätze blieben die alten<br />
Betonplatten wie vorgefunden liegen. Eingebettet<br />
in die Dünenlandschaft, mit dem<br />
für die Region typischen Magerrasen, befinden<br />
sich ein Fahrradhaus aus Holz, ein<br />
KinderNaturGarten, eine Streuobstwiese,<br />
öffentliche Bio-Pachtgärten auf 5.000 m 2 ,<br />
ein Schulgarten der Montessori-Schule<br />
Darmstadt, Hochbeete, ein Naturteich,<br />
Kräutersinnesgärten sowie ein kleines<br />
Amphitheater aus Betonbruchstücken des<br />
ehemaligen Panzerübungsplatzes.<br />
Die Stampflehmfassade<br />
In Zusammenarbeit mit Martin Rauch und<br />
Transsolar ist eine innovative Stampflehmwand<br />
entstanden. Die einzelnen Stampflehmblöcke<br />
(3,5 m x 1,0 m) wurden an der<br />
Nord- und Südfassade zu 16 je 12 m hohen<br />
Wandscheiben geschichtet. Weltweit zum<br />
ersten Mal wurde die Stampflehmwand<br />
dabei mit einer geothermischen Wandheizung<br />
belegt. Eine weitere Besonderheit ist<br />
die Kerndämmung der direkt neben der<br />
Baustelle vorgefertigten Stampflehm-Fertigteile:<br />
Die 17 cm starke Dämmung besteht<br />
aus Schaumglasschotter, einem Recyclingmaterial.<br />
Die äußere Stampflehmschicht<br />
ist 38 cm, die innere 14 cm dick. Insgesamt<br />
hat der Aufbau eine Dicke von 69 cm und<br />
erreicht einen guten U-Wert von 0,35W/<br />
(m 2·K). Die 12 m hohen Stampflehmscheiben<br />
sind selbsttragend und lediglich mit<br />
Ankern an den Geschossdecken fixiert. Die<br />
Wände enthalten nicht nur Lehm aus dem<br />
Westerwald und Lavaschotter aus der Eifel,<br />
sondern auch recyceltes Material aus dem<br />
Tunnelaushub von Stuttgart 21.<br />
Gestampfter Lehm ist sehr massiv, seine<br />
Dichte ist mit Beton vergleichbar. Stampflehm<br />
wirkt somit hervorragend als Speichermasse<br />
und reguliert auf natürliche Art<br />
und Weise die Raumluftfeuchte. Um der<br />
Oberflächenerosion von Stampflehm entgegenzuwirken,<br />
sind horizontale Erosionsbremsen<br />
aus Ton und Trasskalk in einem<br />
Abstand von 30 bis 60 cm eingebracht. Wie<br />
eine Flussverbauung bremsen sie die Kraft<br />
des Wassers und minimieren so die Erosion.<br />
Die graue Energie bei der Herstellung, Verarbeitung<br />
und dem möglichen Rückbau von<br />
Lehm ist praktisch null. Es zeigt sich, dass<br />
Lehm hier noch weit vor bekannten Naturprodukten<br />
wie Holz oder Tonziegeln liegt.<br />
Durch die Langlebigkeit des Materials, wie<br />
auch durch die hervorragende Luftfeuchteregulation<br />
und Wärmespeicherfähigkeit<br />
des Lehms, entsteht ein Bau von hoher<br />
Wertstabilität. Die Oberfläche bleibt frei von<br />
Algen- oder Moosbildung, der Reinigungsoder<br />
Pflegeaufwand der Fassade entfällt. Im<br />
Inneren verbessert die poröse Oberfläche<br />
neben dem Raumklima auch wesentlich die<br />
Akustik der angrenzenden Bürofläche.<br />
Klimaneutrales Gebäude<br />
Neben den genannten Maßnahmen, beispielsweise<br />
der Verwendung nachwachsender<br />
und natürlicher Baustoffe wie Holz und<br />
Lehm sowie dem Einsatz wiederverwerteter<br />
und wiederverwendbarer Materialien, sind<br />
es auch die vielen kleinen, kaum sichtbaren<br />
Entscheidungen, die dazu beigetragen haben,<br />
aus dieser Arbeitswelt ein klimaneutrales<br />
Gebäude zu machen. (so wurde z. B.<br />
die Dämmung des Kellers aus recyceltem<br />
Schaumglas hergestellt).<br />
(rp)
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
93<br />
haascookzemmrich STUD102050<br />
OG2<br />
Alnatura Arbeitswelt - Grundriss OG2 1:200<br />
Alnatura Arbeitswelt - Grundriss EG 1:200<br />
EG<br />
Alnatura Arbeitswelt<br />
Darmstadt, Deutschland<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Mitarbeiter:<br />
Statik:<br />
Campus 360 GmbH<br />
haascookzemmrich STUDIO2050<br />
Martin Haas (verantw. Partner), Sinan Tiryaki (Projektleiter)<br />
Knippers Helbig, Stuttgart<br />
Grundstücksfläche: 55.000 m 2<br />
Bebaute Fläche: 4.000 m 2<br />
Nutzfläche: 10.000 m 2<br />
Planungsbeginn: 2014<br />
Bauzeit:<br />
2,5 Jahre<br />
Fertigstellung: 01/<strong>2019</strong><br />
Baukosten:<br />
24,3 Mio. Euro
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
94<br />
Lehm als Baustoff<br />
Geformt aus Erde<br />
Als nachhaltiger und wohnbehaglicher Baustoff ist Lehm trotz eines erkennbaren<br />
Booms seit den 80er Jahren in der Architektur noch immer weit unterschätzt.<br />
Dabei handelt es sich bei der reichlich vorhandenen Mischung aus Sand, Schluff<br />
und Ton um einen der ältesten Baustoffe, den die Menschheit kennt. In unseren<br />
Breiten stammen die Lehmvorkommen zumeist aus der Eiszeit. Gestein, von Gletschern<br />
zu Löss und Sand zerrieben, wurde durch Flüsse verfrachtet und vom Wind<br />
zu Ablagerungen verweht.<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: Emanuel Dorsaz, Laura Egger<br />
Um Lehm am Bau sinnvoll einsetzen zu<br />
können, gilt es, dessen bauphysikalische<br />
Eigenschaften und baubiologisches Verhalten<br />
zu verstehen. Im feuchten Zustand<br />
quillt Lehm und ist formbar, beim Trocknen<br />
schwindet er und wird fest. Lehm wirkt im<br />
Raum Luftfeuchte regulierend und konservierend<br />
auf angrenzende Holzbauteile<br />
(Stichwort Fachwerkbau). Kombiniert mit<br />
der Fähigkeit Wärme zu speichern, aber<br />
auch Gerüche und Schadstoffe zu binden,<br />
rangiert Lehm zurecht seit mehr als 9.000<br />
Jahren ganz oben in der Liste der beliebtesten<br />
Baustoffe. De facto lebt auch heute<br />
noch rund ein Drittel der Weltbevölkerung<br />
in Lehmhäusern.<br />
Als „gesunder” und ökologischer Baustoff<br />
passt Lehm nebenbei perfekt in den Geist<br />
unserer Zeit. Weiterer großer Pluspunkt:<br />
seine Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit.<br />
Gebrannt kommt Lehm in Form von<br />
Ziegeln auf der Baustelle zum Einsatz. Ob<br />
als Putz, Estrich oder Farbe, im Innen- oder<br />
Außenraum, als technisches oder gestalterisches<br />
Element – Lehm ist auch ohne<br />
Brennvorgang beinahe ein Alleskönner.<br />
Bei Gestaltern steht der Lehm in Form von<br />
gestampften Schichten seit geraumer Zeit<br />
hoch im Kurs. Gestampfter Lehm ist aber<br />
nicht nur aus optischer Sicht ein echter<br />
Hingucker, es sind allen voran die positiven<br />
Eigenschaften im Bezug auf das Raumklima,<br />
die überzeugen. Im Außenbereich besticht<br />
Lehm durch seine Licht- und Farbechtheit,<br />
die sich mit dem Alterungsprozess sogar<br />
in ihrer Leuchtkraft noch verstärkt. Ein<br />
Vermoosen oder Pilzbefall sind dann ausgeschlossen,<br />
wenn die Stampflehmwände<br />
konstruktiv witterungsgeschützt sind.<br />
Die Lehmbauteile können bei Verwendung<br />
des Aushubmaterials „direkt aus der Erde”<br />
geformt werden. Erfordert eine knappe<br />
Bauzeit den Einsatz von Fertigteilelementen,<br />
wird Stampflehm modulweise und<br />
vorgetrocknet in Form von individuellen<br />
Teilelementen – auch als dünnere Stampflehmschale<br />
– auf die Baustelle geliefert und<br />
direkt verbaut.<br />
Ein weiteres interessantes Anwendungsgebiet<br />
sind Stampflehmböden. Mit ihrer<br />
heterogenen Oberflächenerscheinung<br />
und den vielen feinen Mikrorissen wirken<br />
die Böden trotz ihrer extremen Härte und<br />
Strapazierfähigkeit eher weich und lebendig.<br />
Wird der fertige Boden mit einem<br />
Diamantflächenschleifer leicht abgeschliffen,<br />
entsteht ein terrazzoähnlicher Effekt.<br />
Eine Imprägnierung mit Kasein und Wachs<br />
macht den Boden zu einem pflegeleichten<br />
Belag für den Wohnraum. Die Herstellung<br />
allerdings erfordert langjährige Erfahrung,<br />
eine Reihe an Arbeitsschritten und mehrere<br />
Wochen Zeit.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
95<br />
Lehm als Baustoff<br />
Abgesehen von der baulichen Seite, bietet<br />
der Lehm auch eine Vielzahl an Möglichkeiten,<br />
Wohnräume behaglich und mit einem<br />
gesundheitlich unbedenklichen Material zu<br />
gestalten. So lassen sich bestehende Räume<br />
durch das nachträgliche Auftragen von<br />
Lehmputzen einfach und kostengünstig<br />
aufwerten: Eine verbesserte Luftfeuchteregulierung,<br />
angenehmere Akustik und weniger<br />
Staub sind nur einige der positiven Effekte.<br />
Besondere Behaglichkeit bieten auch<br />
Öfen aus Lehm. Ob als Fertigelement oder<br />
individuell gestaltet – Lehmöfen speichern<br />
die Wärme hervorragend und sorgen so bei<br />
geringer Heizlast für angenehm temperierte<br />
Wohnräume.<br />
Zu guter Letzt lassen sich aus Lehm auch<br />
Fliesen oder Wohngegenstände wie Waschbecken<br />
fertigen. Verschiedene Brenntechniken<br />
ergeben nicht nur optisch variierende<br />
Ergebnisse, sondern machen jedes Stück<br />
zum individuellen Objekt mit ganz eigenem<br />
Charakter. Gerade in dieser Lebendigkeit<br />
liegt die große Stärke des Baustoffes Lehm,<br />
der im wahrsten Sinne des Wortes mit den<br />
Händen greifbar ist. Erde zu Erde, wenn<br />
man so will.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
96<br />
Licht<br />
Der Stephansdom<br />
im neuen Licht<br />
Für die Lichtplanung „Der Stephansdom zeigt sich im neuen Licht“ wurde<br />
podpod design im Mai <strong>2019</strong> vom Deutschen Lichtdesignpreis der Sonderpreis<br />
der Jury verliehen.<br />
Text und Fotos: podpod design – Iris und Michael Podgorschek<br />
Der Wiener Stephansdom hat zum ersten<br />
Mal in seiner Geschichte mit dem von<br />
podpod design ausgearbeiteten Lichtkonzept<br />
eine flexible und hochwertige, multifunktionale<br />
Beleuchtung im gesamten<br />
Innenraum erhalten. Diese Planung und<br />
Umsetzung wurde erst durch innovative<br />
LED-Technologie ermöglicht. Mit dem Einsatz<br />
präziser Optiken bei guter Blendungsbegrenzung<br />
und programmierbarer Lichtszenen<br />
kann mit geringem Energieeinsatz<br />
von ca. 3W/m² das gewaltige Raumvolumen<br />
energieeffizient bespielt werden.<br />
Licht ist Berührung<br />
Die Planung der neuen Beleuchtung für den<br />
Wiener Stephansdom ist sicherlich eine der<br />
herausforderndsten Aufgaben, die sich ein<br />
Lichtplaner wünschen kann. Im ehrwürdigen<br />
gotischen Gemäuer mit seiner jahrhun-
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
97<br />
Licht<br />
dertealten Geschichte fand man eine Beleuchtung<br />
vor, die zweckmäßig gewachsen,<br />
aber dennoch ein fremdes Element im Raum<br />
war. Der Vision der Planer folgend, hat man<br />
alle störenden Lichtquellen entfernt und<br />
Leuchten entwickelt, die dezent in den Hintergrund<br />
treten, um nur mit ihrer Lichtwirkung<br />
den Dom selbst in seiner Würde erlebbar<br />
zu machen. Das präzise gelenkte Licht<br />
berührt die Figuren und Altäre und zeigt<br />
die gotischen Säulen erstmals in ihrer ganzen<br />
Höhe. Es moduliert das Raumvolumen<br />
durch die Deckenaufhellung und ermöglicht<br />
auch funktionales Direktlicht nach unten.<br />
Der Dom wurde ursprünglich nur durch<br />
das, durch polychrome Glasfenster einfallende,<br />
veränderliche Tageslicht und Kerzen<br />
beleuchtet. So zeigte er seine mystische<br />
Seite. Im Barock hat man ihn mit Maria-Theresien-Lustern<br />
ausgestattet – diese waren<br />
ursprünglich noch mit Kerzen bestückt und<br />
wurden im Zuge der Elektrifizierung mit<br />
Glühbirnen ausgestattet. Als Finalisierung<br />
der neuen Beleuchtung hat man sie in diesem<br />
Sommer gänzlich auf ästhetisch anspruchsvolle<br />
LED-Kerzen umgerüstet.<br />
Das Lichtkonzept<br />
Die große Bandbreite der Nutzung (Messen,<br />
Abendandachten, Konzerte, Führungen<br />
oder Kunstinstallationen) erforderte<br />
eine hohe Flexibilität. Sämtliche Leuchten<br />
sind in LED-Technik ausgeführt und in ein<br />
technisch komplexes, jedoch auch von Laien<br />
leicht zu bedienendes, Lichtsteuerungssystem<br />
eingebunden. Das Lichtkonzept<br />
setzt sich daher aus mehreren funktionalen<br />
Ebenen zusammen, die im Zusammenspiel<br />
die jeweiligen Lichtszenen ergeben:<br />
Licht zum Sehen – Grundlicht<br />
Das Grundlicht bildet die Basis für die funktionale<br />
Nutzung des Doms. Es dient der Orientierung<br />
und der sicheren Bewegung im<br />
Kirchenraum und ermöglicht die liturgische<br />
Nutzung durch ein ausreichendes Lichtniveau<br />
in den Bankreihen.<br />
Licht für den Raum I – Deckenaufhellung<br />
Die Deckenaufhellung schafft einen Ausgleich<br />
der starken Kontraste während der<br />
Tagesstunden, lenkt die Aufmerksamkeit<br />
auf sehr subtile Weise und erlaubt die Veränderung<br />
der Gewichtung des wahrgenommenen<br />
Raumvolumens.<br />
Licht für den Raum II – Säulenaufhellung<br />
Die Säulenaufhellung verbindet in ihrer<br />
Vertikalität Boden und Decke, erzeugt eine<br />
räumliche Tiefe und schafft ein sehr ausgewogenes<br />
Erscheinungsbild im gesamten<br />
Innenraum.<br />
Objektlicht – Akzentuierung<br />
der Altäre und Figuren<br />
Die Akzentuierung der Altäre und Figuren<br />
zeigt erst die Vielzahl der im Kontext des<br />
Doms bedeutenden Persönlichkeiten. Sie<br />
ermöglicht auch die selektive Betonung von<br />
Elementen und Themen, je nach Situation<br />
und Zeitpunkt. Durch Licht lassen sich Altäre<br />
für Messen aktivieren, oder in der Osterzeit<br />
die Kreuzwegstationen sichtbar machen.<br />
Mystisches Licht – Kerzenlicht<br />
auf Lustern und Altären<br />
Die Kerzenluster sind nicht nur Teil der festlich-prunkvollen<br />
Beleuchtung, sie können<br />
auch im Zusammenspiel mit den Altarkerzen<br />
sehr intime, meditative und mystische<br />
Lichtstimmungen erzeugen, die den Raum<br />
mehr spürbar als sichtbar erscheinen lassen.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
98<br />
Produkt News<br />
Licht, das Welten verbindet<br />
In einem der Altstadthäuser in Freiburg, zwischen denkmalgeschützten Wandfresken<br />
und bemalten Holzdecken, bietet das traditionsbewusste Schuhhaus<br />
Lüke heute seine exquisiten Schuhmoden in einem historischen Ambiente an. Für<br />
dieses Kleinod unter den Ladenlokalen schuf Ansorg ein einzigartiges Beleuchtungskonzept.<br />
Es besteht nicht nur aus Licht, Leuchten und Technik, sondern<br />
auch aus Design, Stil und Einfühlungsvermögen und weist auf die ursprüngliche<br />
Funktion des Raums als Rittersaal hin. Bei den farblich gefassten Holzdecken<br />
durfte es nur zu minimalen Eingriffen an der historischen Bausubstanz kommen.<br />
Die niedrigen Rundbogen-Schaufenster erstrahlen<br />
heute im Licht kompakt designter Leuchten. Speziell<br />
für solche Raumsituationen hat man die Leuchte<br />
Coray CXS entwickelt. Unter den Decken sorgen frei<br />
dreh- und schwenkbare Leuchten für viel Flexibilität<br />
und ein stets einheitliches Erscheinungsbild. Es<br />
bleibt in jeder Beleuchtungssituation zurückhaltend<br />
homogen, da für die unterschiedlichen Aufgaben lediglich<br />
der innenliegende Reflektor angepasst werden<br />
muss. Das Licht aus den stilvollen Deckenleuchten<br />
lässt die Farben der Wandfresken dynamisch<br />
erstrahlen und sorgt für blendfreie Glanzpunkte auf<br />
dem präsentierten Schuhwerk. Sie hängen an filigranen<br />
schwarzen Stromschienen, die sich wie dünne<br />
Schnürsenkel über die Decke ziehen. Diese sind nur<br />
dort, wo es die Stabilität unbedingt erfordert, in der<br />
Holzdecke verankert, und tragen gleichzeitig die Deckenbeleuchtung.<br />
Für den Besucher unsichtbar, verlaufen<br />
auf ihrer Oberseite speziell an dieses Ladenlokal<br />
angepasste LED-Streifen. Die unterschiedlichen<br />
Farben und Muster der Decke kommen in schonendem<br />
Licht kontrastreich zur Geltung.<br />
Ansorg GmbH<br />
T +49 (0)208 4846-0<br />
info@ansorg.com<br />
www.ansorg.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
99<br />
Produkt News<br />
Universalgenie unter<br />
den Polstermöbeln<br />
Mit ray soft bietet Selmer einen universell einsetzbaren Polstersessel für Restaurants,<br />
Konferenzräume, Cafeterien und Büros. Ideal für alle, die auf ein starkes<br />
Designstatement setzen und auf höchsten Sitzkomfort Wert legen.<br />
Das Design von ray soft stammt aus der Feder des<br />
legendären Designerduos jehs+laub und zeichnet<br />
sich durch schlichte Eleganz und moderne Formgebung<br />
aus. Dank seiner großen Vielfalt an exklusiven<br />
Materialien lässt sich der Polstersessel individuell an<br />
die jeweilige Architektur anpassen, ohne dabei seine<br />
eigenständige Formensprache zu verlieren. Ziernähte<br />
und eine umlaufende, optional auch farblich<br />
abgesetzte, Kedernaht unterstreichen das exklusive<br />
Understatement.<br />
Sitzmöbel gestalten Räume entsprechend der jeweiligen<br />
Anforderungen und unterstreichen dabei<br />
auch die Architektur. Mit dem modularen Aufbau<br />
der Polsterstühle ray soft ist ein harmonisches Gesamtkonzept<br />
auch dann einfach umsetzbar, wenn<br />
an die Sitzgelegenheiten innerhalb eines Raumes<br />
unterschiedliche Anforderungen gestellt werden.<br />
Drei verschieden hohe Sitzschalen können mit vier<br />
unterschiedlichen Gestelltypen kombiniert werden.<br />
Ob ein Vierfußgestell aus Eichenmassivholz, ein<br />
Kufengestell aus Vollstahl oder ein Fußkreuz aus<br />
Aluminium-Druckguss bevorzugt wird, mit ray soft<br />
lassen sich Raumkonzepte und auch Stilrichtungen<br />
perfekt unterstreichen.<br />
Die schlanke Vollpolsterschale des ray soft trägt wesentlich<br />
zur einnehmenden Optik der Stühle bei. Die<br />
integrierten Armlehnen und die hochwertige Polsterung<br />
sorgen aber auch für höchsten Sitzkomfort.<br />
Deshalb ist der universal einsetzbare Polstersessel<br />
von Selmer nicht nur in Büros und Konferenzräumen<br />
ein beliebtes Sitzmöbel, sondern auch eine ideale<br />
Lösung für Cafeterien und Restaurants. ray soft findet<br />
überall seinen Platz – und lädt selbst ein, einfach<br />
Platz zu nehmen.<br />
Selmer GmbH<br />
T +43 (0)6216 20210<br />
info@selmer.at<br />
www.selmer.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
100<br />
Produkt News<br />
Luxuriös und charakterstark<br />
Schwarze Akzente in der Badgestaltung sind modern und wirken luxuriös. Sie<br />
verleihen dem Bad einen designstarken Charakter. KEUCO bietet für die Badmöbel<br />
der EDITION 11 eine neue Oberfläche in Schwarz gebürstet an, mit der besonders<br />
schön die Armaturen und Accessoires in Schwarzchrom harmonieren.<br />
Neben Waschtischunterschänken sind<br />
Side boards, Hochschränke und Unterbauschränke<br />
in der besonderen Oberfläche<br />
erhältlich. Der edle, mattschwarze Look<br />
strahlt eine geheimnisvolle Extravaganz<br />
aus und gibt dem Bad gleichzeitig eine behagliche<br />
Atmosphäre. Die haptisch ausgesprochen<br />
angenehme, samtmatte Qualität<br />
zeichnet sich durch besondere Unempfindlichkeit<br />
und Pflegeleichtigkeit aus.<br />
Die samtmatte Lackoberfläche der Möbel<br />
mit einem leichten Metallic-Schimmer<br />
passt perfekt zu den exklusiven IXMO-<br />
Dusch armaturen sowie EDITION 400 und<br />
EDITION 11 Armaturen und Accessoires<br />
in Schwarzchrom gebürstet. Die Waschtisch-Armaturen<br />
erhalten auf den weißen<br />
Keramik-Waschtischen der Serie maximale<br />
Aufmerksamkeit. Zudem bilden sie einen<br />
eleganten Kontrast. Für ein stimmiges Bild<br />
setzt der ROYAL LUMOS Lichtspiegel, mit<br />
umlaufendem Rahmen in schwarz eloxiert,<br />
ein leuchtendes Highlight. Die zwei LED-Beleuchtungs-Quellen<br />
– Hauptbeleuchtung<br />
und Waschtischbeleuchtung – lassen sich<br />
über das intuitive Bedienpaneel dimmen<br />
und in der Lichtfarbe stufenlos einstellen.<br />
Optional ist der Spiegel mit praktischer<br />
Spiegelheizung erhältlich. Für den letzten<br />
Schliff der dunkel akzentuierten Badgestaltung<br />
sorgt der iLook_move Kosmetikspiegel<br />
ebenfalls mit schwarz gebürsteter<br />
PVD-Oberfläche.<br />
Abgestimmt im Design und mit durchgängig<br />
schwarzmatten Oberflächen in metallischer<br />
Optik entsteht eine luxuriöse<br />
Badausstattung in der gehobenen Innen<strong>architektur</strong>.<br />
KEUCO GmbH<br />
T +43 (0)662 45 40 56-0<br />
office@keuco.at<br />
www.keuco.com<br />
www.ixmo.de
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
101<br />
Produkt News<br />
Das Komplettbad<br />
Der europäische Marktführer für Sanitärprodukte bietet – neben den bewährten<br />
Systemlösungen hinter der Wand – zeitgemäßes Design vor der Wand, insbesondere<br />
in Form von durchdachten Komplettbädern mit hohem Qualitätsanspruch.<br />
Die neu gestaltete Badserie Geberit Smyle etwa präsentiert sich in schlanker,<br />
eleganter, top-moderner Anmutung.<br />
Dank einer Vielfalt an soft-organischen und soft-geometrischen<br />
Waschtischen, WCs und Bidets sowie frei<br />
kombinierbaren Wandablagen, Seiten-, Mittelhochund<br />
Waschtischunterschränken kann die Komplettbad-Serie<br />
auf eine attraktive Sortimentsbreite verweisen.<br />
Auch farblich gibt es viel Spielraum: „Weiß<br />
hochglänzend“, „Lava matt“, „Sandgrau hochglänzend“<br />
und „Nussbaum hickory“ heißt hier die Qual<br />
der Wahl. Da auch die Griffleisten die Farben der Möbelfronten<br />
aufgreifen, ergibt sich ein bestechend elegantes<br />
Badambiente. Keramik und Möbel sind dabei<br />
so optimal aufeinander abgestimmt, dass die individuelle<br />
Kombination spielend gelingt.<br />
Die Smyle WCs und Bidets lehnen sich in ihrer Formensprache<br />
jeweils an die Waschtische an. Neu im<br />
Sortiment sind ein Wand-WC und Bidet mit geometrisch-geradlinigem<br />
Design. Sie haben eine komplett<br />
geschlossene Außenform und sind daher besonders<br />
reinigungsfreundlich. Hygienisch und leicht sauber<br />
zu halten ist auch das spülrandlose Innenbecken. Der<br />
WC-Sitz ist in zwei schlanken Design-Varianten erhältlich,<br />
wahlweise als Modell mit Absenkautomatik<br />
oder zusätzlich mit Quick-Release-Funktion, die ein<br />
einfaches Abnehmen ermöglicht. Mit diesen Features<br />
stellt der Hersteller sein Markenversprechen „Design<br />
Meets Function“ einmal mehr eindrücklich unter Beweis<br />
und überzeugt in puncto Qualität und Optik.<br />
Geberit Vertriebs GmbH<br />
& Co KG<br />
T +43 (0)2742 401 0<br />
sales.at@geberit.com<br />
www.geberit.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
102<br />
Produkt News<br />
Ein redesignter Longseller<br />
Mit power #5 bringt Conform Badmöbel einen redesignten Longseller auf den Markt,<br />
der mit einem vollkommen neuen, progressiven modularen Konzept den modernen<br />
ästhetischen Ansprüchen und technischen Möglichkeiten angepasst wurde. Zu<br />
erwarten ist ein eigenständiges, äußerst vielseitiges Planungsprogramm mit neuen<br />
architektonischen Formen und praktischer Funktionalität im unteren bis mittleren<br />
Preissegment, mit klarer Linienführung – präzise, funktionell und ausdrucksstark.<br />
Stilprägend sind die neuen Keramik-Waschtische sowie<br />
ein variantenreiches Allover-Spiel mit offenen und<br />
geschlossenen Flächen. Die Waschtische bilden eine<br />
prägnante Beckenkumme, die durch einen ultradünnen<br />
Rand gefasst ist und sind in Einzel- und Doppelausführung,<br />
jeweils mit durchgängigem Becken sowie<br />
symmetrischen und asymmetrischen Formen mit<br />
großzügigen Seiten- und Mittelablagen erhältlich. Die<br />
charakteristische Formensprache von power #5 zeigt<br />
sich in variantenreichen Schrankmöbeln mit offenen<br />
Seiten- und Frontregalen, die ein Maximum an Stauraum<br />
und Präsentationsfläche bieten. Dass die serientypischen<br />
Eigenschaften von Leichtigkeit, Eleganz<br />
und Variabilität auch die weitere Waschplatzausstattung<br />
kennzeichnen, zeigt sich beispielsweise an den<br />
Spiegelschränken: 15 verschiedene Lösungen, symmetrische<br />
und asymmetrische Formen, klassischer Spiegelschrank<br />
oder dreidimensionaler Leuchtspiegel, mit<br />
oder ohne Regale und ein smartes Beleuchtungskonzept,<br />
das sowohl Raum als auch Regale spannungsreich<br />
illuminiert.<br />
Das umfangreiche Neuheiten-Programm wurde erstmalig<br />
heuer auf der Energiesparmesse Wels vorgestellt.<br />
Auf einem großen Gemeinschaftsstand mit den<br />
Traditionsunternehmen Hansgrohe und Artweger<br />
zeigte der Produzent in zehn attraktiven Kojen einen<br />
repräsentativen Querschnitt aus der Kollektion <strong>2019</strong>.<br />
Messe-Highlights waren neben der programmatischen<br />
Serie power #5 auch die mehrfach prämierten<br />
Designserien Foqus, Xanadu und TiAmo sowie die<br />
Kollektion Riva_Hotel, die nun authentische Formen<br />
mit innovativen, natürlichen Oberflächen aus Heu und<br />
Heublumen verbindet. Mit einem neuen Messekonzept,<br />
das neben dem Fachpublikum auch verstärkt<br />
den privaten Besucher einbezieht, hat man vielfältige<br />
Anstrengungen unternommen, um die bisher bereits<br />
äußerst erfolgreichen Auftritte auf Österreichs wichtigster<br />
SHK Messe zu toppen.<br />
CONform Badmöbel GmbH<br />
T +43 (0)5412 63493<br />
office@conformbad.at<br />
www.conformbad.at<br />
www.conform-partnersystem.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
103<br />
Produkt News<br />
Spektakulär in Form und Format<br />
Ohne Anfang und Ende, ohne Ecken und Kanten: Der Kreis ist die vollkommenste<br />
und ausgewogenste Figur in der Geometrie. Bei den neuen Badewannen<br />
BettePond und BettePond Silhouette kombiniert Bette diese perfekte, puristische<br />
Form mit dem perfekten Material im Bad – dem glasierten Titan-Stahl.<br />
Entworfen wurde die kreisrunde Badewanne von<br />
Dominik Tesseraux (Tesseraux + Partner, Potsdam)<br />
als Reminiszenz an die Ursprungsform des Wannenbades,<br />
den Badezuber. Mit einem Durchmesser von<br />
großzügigen 150 Zentimetern, die sich bequem in<br />
jede Richtung nutzen lassen, ist die runde Badewanne<br />
der ideale Ort für Muße und Entschleunigung im<br />
Alltag – und ein echter Ruhepol im Bad. Der Kreis ist<br />
ein Ursymbol der Menschheit und steht für Harmonie,<br />
Unendlichkeit und Eins-Sein und das beschreibt<br />
das Erlebnis beim Baden sehr treffend: Denn beim<br />
Entspannen im warmen Wasser bleibt die Zeit beinahe<br />
stehen und wir finden zu uns selbst.<br />
Je nach Raum<strong>architektur</strong> und Platz kann die Wanne<br />
entweder frei stehend oder als Einbauversion zum<br />
Einsatz kommen. Die frei stehende Version trägt den<br />
Namenszusatz Silhouette und bietet sich als ein bewusst<br />
eingesetztes Stilmittel in der Bad<strong>architektur</strong><br />
an, deren Wirkung sie unterstützen oder zu der sie<br />
einen Kontrapunkt setzen kann. Allein schon durch<br />
ihre schiere Präsenz, die sich aus dem Volumen des<br />
zylindrischen Körpers, dem edlen Material und der<br />
makellosen, brillanten Oberfläche speist, zieht sie<br />
bewundernde Blicke auf sich und lenkt die Blickrichtung<br />
im Bad – das Wannenbad wird zur Bühne.<br />
Um das einladende Rund aus glasiertem Titan-Stahl<br />
zu realisieren, war Meisterschaft in der Produktion<br />
gefordert. In seiner Reduktion wirkt der Kreis als<br />
Form zwar simpel, die Herstellung einer Badewanne<br />
aus dem robusten Werkstoff fordert jedoch profundes<br />
Material- und Fertigungs-Know-how. Eine runde<br />
Form mit einem Durchmesser von 150 Zentimetern<br />
und die fugenlose Verbindung von innerer und äußerer<br />
Form erfordert ein hohes Maß an Kunstfertigkeit<br />
in der Verarbeitung von glasiertem Titan-Stahl. Das<br />
absolut hygienische Material ist nicht nur äußerst<br />
langlebig, sondern zeichnet sich durch seine hautsympathischen<br />
Eigenschaften, dauerhafte Farbbeständigkeit<br />
und Unempfindlichkeit gegenüber Kosmetika<br />
und Badezusätzen aus.<br />
Bette GmbH & Co. KG<br />
T +49 (0)5250 511-0<br />
<strong>architektur</strong>@bette.de<br />
www.bette.de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
104<br />
Produkt News<br />
Matte Optik, natürliche Haptik<br />
Mit dem innovativen Material DUSCHOLUX Bestone erfüllt die neue Rechteckwanne<br />
Formia höchste Ansprüche an geradliniges Design und Komfort. Ob als<br />
frei stehende Variante oder mit Wandanschluss – sie überzeugt mit matter Optik,<br />
natürlicher Haptik und einem mittigen, bündig abgedeckten Ablauf.<br />
Dieses Material sorgt auch bei den analog entwickelten<br />
Duschböden Savona für ein angenehmes<br />
Gefühl und einen sicheren Stand. Der flache Duschboden<br />
besitzt eine Ablaufabdeckung in Wannenfarbe<br />
und wird in vielen gängigen Größen in den<br />
Farbnuancen Weiß und Zement Grau gefertigt.<br />
Die glatte, antibakterielle Oberfläche ist einfach zu<br />
reinigen und die Rutschsicherheit nach DIN 51097,<br />
Klasse C ist auch gewährleistet. Ebenso ist das Produkt<br />
chemikalienresistent nach DIN EN 14527 und<br />
temperaturschockresistent nach DIN EN 14527.<br />
Die rahmenlose und mehrfach ausgezeichnete Duschwand<br />
Colletion 3 wird neu in der Variante Collection<br />
3C angeboten. Mit DUSCHOLUX CareTec<br />
Pro veredelt und innenbündige geschraubte Scharniere<br />
sind besonders reinigungsfreundlich und<br />
bieten Einstellmöglichkeiten, zusätzliche Verbauvarianten<br />
auch mit Spiegelglas. Standard-Glashöhe<br />
2000 mm bis 2200 ist auch in Kombination mit<br />
Unterputz-Profilen möglich. Durch das neue Glas-<br />
Glas-Scharnier sind Sondergrößen und zusätzliche<br />
Verbauvarianten möglich.<br />
Duscholux GmbH & Co. KG<br />
T +43 7221 708 0<br />
duscholux@duscholux.at<br />
www.duscholux.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
105<br />
Produkt News<br />
TECTUS® Glas<br />
Ganzheitliches<br />
Beschlagsystem für<br />
Ganzglastüren<br />
Dampfbad mit System<br />
Den individuellen Dampfbadbau mit System revolutioniert Repabad und<br />
bietet ohne vorheriges Aufmaß individuelle maßgefertigte Dampfbäder<br />
an. Tonangebend sind die Dampfpaneele Atlanta, Malta, Ventura und<br />
Malmö. Sie bringen gewohnt starke Dampfbadleistung und Qualität ins<br />
Bad. Egal ob Ecke oder Nische von 90 x 90 cm bis zu 150 x 150 cm lassen<br />
sich die Dampfbad Systeme ohne vorheriges Aufmaß einfach einbauen.<br />
Wandanschlussprofile ermöglichen einen Toleranzausgleich von bis<br />
zu +/- 8 mm, sollten nach Verlegen des Wandbelags Korrekturen nötig<br />
sein. Die Dampfbadhöhe ist fest vorgegeben. Bei der Generatorleistung<br />
kann zwischen 3,2 kW, 4 kW und 6 kW gewählt werden. Bei Atlanta, Malta<br />
und Malmö werden die Armaturen bauseits gestellt. Ventura wird als<br />
Komplettpaket inklusive Armatur geliefert. Alle Dampfbadoptionen wie<br />
Infrarot, Sole, Farblicht- oder Aromatherapie sowie Nebeldüsen sind<br />
möglich und über die integrierten Bedienfelder intuitiv steuerbar. Ein ans<br />
Abwasser angeschlossenes integriertes Entkalkungssystem ist bei allen<br />
Dampfbädern Standard. Die Glasfront der Dampfbadpaneele ist in den<br />
Farben Dark Black, Obscure, Snow, Pearl, Coffee sowie auf Wunsch in allen<br />
RAL Tönen lieferbar. Beim Dampfbad Malmö wird die Dampfbadtechnik<br />
außerhalb der Dampfdusche platziert und der Generator vormontiert<br />
inklusive Abdeckhaube geliefert.<br />
repaBAD GmbH<br />
T +43 (0)800 29 35 18<br />
info@repabad.com<br />
www.repabad.com<br />
Ihr Kontakt<br />
Alexander Moser<br />
+43 664 / 167 2514<br />
www.tectus-glas.de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
106<br />
Produkt News<br />
Hotelumbau<br />
und Brandschutz<br />
Auf über 1.700 Metern Seehöhe, mitten im Skigebiet am Arlberg, befindet sich<br />
das Vier Sterne Superior Hotel Goldener Berg. Das Stammhaus wurde 1930 am<br />
Standort eines mittelalterlichen Bergbauernhofes errichtet und seitdem mehrfach<br />
umgebaut. 2018 standen das Interiordesign von zwölf Zimmern und Suiten<br />
inklusive der Erschließungswege sowie die Neugestaltung der Baukörper mit<br />
ihren Fassaden auf dem Programm. Wesentliche Aufgabe waren dabei auch die<br />
thermische Sanierung des gesamten Hauses und die Umsetzung eines zeitgemäßen<br />
Brandschutzkonzepts. Wir sprachen mit Architekt Christian Prasser von cp<br />
<strong>architektur</strong> über aktuelle Anforderungen, Planungstipps und konkrete Maßnahmen<br />
zum Brandschutz im Hotel Goldener Berg.<br />
Wann haben Sie mit der Planung des<br />
Umbaus begonnen?<br />
Der jüngste Relaunch in Kooperation mit<br />
cp <strong>architektur</strong> erfolgte in zwei Phasen. Die<br />
erste Bauphase erstreckte sich vom Planungsbeginn<br />
im Jänner 2013 bis zur Fertigstellung<br />
im Juni 2014. Die zweite Bauphase<br />
rund um Brandschutz und thermische Sanierung<br />
begann mit der Planung ab Juni<br />
2017 und wurde Anfang <strong>2019</strong> fertiggestellt.<br />
Inwieweit wurde die Historie des Hauses<br />
berücksichtigt?<br />
Bewusst werden die Gestaltungselemente<br />
der verschiedenen Bauphasen des Goldenen<br />
Bergs zitiert und wieder aufgenommen.<br />
Bilder an die 30er- und 60er-Jahre werden<br />
geweckt, als der Goldene Berg in Oberlech<br />
zu den Pionieren der alpinen Hotel<strong>architektur</strong><br />
gehörte. Als Elemente der traditionellen<br />
Alpin<strong>architektur</strong> werden auch die weit<br />
vorkragenden Dachflächen durch vertikale<br />
Schrägbalken gestützt.<br />
Wie hat sich das Design des Hauses<br />
im Innenbereich verändert?<br />
Im Inneren wurde der Bestand saniert und<br />
bekam durch neue Gestaltungselemente ein<br />
zeitgemäßes Erscheinungsbild. Entlang der<br />
Gänge erstreckt sich zum Beispiel als hochgezogene<br />
Sockelleiste das abstrahierte Lecher<br />
Bergpanorama.<br />
Ergaben sich dabei auch Synergien in<br />
Bezug auf den Brandschutz?<br />
Ja, zum Beispiel bei der Neugestaltung der<br />
Erschließungswege. Die neue indirekte Be-<br />
leuchtung in den Gängen ermöglichte etwa<br />
die Installierung einer Kabeltrasse, in der die<br />
Brandmeldeanlage aller Bestandszimmer<br />
geführt wird.<br />
Inwieweit spielt der Brandschutz bei<br />
Umbauten eine Rolle?<br />
Es ist ganz klar, dass in den Brandschutz<br />
laufend nachinvestiert werden soll, bzw.<br />
Gebäude bewusst überprüft werden sollten,<br />
damit die Sicherheit für Gäste und MitarbeiterInnen<br />
bestmöglich gewahrt bleibt.<br />
Gerade im Bestand wird zumeist in der Hotellerie<br />
themenbezogen saniert, zum Beispiel der<br />
Zimmertrakt, der Gastronomiebereich oder<br />
der Wellnessbereich. Sinnvoll ist dabei abschnittweise<br />
– entsprechend einzelner Brandabschnitte<br />
– den Brandschutz zu überprüfen<br />
und auf den Stand der Technik zu bringen.<br />
Was hat sich in Bezug auf Brandschutz in<br />
den letzten Jahren wesentlich verändert?<br />
Aufgrund der Normen bezüglich Gebäudedämmung<br />
ist der Brandschutz um einiges<br />
komplexer geworden, da Brandüberschläge<br />
mit den Dämmmaterialien abgestimmt werden<br />
müssen bzw. der jeweiligen Brandlast<br />
standhalten müssen, was auch in einer geschlossenen<br />
Verbauung gebäudeübergreifend<br />
zu bedenken ist.<br />
Weiters nimmt der Grad an Gebäudetechnik<br />
insbesondere bei Sanierungen enorm zu,<br />
wodurch auch hier Brandabschottung im<br />
Gebäude zu einem komplexeren Planungsaufwand<br />
wird.<br />
Läuft man ohne Investition Gefahr, Vorschriften<br />
zu verletzen und Strafen zahlen zu<br />
müssen?<br />
Baurechtlich ist ein Gebäude nach Stand<br />
der Technik zum Zeitpunkt der Baugenehmigung<br />
bzw. der Umsetzung auszuführen.<br />
Wird ein Gebäude nicht saniert und entsprechen<br />
die Grundlagen des Bauwerkes nicht<br />
mehr dem Stand der Technik, kann der Hotelier<br />
zivilrechtlich sehr wohl verklagt bzw.<br />
durch das Arbeitsinspektorat mit Strafen<br />
konfrontiert werden.<br />
Wo kann ich mich informieren und gegebenenfalls<br />
auch Förderungen beantragen?<br />
Die Arbeitsinspektion kontrolliert die Einhaltung<br />
der Vorschriften zum ArbeitnehmerInnenschutz<br />
vor Ort in den Betrieben und auf<br />
Baustellen. In Genehmigungsverfahren z. B.<br />
von gewerblichen Betriebsanlagen ist sie als<br />
Partei beteiligt und achtet auf die Aspekte
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
107<br />
Produkt News<br />
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes<br />
bei der Arbeit. Sie führt aber auch Beratungen<br />
durch.<br />
Förderungen gibt es für die Hotellerie aber<br />
auch in einzelnen Bundesländern. Wichtig<br />
ist, dass diese zumeist vor Projektstart beantragt<br />
werden sollten.<br />
Was empfehlen Sie in Bezug<br />
auf die Planung?<br />
Sinnvoll ist hier, von Anfang an einen Brandschutzbeauftragten<br />
mit in das Planungsteam<br />
zu nehmen und die Absichten bzw.<br />
auch einen Phasenplan mit der Behörde und<br />
dem Arbeitsinspektorat bzw. der Feuerwehr<br />
abzuklären.<br />
Und welche Maßnahmen würden Sie darüber<br />
hinaus dem Hotelier ans Herz legen?<br />
Wichtig ist, dass im Hotel ein Teammitglied<br />
über die Grundlagen des Brandschutzes informiert<br />
ist und hierfür eine laufende Fortbildung<br />
erfährt.<br />
Als sehr positiv erachte ich außerdem eine<br />
simple Einschulung über die Verwendung<br />
von Feuerlöschern und Erstmaßnahmen im<br />
Zuge eines Brandfalles für das ganze Team.<br />
Ein Fluchtwegplan in den Zimmern kann Leben<br />
retten und sollte daher als Gestaltungselement<br />
sichtbar und grafisch ansprechend<br />
montiert werden und eventuell auch in mehreren<br />
Sprachen verfasst sein, abhängig von<br />
der jeweiligen Klientel.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
108<br />
Produkt News<br />
Perfekter Brandschutz<br />
bei Holzkonstruktionen<br />
Neuerungen in der Landesbauordnung Baden-Württemberg hinsichtlich des Brandschutzes<br />
erlauben seit 2015, dass auch im mehrgeschossigen Holzbau Decken,<br />
tragende und aussteifende Wände sowie Stützen aus Holz sichtbar und unverkleidet<br />
bleiben dürfen. Das bedeutet, dass es auch bei Wohngebäuden bis zu 13 Meter<br />
Höhe möglich ist, Brettsperrholzkomponenten mit ihrer besonderen Sichtqualität<br />
und effektiven Akustikprofilen zu verwenden. Laut Brandschutzexperten darf in<br />
Österreich diese Bauweise auch verwendet werden (siehe HOHO mit 83 Meter<br />
Höhe in Wien Aspern), sofern ein geeignetes Brandschutzkonzept vorliegt.<br />
Fotos: Lignotrend, Foto&Design<br />
Die zwei Mehrfamilienwohnhäuser im Riedpark, der<br />
Entwurf stammte von Architekt Jörg Kaiser, beherbergen<br />
sechzehn Wohneinheiten unterschiedlicher<br />
Größe und sind als Zwei- und Dreispänner organisiert.<br />
Für tragende Wände mit einer erforderlichen<br />
Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten kamen<br />
Rippenelemente in hohlraumloser Ausführung zum<br />
Einsatz, deren Zwischenräume mit Glaswolle ausgefacht<br />
sind. Der flächige Feuerwiderstand konnte<br />
über Gipskarton-Feuerschutzplatten hergestellt werden.<br />
Dabei wurde an den Ecken der Plattenstoß der<br />
Brandschutz in doppeltem Versatz ausgebildet. Für<br />
Steckdosen, Lichtschalter und andere Stellen, an denen<br />
die Gipskartonplatte durchdrungen wird, entwickelte<br />
man eine praktikable, im Wandinneren brand-<br />
schutzgerecht abgeschottete Elektroinstallation, in<br />
die einfache Hohlraumdosen eingebaut werden können.<br />
In diesem Bereich ist das tragende Holzbauteil<br />
hinter der Gipskartonplatte durch intumeszierende<br />
(aufschäumende) Materialien in Form von passgenau<br />
vorgestanzten Folien und entsprechend behandelten<br />
Holzklötzen geschützt, damit Feuer nicht über<br />
die Steckdosen ins Wandinnere eindringen kann. Alle<br />
Wohnungstrennwände im Riedpark sind zweischalig<br />
konstruiert. Eine Dichtungsbahn, die geschossweise<br />
unter den Wandschwellen hindurchgeführt ist und im<br />
Fußbodenaufbau zusammengeführt wird, verhindert<br />
den Rauchdurchgang zwischen den Wohnungen – vor<br />
allem an den Knotenpunkten von Decke und Wand.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
109<br />
Produkt News<br />
Die Deckenbauteile sind mit ihren sichtbaren Holzoberflächen<br />
auch bezüglich des Innenausbaus<br />
endfertig. Der Feuerwiderstand ist rein über den<br />
theoretischen Holzabbrand gewährleistet. Die Decken-Elemente<br />
werden mit sogenannten Z-Lagen<br />
für den nötigen Feuerwiderstand konfiguriert und<br />
erhalten nach der Elektroinstallation zwischen ihren<br />
Rippen eine Kalksplittschüttung für den Schallschutz.<br />
Mit dem auch auf die tiefen Frequenzen der Gehgeräusche<br />
abgestimmten Aufbau entsteht ein im Brandschutzsinne<br />
hohlraumfreies Bauteil, das die strengen<br />
bauakustischen Anforderungen an den Schallschutz<br />
in Mehrfamilienhäusern sogar übertrifft.<br />
Die Untersicht der Decken ist je nach Anforderung<br />
gestaltbar – als geschlossene Holzfläche oder mit<br />
verschiedenen Akustikprofilen. Im Riedpark wurden<br />
die Deckenbauteile in den Wohnräumen mit Akustikprofilierung<br />
ausgeführt, in den Schlafzimmern teils<br />
ohne. In den Flurbereichen verbergen abgehängte<br />
Decken die Leitungen für das Lüftungssystem. Diese<br />
Planung ist wohnungsweise konzipiert, um auf wartungsintensive<br />
Brandschutzklappen zwischen den<br />
Wohnungen verzichten zu können: Die Lüftungsleitungen<br />
durchdringen die Brandschutzebenen nicht.<br />
Steigschächte für Wasserleitungen und die elektrische<br />
Leitungsführung hingegen mussten hochfeuerhemmend<br />
abgeschottet werden. Hierfür wurden<br />
verschiedene Brandschottlösungen eingesetzt, die<br />
trocken und damit einfach einzubauen und nachweislich<br />
auch für den Einbau in den verwendeten Rippendecken<br />
geeignet sind. Mit ebenfalls intumeszierendem<br />
Verhalten im Brandfalle sorgen sie dort für eine<br />
brandschutzgerecht perfekt isolierte Leitungsdurchführung.<br />
Ohne Gipsbekleidung kann damit ein Feuerwiderstand<br />
von 90 Minuten erreicht werden.<br />
Sogar die beiden Aufzugstürme und die Treppenhauswände<br />
konnten aus großformatigen Brettsperrholztafeln<br />
konstruiert werden, lediglich für die Treppenläufe<br />
kamen Betonfertigteile zum Einsatz. Damit<br />
der Treppenraum auch nach 60 Minuten als Fluchtweg<br />
genutzt werden kann und für die Feuerwehr als<br />
Rettungsweg bestehen bleibt, bekam auch die treppenhausseitige<br />
Wandschale eine entsprechende Beplankung<br />
mit Gipskarton-Feuerschutzplatten.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
REI 120 ab jetzt<br />
preisgleich zu R0<br />
Die Anzahl der Brände in Österreich ist in den letzten<br />
Jahren leicht gesunken. Dennoch verursachen Großbrände<br />
nach wie vor vielfachen Millionenschaden<br />
an Sachgütern, und leider sind immer wieder auch<br />
Menschen bedroht. Beim konstruktiven Hochbau<br />
sollte daher auf ein Höchstmaß an Sicherheit Wert<br />
gelegt werden. Um Planende und Ausführende dahingehend<br />
zu unterstützen, ihre Arbeit zu vereinfachen<br />
und zugleich die Sicherheit von Gebäuden zu<br />
erhöhen, bietet Schöck Österreich nun den Isokorb<br />
äquivalent auch in der Brandschutzklasse REI 120 an.<br />
Der Schöck Isokorbwird als gesamtes System inklusive<br />
der angeschlossenen Bauteile geprüft. Bauteilversuche<br />
finden in akkreditierten Zertifizierungsstellen<br />
in Österreich und anderen europäischen Ländern<br />
statt, welche diese gemäß den aktuellen Prüfnormen<br />
für Brandschutz durchführen. Die Brandschutzausführung<br />
besteht aus einem Zweikomponenten-System,<br />
das die bauphysikalischen Funktionen Wärmeschutz<br />
und Brandschutz getrennt ausführt. Der<br />
Wärmeschutz wird über den Dämmkörper gewährleistet,<br />
Brandschutz wird über eine obere und untere<br />
faserzementgebundene Brandschutzplatte mit seitlichen<br />
Quellbändern sichergestellt. Der Dämmkörper<br />
aus Neopor lässt keine Feuchtigkeits- oder Wasserzunahme<br />
zu, er kann also im Außenbereich uneingeschränkt<br />
eingesetzt werden. Bei Hybridsystemen, bei<br />
denen ein Material zwei Funktionen übernimmt, also<br />
110<br />
Wärme- und Brandschutz, kann dies nicht immer sichergestellt<br />
sein, da die äußeren Rahmenbedingungen<br />
einen Einfluss haben können.<br />
Schöck Bauteile Ges.m.b.H.<br />
T +43 (0)1 786 5760<br />
office@schoeck.at<br />
www.schoeck.at<br />
Produkt News<br />
Die Stärken von Steinwolle in Bild und Ton<br />
Steinwolle entsteht aus dem Rohstoff Basalt. Dank<br />
seiner besonderen Eigenschaften und der Verarbeitung<br />
auf modernen Fertigungsanlagen zu unterschiedlichsten<br />
Steinwolle-Dämmungen zeichnet sich<br />
dieses Material durch eine Reihe von Vorteilen aus.<br />
Eine Dämmung aus Steinwolle ist nicht nur eine nachhaltige<br />
Lösung von langer Lebensdauer. Sie bietet<br />
gleichzeitig einen hervorragenden Schall- und Brandschutz<br />
und leistet einen wertvollen Beitrag zur Wohngesundheit<br />
und Energieeffizienz von Gebäuden.<br />
Der Schmelzpunkt dieser Produkte liegt bei über<br />
1000°C und hilft somit, das Ausbreiten von Feuer zu<br />
verhindern. An Hand einer Testserie zu den sieben<br />
Stärken von Steinwolle kann man sich im Internet<br />
auf www.rockwool.at selbst überzeugen. Der erste<br />
Themenschwerpunkt der neuen Videoserie ist das<br />
besondere Plus an Sicherheit – der Brandschutz. Anschauen<br />
lohnt sich!<br />
ROCKWOOL HandelsgmbH<br />
T +43 (0)1 79726-0<br />
info@rockwool.at<br />
www.rockwool.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
111<br />
Produkt News<br />
Sesam öffne dich!<br />
Nicht durch Zauberhand, sondern dank modernster Technik öffnen und schließen<br />
sich die automatischen Schiebetüren EI30 von forster fuego light. Eine sichere<br />
Pforte im Nachtbetrieb sowie eine reibungslose Funktionalität im Tagesbetrieb<br />
werden mit maximaler Transparenz in einem Element vereint. Nachhaltige Sicherheit<br />
wird großgeschrieben, denn die Schiebetüren bieten zuverlässigen Brandschutz<br />
und Rauchschutz und überzeugen durch ihre Robustheit und Langlebigkeit.<br />
Automatische Schiebetüren sind praktisch, weil sie<br />
einen reibungslosen Personenverkehr in Durchgängen<br />
mit hohem Publikumsaufkommen gewährleisten.<br />
Zusätzlich lassen die Schiebekonstruktionen mit<br />
ihren schlanken Profilkonstruktionen aus Stahl und<br />
den großflächigen Gläsern viel Licht in die Räume<br />
fließen und bieten gleichzeitig maximale Transparenz<br />
für einen freien Durchblick. In kritischen Bereichen<br />
von Gebäuden halten die 4-seitig dicht schließenden<br />
Türen im Brandfall Flammen und Rauch<br />
zurück. So schützen sie Leben und Sachwerte, indem<br />
sie sich selbstständig und stromlos schließen. Beim<br />
Schließen der Türen bleibt immer gewährleistet, dass<br />
niemand verletzt oder eingeklemmt wird. Die forster<br />
fuego light Brandschutzschiebetüren mit Rauchschutz<br />
sind als 1- und 2-flügelige Varianten möglich<br />
und lassen sich in Massiv- und Leichtbauwände oder<br />
in Verglasungen einbauen.<br />
Forster Profilsysteme GmbH<br />
T +43 (0)2236 677 293<br />
at@forster.ch<br />
www.forster-profile.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
112<br />
Produkt News<br />
Gebändigter Brandschutz<br />
Maßgefertigte Türen mit Brandschutz sind heute so selbstverständlich wie Wärmedämmung<br />
und LED Beleuchtung. Sturm gehört zu den Initiatoren und Schrittmachern<br />
dieser Entwicklung und stellt Portfolios für Projekte zur Verfügung, die<br />
nach Einsatzbereichen gegliedert sind.<br />
Schon vor 30 Jahren erkannte man: Wer schöner<br />
wohnen, leben und arbeiten möchte, will sich die Sicherheit<br />
des Brandschutzes nicht mehr durch unförmige<br />
Eisentüren erkaufen. Mit der Lust junger Techniker<br />
am Auflösen von Zielkonflikten entstanden so<br />
die ersten Brandschutztüren aus Holz, die letztlich<br />
auch die größten Zweifler in den Testlabors überzeugen<br />
konnten. Seither ist man der Treiber einer Entwicklung,<br />
in der die Abhängigkeit des Tür-Designs<br />
von der Brandschutztechnik immer geringer wurde.<br />
Parallel dazu erhöhte sich die Komplexität: Normen<br />
und Vorschriften wurden verschärft und in den Architekturbüros<br />
entstanden neue Nutzungs- und<br />
Designkonzepte, die zusätzliche Anforderungen an<br />
Funktionselemente stellen.<br />
So hat man die Brandschutztür vollkommen gebändigt,<br />
die wilden grauen Urformen sind zu<br />
High-End-Lösungen geworden, deren Schutzfunktion<br />
der Nutzer nicht mehr wahrnimmt. Sie werden mit<br />
individuellen Maßen, Ausführungen und Oberflächen<br />
gefertigt, die Referenzen reichen vom noblen Palais<br />
Coburg in Wien bis zu den Green Buildings der neuen<br />
BORA-Unternehmenszentrale in Oberösterreich, für<br />
deren Innenraumplanung Simon Gafriller von werkhaus<br />
verantwortlich zeichnet.<br />
Die Komplettlösung von der Beratung und Detailplanung<br />
bis zur Maßfertigung und Montage – das war<br />
von Anfang an die Strategie des Herstellers. In weiterer<br />
Folge ist das Unternehmen dazu übergegangen,<br />
die Vielfalt der verfügbaren Konstruktionen nach<br />
Einsatzbereichen und ihren spezifischen Anforderungen<br />
zu gruppieren. So gibt es heute ein Brandschutztüren-Portfolio<br />
u.a. für Krankenhäuser und für<br />
Schulen, aber auch für Wohnbau, Hotels und Bürogebäude.<br />
In Projekten ist das der kurze Weg zu den<br />
benötigten Türen, denn auch erforderliche Ausführungen<br />
wie abgerundete Kanten oder stoßfeste Beschichtung<br />
sind bereits vorausgewählt. Unabhängig<br />
davon kann jedes Element mit weiteren Funktionen<br />
wie Rauchschutz oder Einbruchhemmung ausgestattet<br />
werden.<br />
STURM GmbH<br />
T +43 (0)6589 4215<br />
office@funktionstueren.eu<br />
www.funktionstueren.eu
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
113<br />
Produkt News<br />
Ästhetik, Flexibilität und<br />
minimierte Komplexität<br />
Die Aluminium Brand- und Rauchschutzplattform Schüco FireStop ist eine ästhetische<br />
Lösung für Brandschutztüren mit innovativer Technik. Bereits 2018 wurde das<br />
System mit dem begehrten „Red Dot Award 2018: Product Design“ ausgezeichnet.<br />
Zwei Varianten der Aluminium-Brandschutzkonstruktion sorgen für die Sicherheit.<br />
Schüco FireStop ADS 90 FR 30 erfüllt alle Anforderungen<br />
der Feuerwiderstandsklassen EI30 sowie<br />
EW30. Das System hat eine innovative, falzoffene<br />
3-Kammer-Profilgeometrie mit einer Bautiefe von<br />
90 mm. Das nachträgliche Einbringen von Kabeln<br />
zur Elektrifizierung von Türen oder der Wechsel von<br />
Schlössern, z. B. von Einfachverriegelungen auf Mehrfachverriegelungen,<br />
ist dank der falzoffenen Profile<br />
einfach durchführbar. Ein entscheidender Mehrwert<br />
des neuen Systems ist seine Wirtschaftlichkeit: Die<br />
Türelemente überzeugen durch einen hohen Vorfertigungsgrad<br />
in der Werkstatt und eine rationelle<br />
Montage. Das gewährleistet einen einfachen, schnellen<br />
und sicheren Einbau vor Ort im Objekt.<br />
Schüco FireStop ADS 76.NI SP ist ein innovatives,<br />
falzoffenes 1-Kammer-Profilsystem mit einer Bautiefe<br />
von 76 mm. Das ungedämmte Rauchschutzsystem<br />
bietet speziell für den Innenbereich variable Lösungen<br />
für Wand- und Türkonstruktionen, vor allem für<br />
Multifunktionstüren. Auch bei diesem System ist das<br />
nachträgliche Einbringen von Kabeln zur Elektrifizierung<br />
von Türen oder der Wechsel von Schlössern<br />
möglich. Ebenso wie FireStop ADS 90 FR 30 punktet<br />
dieses ungedämmte Rauchschutzsystem durch einen<br />
hohen Vorfertigungsgrad in der Werkstatt.<br />
Die Besonderheit beider Systeme ist der geprüfte<br />
Einsatz ohne Schlösser. Der Vorteil des Einsatzes<br />
ohne Schloss liegt auf der Hand. Die Türen sind immer<br />
begehbar – ein Komfort, den speziell Nutzer von<br />
stark frequentierten Innentüren zu schätzen wissen.<br />
Auch eine Nutzung in Verbindung mit Drehtürantrieben<br />
ist realisierbar. Der Einsatz von E-Öffnern kann<br />
hierbei unterbleiben.<br />
ALUKÖNIGSTAHL GmbH<br />
T +43 (0)1 98130-0<br />
office@alukoenigstahl.com<br />
www.alukoenigstahl.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
114<br />
Produkt News<br />
Brand-, Feuer- und Umweltschutz<br />
Der führende österreichische Feuerschutztor- und Feuerschutztürenproduzent<br />
Tortec erweitert seine Produktionsfläche um eine weitere Produktionshalle.<br />
Mehrere Millionen Euro investiert man damit auch 2018 am Standort in Wolfsegg<br />
und baut somit weiter die Produktionskapazitäten aus. Insgesamt sind mehr als<br />
15.000 Quadratmeter Hallenfläche auf dem bereits vorhandenen Betriebsareal<br />
in Wolfsegg seit 2006 zusätzlich entstanden. Es stehen nun gesamt rund 25.000<br />
Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung, um dem Bedarf an Feuerschutzprodukten<br />
mit hochwertigen architektonischen Lösungen gerecht zu werden.<br />
Die Tortec Brandschutztor GmbH gehört<br />
seit 2006 zur Hörmann Gruppe. Hörmann<br />
ist ein familiengeführtes, expandierendes<br />
Unternehmen der Bauzulieferindustrie mit<br />
internationaler Ausrichtung. In 36 hoch spezialisierten<br />
Werken stellt man Tore, Türen,<br />
Zargen und Antriebe für Europa, Nordamerika<br />
und Asien her. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern<br />
wird ein Umsatz von über einer Milliarde<br />
Euro erwirtschaftet. Ein Netz von über<br />
100 eigenen Vertriebsstandorten in mehr<br />
als 40 Ländern garantiert dem Kunden kurze<br />
Wege. Die Tortec Brandschutztor GmbH<br />
agiert am Standort Wolfsegg als eigenständiges<br />
Werk mit rund 300 Mitarbeitern.<br />
Durch die Vielfalt der Produkte, sowie dem<br />
eigenen österreichischen Vertrieb mit Niederlassungen<br />
in Wien, Graz und Innsbruck<br />
ist man in der Lage, sowohl für Architekten<br />
als auch für Bauträger ein hervorragendes<br />
Gesamtpaket für Feuerschutztore und -türen<br />
anzubieten und stellt somit einen starken,<br />
zukunftsorientierten Partner für den<br />
Objekt- und Industriebau dar.<br />
Der Hersteller hat sich bereits vor Jahren<br />
als einziger österreichischer Hersteller die<br />
Nachhaltigkeit aller Feuerschutztüren und<br />
-tore durch eine Umwelt-Produktdeklaration<br />
(EPD) nach ISO 14025 bestätigen lassen. Die<br />
umweltschonende und nachhaltige Produktion<br />
wurde durch eine Ökobilanz für alle Produkte<br />
bestätigt. Der Großteil der Rohstoffe<br />
wird aus Österreich und Zentraleuropa bezogen.<br />
Tortec hat bereits jetzt große Erfahrung<br />
durch zahlreiche Objekte zum Thema nachhaltiges<br />
Bauen sammeln können.<br />
Tortec Brandschutztor GmbH<br />
T +43 (0)7676 6060<br />
www.tortec.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Produkt News<br />
Zwei Fliegen mit einer<br />
neuen Regel-Klappe<br />
Die Aufgabe, mehr Energie einzusparen, führt oftmals zum<br />
Einbau größerer RLT-Geräte mit geringeren Luftgeschwindigkeiten<br />
in den Luftleitungen. Somit muss sich das Messprinzip<br />
ändern, um auch kleinste Volumenströme noch messen zu<br />
können. Zudem sind die Einbausituationen auf den Baustellen<br />
oft sehr beengt. Die Entwicklung einbausicherer Produkte, die<br />
gleichzeitig gute Messergebnisse erzielen, muss daher stets<br />
ein wichtiges Ziel von Neuentwicklungen sein. Die Verfolgung<br />
dieser beiden Zielsetzungen führte zu der Entwicklung eines<br />
neuen Messprinzips und einer zum Patent angemeldeten Regelklappe,<br />
welche erstmals in der neuen Volumenstrom-Regelgeräteserie<br />
TVE verbaut wird. Das neue Prinzip der TVE-Serie<br />
erlaubt es, den Volumenstrom ohne Messlanzen oder sonstige<br />
Sensorik innerhalb des Kanals direkt über die Regelklappe zu<br />
ermitteln. Der innovative Aufbau führt zu einer kompakten<br />
Bauform und erlaubt – bei dynamischen Transmittern sogar<br />
in beiden Luftrichtungen – höchste Messgüten auch bei ungünstiger<br />
Anströmung.<br />
TROX Austria GmbH<br />
T +43 (0)1 25043-0<br />
trox@trox.at<br />
www.trox.at<br />
sicher geSTAHLtet<br />
Brandschutztüren und -verglasungen EI30 aus Stahl<br />
• schlanke Ansichten für maximale Transparenz<br />
• auch mit Einbruchhemmung und Antipanikfunktion<br />
• barrierefrei und optional mit Fingerschutz<br />
• System: forster fuego light<br />
www.forster-profile.ch
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
116<br />
Produkt News<br />
© Bernadette Grimmenstein<br />
© Bernadette Grimmenstein<br />
© Bernadette Grimmenstein<br />
Bandtechnik für Schwerlasttüren<br />
Das Wälderhaus wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) in<br />
Hamburg als Exzellenzprojekt realisiert und mit dem BDA Hamburg Architektur<br />
Preis ausgezeichnet. Das fünfgeschossige Multifunktionsgebäude gliedert sich in<br />
die Nutzungsbereiche Ausstellung und Hotel.<br />
Die beiden unteren Geschosse in Stahlbetonbauweise<br />
mit einer Fläche von 650 Quadratmetern beherbergen<br />
ein Informationszentrum mit einer Dauerausstellung<br />
zum Thema Wald, einen Gastronomiebereich<br />
sowie Büro-, Seminar- und Veranstaltungsräume und<br />
den Sitz des Landesverbandes der Schutzgemeinschaft<br />
Wald (Bauherrin und Betreiberin). Die oberen<br />
drei Etagen mit dem 3-Sterne Superior Raphael Hotel<br />
Wälderhaus wurden in Massivholzbauweise errichtet<br />
und mit einer Fassade aus unbehandeltem Lärchenholz<br />
verkleidet. Das Gebäude verjüngt sich nach oben<br />
hin und wirkt durch seine unregelmäßige Holzfassade<br />
und die Dachbegrünung optisch wie ein Baum.<br />
Bei den gefälzten Innentüren entschieden sich die<br />
Architekten des Büros Andreas Heller für die Bandtechnik<br />
von SIMONSWERK aus Rheda-Wiedenbrück.<br />
Um die hohen Gewichte der Türelemente sicher zu<br />
verteilen und eine dauerhafte Funktion zu gewähr-<br />
leisten, kam die Schwerlast Bandtechnik der Marke<br />
VARIANT VX mit einem Belastungswert bis 400 kg<br />
zum Einsatz. Bei dieser Modelausführung wird die<br />
Materialstärke erhöht, die Bandrolle zusätzlich verschweißt<br />
und die Aufnahmeelemente für die Anforderungen<br />
werden verändert. Die Bandtechnik verfügt<br />
über eine komfortable 3D Verstelltechnik und<br />
ermöglicht eine Justierung der Schwerlast-Türen<br />
von jeweils +/- 3,0 mm zur Seite und Höhe sowie die<br />
Veränderung des Andrucks von +/- 1,0 mm. Weitere<br />
Vorzüge sind die wartungsfreie Gleitlagertechnik,<br />
hervorragende Laufeigenschaften und die Klassifizierung<br />
für den Einsatz an Funktionstüren für Schall-,<br />
Feuer- und Rauchschutzbereiche. Alle Bandsysteme<br />
des Herstellers verfügen über eine Umweltproduktdeklaration<br />
(EPD) zur ökologischen Gebäudebewertung,<br />
die CE-Produktzertifizierung und den zertifizierten<br />
Herkunftsnachweis Made in Germany.<br />
SIMONSWERK GmbH<br />
T +49 (0)5242 413-0<br />
info@simonswerk.de<br />
www.simonswerk.com<br />
© Simonswerk
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Produkt News<br />
Moderne trifft Tradition<br />
Das Junghans Terrassenbau Museum in Schramberg zeigt die<br />
Historie der Firma und ihrer berühmten Schwarzwalduhren. Von<br />
1918 bis in die 1970er wurden in dem einzigartigen Industriebau<br />
Millionen von Zeitmessern gefertigt. Nun wurde das Bauwerk<br />
des Industriearchitekten Philipp Jakob Manz zwei Jahre lang<br />
unter Denkmalschutzgesichtspunkten saniert und modernisiert.<br />
Im Eingangsbereich werden Innovationen der Gegenwart<br />
und der Vergangenheit verbunden. Ein besonderer Eyecatcher<br />
ist der bündig ins Rauminterieur installierte Kassenautomat, der<br />
einem überdimensionierten Smartphone gleicht und so die Ästhetik<br />
der Zeit trifft. Hier können Besucher alternativ zur Museumstheke<br />
ihr Ticket erwerben.<br />
Mit diesem geht es dann zu einer Drehsperre als vollautomatische<br />
Zugangskontrolle. Das Hightech-Einlasssystem stammt<br />
vollständig von Wanzl. Um den Zugang zum Museum möglichst<br />
einfach zu gestalten, selbst wenn - etwa während der Betreuung<br />
angemeldeter Gruppen - kein Personal im Eingangsbereich anwesend<br />
ist, muss die Menüführung des Kassenautomaten V21<br />
interaktiv und intuitiv sein. Jeder einzelne Schritt wird leicht<br />
verständlich auf dem übersichtlichen 21‘‘ Touchscreen abgebildet.<br />
Zusätzlich signalisieren LED-Leuchtbänder den Betriebsstatus<br />
der jeweiligen Aktionsfelder im Automatengehäuse. Blinken<br />
diese auf, sind sie betriebsbereit. Bezahlt wird bar oder per<br />
EC-/Kreditkarte.<br />
ARCHITEKT I RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARIS<br />
OBJEKT I PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE, WIEN<br />
FOTOGRAFIE I MICHEL DENANCÉ, PARIS<br />
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH<br />
T +49 (0)8221 729-0<br />
info@wanzl.de<br />
www.wanzl.com<br />
MOEDING KERAMIKFASSADEN<br />
DAS FASSADENSYSTEM DER ZUKUNFT<br />
VORGEHÄNGT I HINTERLÜFTET I WÄRMEGEDÄMMT<br />
WWW.MOEDING.DE
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
118<br />
Produkt News<br />
Lichtdurchflutetes Wohnen<br />
Dieses Haus östlich von München im Landkreis Erding ist im wörtlichen Sinne<br />
ein Familienprojekt. Der junge Architekt David Wolfertstetter hat den Neubau für<br />
seine Eltern geplant - sein erstes eigenes Projekt. Es ist ein ökologisch gebautes<br />
Haus, das auch gestalterisch und energetisch überzeugt. Es ist zudem barrierefrei<br />
und hat extrem viel Tageslicht zu bieten.<br />
Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde das Haus durch<br />
eine Zimmerei erstellt, die spezialisiert ist auf den Bau<br />
von Massivholzhäusern aus Fichte und Lärche und auf<br />
biologische Dämmstoffe. Aus ökologischen Gründen<br />
entschied sich der Architekt für den nachwachsenden<br />
Rohstoff Holz und auch für die Holzfaser-Dämmung<br />
von Fassade, Dach und Bodenplatte. Diesem Konzept<br />
folgen außerdem die Fassadenverkleidung aus unbehandeltem<br />
Lärchenholz und auch die Fenster und die<br />
Haustür sind in der Holzart Lärche gefertigt.<br />
len individuell gefertigt und bietet barrierefreie Übergänge<br />
von innen nach außen. Gleichzeitig trägt die<br />
Pfosten-Riegel-Fassade neben den Glasflächen auch<br />
die Dachflächen, sodass auf zusätzliche Stützen verzichtet<br />
werden konnte.<br />
Hingucker bei diesem Objekt ist eine 60 m² große<br />
Fassadenöffnung, die sich nach Süden orientiert und<br />
die den Wohnraum über große Glasflächen mit viel<br />
Licht und Sonnenwärme versorgt. Licht war einer der<br />
wichtigsten Wünsche, die sich die Bauherren erfüllen<br />
wollten. Die Verglasung eröffnet dabei herrliche Ausblicke<br />
in die umgebende Landschaft und garantiert<br />
lichtdurchflutete Räume. Sie verbindet den offenen<br />
Koch-, Ess- und Wohnbereich mit dem Außenraum.<br />
Die Glasfassade erstreckt sich über die gesamte<br />
Breite des Hauses über zwei Geschosse bis unter die<br />
Dachfläche. Sie ist als Pfosten-Riegel-Verglasung von<br />
Kneer-Südfenster mit 80 mm Aluminium-Holz-Profi-
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
119<br />
Produkt News<br />
Außen schützt die Aluminium-Schale – ein besonders<br />
wichtiger Punkt, da die Fassade ohne Dachüberstand<br />
stark der Witterung ausgesetzt ist. Innen entfalten die<br />
Pfosten und Riegel aus farblos gewachstem Fichtenholz<br />
eine behagliche Raumatmosphäre. Beschattet<br />
wird die Fassade mit einer Raffstoren-Anlage, die zusammen<br />
mit der Verglasung vom Fensterbauunternehmen<br />
realisiert wurde.<br />
Die Öffnungen an der Ost- und Westseite des Hauses<br />
als Einschnitte in der sonst eher geschlossen wirkenden<br />
Holzfassade sind in Nischen zurückgesetzt.<br />
In diese wurden raumhohe Holzfenster nach hinten<br />
versetzt eingebaut. Sie bilden Loggien im Obergeschoss<br />
bzw. einen Eingangsbereich im Erdgeschoss,<br />
die durch anthrazitfarbene Fassadenplatten an den<br />
Laibungen betont werden.<br />
Süd-Fensterwerk GmbH & Co. Betriebs KG<br />
T +49 (0)7950 81 0<br />
info@suedfenster.de<br />
www.kneer-suedfenster.de<br />
STADTKLIMA-RETTER<br />
PLANEN GRÜNDÄCHER<br />
Urbaner Klimaschutz<br />
mit OPTIGRÜN Systemlösungen<br />
Begegnen Sie überhitztem Stadtklima und Starkregenereignissen<br />
mit zukunftsfähigen Gründachlösungen.<br />
Dachbegrünungen kompensieren die Flächenversiegelung,<br />
speichern und verdunsten Niederschlagswasser und entlasten<br />
dadurch die Kanalisation. Gleichzeitig sorgen sie<br />
für ein angenehmeres Stadtklima, mildern den Hitzeinseleffekt<br />
und erhöhen die Biodiversität.<br />
Sprechen Sie uns an: info@optigruen.de<br />
Optigrün international AG | www.optigruen.de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
120<br />
Produkt News<br />
Konsequente Nachhaltigkeit<br />
der Systemlösungen<br />
Das Ulmer Aluminiumsystemhaus WICONA beweist einmal mehr, dass ökologische<br />
Verantwortung oberste Priorität hat. Bereits Anfang 2017 wurden seine Systeme<br />
mit dem Cradle to Cradle (C2C) Zertifikat in Bronze ausgezeichnet. Nur zwei Jahre<br />
später, zur BAU <strong>2019</strong>, erhielten Fenster-, Tür- und Fassadenlösungen sogar das<br />
C2C-Zertifikat in Silber.<br />
Das C2C-Zertifikat stellt eine Ergänzung<br />
und auch Alternative zu den bekannten Gebäudezertifikaten<br />
(DGNB, LEED, BREEAM,<br />
etc.) dar. Die Kriterien sind dabei direkt auf<br />
das Produkt bezogen, nicht auf das gesamte<br />
Gebäude. Die Verantwortung des Produktherstellers<br />
inklusive seiner kompletten<br />
Vorfertigungs- und Lieferantenkette<br />
tritt in den Fokus. Die fünf C2C-Kategorien<br />
(Materialien, Materialkreislauf, erneuerbare<br />
Energien und Klima, Wasser, soziale Verantwortung)<br />
erlauben es, im Zertifizierungsprozess<br />
alle Aspekte zu den verwendeten<br />
Materialien, dem Herstellungsprozess bis<br />
hin zur sozialen Verantwortung des Unternehmens<br />
und seinen Impact für die Gesellschaft<br />
zu betrachten.<br />
Sehr genau werden beispielsweise der Wasserverbrauch,<br />
eventuelle Produktionsabfälle<br />
und der Umgang damit sowie der Energieaufwand<br />
analysiert. Die Beurteilung der<br />
sozialen Standards reicht bis zu dem, was<br />
das Unternehmen seinem direkten Umfeld<br />
an Mehrwert zurückgibt. Besonders streng<br />
sind die Anforderungen in der C2C-Kategorie<br />
Materialien. Hier dürfen keine Inhaltsstoffe<br />
enthalten sein, die als krebserregend,<br />
mutagen oder reproduktiv giftig eingestuft<br />
sind. Der Hersteller erfüllt dieses Kriterium<br />
vollumfänglich, durch eine sehr enge und<br />
verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit<br />
seinen Lieferanten. Für den Silber-Status<br />
werden 95 % (bei Bronze 75 %) der Massenanteile<br />
eines Produkts analysiert und<br />
bewertet. C2C-Zertifizierungen in Silber<br />
verschaffen der Marke und damit auch den<br />
Marktpartnern eine höhere und qualifiziertere<br />
Aufmerksamkeit im international geprägten<br />
Wettbewerbsumfeld und bei entsprechenden<br />
Ausschreibungen. Die Systemlösungen lassen<br />
sich damit werthaltiger und zukunftsorientierter<br />
positionieren. Architekten und Planer<br />
können mit nahezu allen Systemen des Produzenten<br />
automatisch den C2C-Standard Silber<br />
einsetzen. So bietet man den Geschäftspartnern<br />
die Chance, sich vom Wettbewerb zu unterscheiden<br />
und bei ihren Auftraggebern mit<br />
der Kombination Hightech-Systeme plus Nachhaltigkeit<br />
zu punkten.<br />
Hydro Building Systems Austria GmbH<br />
T +43 (0)6212 20000<br />
info@wicona.at<br />
www.wicona.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
121<br />
Produkt News<br />
Gefälledämmung<br />
in Gold für die Umwelt<br />
Das aktuelle Referenzprojekt des Tiroler Dämmstoff-Spezialisten Steinbacher<br />
erfüllt die strengen Kriterien des klimaaktiv-Gebäudestandards des Bundesministeriums<br />
für Nachhaltigkeit und Tourismus – das europaweit anspruchsvollste<br />
Gütesiegel für nachhaltiges Bauen. Eine hohe Auszeichnung in Sachen Ökologie<br />
und Qualität, die unter anderem durch die effizienten Dämmstoffe und die durchdachte<br />
Gefälledämmplanung erreicht wurde.<br />
Das neue Justizgebäude in Salzburg vereint Sanierung<br />
und Neubau in klimaschonender Weise: Der<br />
denkmalgeschützte Teil des Gebäudes wurde nach<br />
höchsten energetischen und ökologischen Standards<br />
umgebaut und saniert, ein moderner Zubau<br />
verbindet die beiden Gebäudetrakte miteinander. Die<br />
Warmdachaufbauten wurden von den Flachdachspezialisten<br />
der Fa. Karl Mayr aus Saalfelden mustergültig<br />
ausgeführt. Steinbacher hat dafür nicht nur ca.<br />
1.100 m 2 sehr gut dämmende steinopor®-Produkte<br />
geliefert, sondern konnte seine Expertise auch in<br />
die Planung der Gefälledämmung einfließen lassen.<br />
Eine große Herausforderung waren die komplizierten<br />
Dachformen und vielen Flachdächer mit unterschiedlichen<br />
Anforderungen an die Aufbauhöhen<br />
und Dämmstärken. Bereits in der Gefälleplanung<br />
wurden die einzelnen Flächen erfasst und dämmtechnisch<br />
auf die jeweiligen Bedingungen hin optimiert.<br />
Die Gefälledämmplatten wurden schließlich<br />
an die Baustelle entsprechend den Einzelflächen beschriftet<br />
ausgeliefert.<br />
Steinbacher Dämmstoff GmbH<br />
T +43 (0)5352 700-0<br />
office@steinbacher.at<br />
www.steinbacher.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
122<br />
Produkt News<br />
Es wird heiß in unseren Städten<br />
Der Klimawandel ist ein globales Problem, das sich aber vor allem in seinen lokalen<br />
Folgen bemerkbar macht. So verändert sich auch das Klima in unseren Städten: Es<br />
wird extremer. Doch wie genau und wodurch verändert sich das Stadtklima? Und<br />
was können wir dagegen tun?<br />
Mit zunehmenden Niederschlagsstärken (Starkregen)<br />
steigt auch die Belastung der Entwässerungssysteme<br />
und somit deren Überlaufhäufigkeit. Denn<br />
die bestehenden Systeme sind für geringere Regenwasserintensitäten<br />
dimensioniert und müssten, um<br />
anfallendes Regenwasser ohne Rückstau ableiten<br />
und so Schäden vermeiden zu können, deutlich größere<br />
Kapazitäten aufweisen. Um ein sicheres Ableiten<br />
bzw. Speichern des Regenwassers gewährleisten<br />
zu können, müssen Regenwasserrückhalteräume,<br />
geschaffen werden. Einfach verfügbar sind hierbei<br />
vor allem die Dachflächen: Sie stellen einen nennenswerten<br />
Flächenanteil im Stadtbereich dar und<br />
sind zudem oft durch ihre bauliche Beschaffenheit<br />
zur Nutzung als Retentionsfläche prädestiniert. So<br />
wird die Belastung der städtischen Infrastruktur und<br />
damit die Häufigkeit von Überflutungsereignissen<br />
deutlich reduziert. Maßnahmen dieser Art, angewendet<br />
auf ganze Baugebiete, würden die Resilienz des<br />
gesamten urbanen Bereiches gegenüber Starkregenereignissen<br />
deutlich erhöhen.<br />
Neben dem Schutz vor Überflutungen ist die Hitzereduzierung<br />
eine drängende Aufgabe der modernen<br />
Stadtplanung. Die einzige Möglichkeit, um die Temperaturen<br />
aktiv zu vermindern und somit dem Effekt<br />
der Hitzeinseln in Städten und Ballungsräumen entgegenwirken<br />
zu können, ist die Verdunstung. Doch<br />
dafür werden große Mengen an Wasser benötigt.<br />
Wenn wir das Regenwasser – sowohl über die Wintermonate,<br />
als auch die Starkniederschläge in den<br />
Sommermonaten – dezentral zurückhalten, kann genau<br />
dieses Wasser für die Verdunstung verwendet<br />
werden. Gleichzeitig können die Retentionsflächen<br />
auf den Gebäudedächern durch eine Bepflanzung<br />
optisch ansprechend gestaltet werden.<br />
Um das in die Praxis übertragen zu können, müssen<br />
ausreichende Wasserspeicher für die Pflanzen verfügbar<br />
sein. Dafür können Wasserretentionsboxen<br />
z. B. die WRB von Optigrün eingesetzt werden, in denen<br />
wiederum Kapillarsäulen verbaut sind, die das<br />
gespeicherte Regenwasser auf die Oberfläche der<br />
Boxen fördern. Ein kapillarwirksames Vlies, das darüber<br />
verlegt wird, verteilt das Wasser auf der gesamten<br />
Oberfläche der Box. Auf diesem Weg steht den<br />
Pflanzen das ursprünglich in den Wasserretentionsboxen<br />
gesammelte Regenwasser wieder zur Verdunstung<br />
zur Verfügung.<br />
Optigrün<br />
International AG<br />
T +49 (0)7576 772-0<br />
info@optigruen.de<br />
www.optigruen.de
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
123<br />
Produkt News<br />
Drei Arten von Weiß<br />
Höchste Sicherheitsstandards, ohne hermetisch zu wirken, natürlich belichtete Arbeitsplätze<br />
trotz strengster Gebäudeanforderungen und eine ästhetische Ensemblewirkung<br />
ohne Monotonie – das waren die Zielsetzungen, denen sich Jean-Paul<br />
Viguier et Associés Architekten (Paris) für die Um- und Neubauten der französischen<br />
Zentralbank „Banque de France“ stellten.<br />
Der 2018 fertiggestellte Gebäudekomplex<br />
nördlich von Paris umfasst als Herzstück<br />
ein dreiteiliges Tresor-Gebäude, in dem<br />
ein Viertel aller französischen Banknoten<br />
verarbeitet wird. Ein Bestandteil des Komplexes<br />
ist mit einer Fassade aus individuell<br />
gefertigten, glasierten Ziegelplatten von<br />
Moeding gestaltet.<br />
Während die Dienstleistungsbereiche mit<br />
Büros und öffentlichen Empfangsräumen in<br />
die beiden sanierten und um ein verglastes<br />
Betriebsrestaurant erweiterten Altbauten<br />
einzogen, ist das Herzstück des Neubaus<br />
der Tresorkomplex. Er besteht aus drei<br />
unterschiedlich großen Volumen, die über<br />
einen dreieckigen, nur für die Mitarbeiter<br />
zugänglichen Lichthof miteinander verknüpft<br />
sind. Zunächst steht hier das Technikgebäude,<br />
in dem das Geld entladen wird.<br />
Von dort gelangt es automatisch in den<br />
Sortierraum, in dem die Mitarbeiter normalerweise<br />
unter bunkerähnlichen Bedingungen<br />
arbeiten. Die Architekten schlugen hier<br />
jedoch als „leuchtende Doppelhaut“ eine<br />
Verglasung in Richtung des Erschließungsflurs<br />
vor, der sich optisch zum Außenraum<br />
öffnet. Auf der anderen Seite führen Fenster<br />
und Türen zum begrünten, bomben- und<br />
kugelsicher verglasten Innenhof.<br />
Für die Fassade dieses Gebäudes wünschten<br />
sich die Architekten ein besonderes<br />
Material: einfach im Unterhalt, robust und<br />
zugleich ästhetisch attraktiv. Zudem sollte<br />
es einzigartig, nachhaltig und aus natürlichen<br />
Materialien hergestellt sein. Die Lösung<br />
boten weiß glasierte Ziegelplatten.<br />
Die Plattenform wurde in enger Zusammenarbeit<br />
zwischen dem Architekten und dem<br />
Produzenten erarbeitet. So entspricht der<br />
Horizontalschnitt der Platten dem Logo der<br />
Banque de France. Die Ziegelplatten erzeugen<br />
ein optisches „Vibrieren“ und schaffen<br />
Tiefe in der Fläche sowie ein Spiel verschiedener<br />
Lichttöne aus Orange, Blau und Rosé.<br />
Als moderner Kontrast dazu sind die beiden<br />
– rein technisch genutzten – Gebäude<br />
mit einer Metallfassade bekleidet. Der dritte<br />
und höchste Baukörper, der „Treibhaus“ genannte<br />
Lagerraum, erhielt eine äußere Hülle<br />
aus nach oben hin abnehmend perforierten<br />
Blechen. Sie verleiht dem fensterlosen<br />
Betonvolumen eine optische Unschärfe und<br />
Leichtigkeit. Verbindendes Element der<br />
drei Körper ist die Farbe: Alle drei Bauteile<br />
schimmern in strahlendem Weiß.<br />
Moeding Keramikfassaden GmbH<br />
T +49 (0)8732 2460-0<br />
info@moeding.de<br />
www.moeding.de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
Die Natur zum Vorbild<br />
Die Trendfarben <strong>2019</strong> strotzen nur so vor Lebendigkeit:<br />
Satte Gelb-Nuancen, Salbeigrün oder lebhafte<br />
Korallentöne – alles signalisiert strahlende Frische.<br />
Die Trendfarben machen Lust auf Sommer, Sonne und<br />
Sonnenschein. Mit StarTop, einer neuen Generation<br />
von Premiumputzen und -farben, bietet Baumit über<br />
100 zusätzliche Farbtöne in Silikonqualität.<br />
124<br />
Der Farbton Koralle wurde nicht ohne Grund gewählt,<br />
denn durch die Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung<br />
sterben weltweit Korallen. Mit „Living<br />
Coral“ wird auf das wichtige Thema Umwelt- und Meeresschutz<br />
und das damit einhergehende weltweite Korallensterben<br />
aufmerksam gemacht. Der Putz ist mit<br />
einem neuen Füllstoff ausgestattet, der wie eine Koralle<br />
über eine sehr große Oberfläche und damit Tausende<br />
winzige Hohlräume, Poren und Vertiefungen verfügt.<br />
Genutzt wird das hydrophil-hydrophobe Wirkprinzip<br />
zur Reduktion von Oberflächenverschmutzung. Die<br />
hydrophilen, wasseranziehenden Eigenschaften bewirken<br />
eine schnelle und großzügige Verteilung von<br />
aufliegender Feuchtigkeit. Gleichzeitig sorgt die feine<br />
Mikrostruktur für eine besonders rasche Trocknung.<br />
Die hydrophobe, also Wasser abstoßende Struktur an<br />
der Oberfläche funktioniert wie eine effektive Dränage.<br />
Die Kombination abperlender Regentropfen und<br />
Aufnahme von Feuchtigkeit bei Tau bewirkt eine rasche<br />
Rücktrocknung der Oberfläche, den sogenannten<br />
Drypor-Effekt. Dieser hält Verschmutzungen von<br />
der Fassade fern und bietet einen erhöhten Schutz vor<br />
Algen und Pilzen.<br />
Produkt News<br />
Baumit GmbH<br />
T +43 (0)501 888-0<br />
www.baumit.com<br />
Für alle Flächen geeignet<br />
Die ARDEX Baustoff GmbH bringt ein neues panDOMO-Produkt<br />
auf den Markt. Völlig neue Möglichkeiten eröffnet die Designspachtelmasse<br />
Studio, mit der Wand-, Decken- und Bodenflächen<br />
mit nur einem Material ausgeführt werden können – damit entstehen<br />
Oberflächen in einheitlicher Optik. Vor 20 Jahren hat der<br />
Hersteller die ersten panDOMO-Produkte auf den Markt gebracht<br />
– damals eine „Revolution“. Denn bis 1999 waren Spachtelmassen<br />
normalerweise unsichtbar. Jetzt hat man das Sortiment mit einem<br />
„grenzenlosen“ Produkt erweitert, das komplett einheitliche Flächen<br />
ermöglicht.<br />
Studio lässt Wand-, Decken- und Bodenflächen miteinander verschmelzen<br />
und so zu einem Ganzen werden. Ebenso wichtig wie<br />
die Optik war den Entwicklern auch die Handhabung des neuen<br />
Produkts. Es ist leicht zu verarbeiten, haftet hervorragend und ist<br />
sehr ergiebig. Durch die Wünsche und Vorstellungen von Planern,<br />
Architekten und Auftraggebern kann die Oberflächenstruktur variabel<br />
gestaltet werden – von strukturiert bis homogen. In Zusammenarbeit<br />
mit den Systempartnern des Produzenten entstehen<br />
einzigartige Oberflächen nach dem Wunsch der Kunden.<br />
ARDEX Baustoff GmbH<br />
T +43 (0)2754 7021-0<br />
marketing@ardex.at<br />
www.ardex.at<br />
www.pandomo.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Der Schutz gegen Hitze<br />
125<br />
Produkt News<br />
Die Zahl der Jahrhundertsommer war im vergangenen<br />
Jahrzehnt eklatant hoch. Die daraus resultierende Hitze<br />
erhöht bei Hausbenützern den Wunsch nach einem wirkungsvollen<br />
Wärmeschutz beträchtlich. Um amerikanische<br />
Verhältnisse mit energiefressenden Kühlaggregaten<br />
in Büros und Wohnungen zu vermeiden, ist ein intelligentes<br />
Wechselspiel von Temperatur-Vermeidung und -Reduktion<br />
gefragt. Dafür ist die vorgehängte, hinterlüftete<br />
Fassade (VHF) prädestiniert. Sie hilft entscheidend, den<br />
Wärmeeintrag im Inneren eines Gebäudes zu minimieren,<br />
da praktisch die Fassade selbst die dahinterliegende<br />
Wandkonstruktion verschattet. So können Temperaturspitzen<br />
an der Oberflächenverkleidung wesentlich besser<br />
ausgeglichen werden, da die eingetragene Wärme über<br />
den Hinterlüftungsquerschnitt wirkungsvoll abgeführt<br />
wird. Der vorgehängte Fassadenteil wirkt dabei wie eine<br />
natürliche Klimaanlage, während die dahinterliegende<br />
tragende Wand den Temperaturausgleich optimal übernimmt.<br />
Eine weitere Möglichkeit stellen Fassadenbegrünungen<br />
auf VHF dar. So sind Gebäude nicht nur gegen<br />
Überhitzung gewappnet, sondern leisten auch einen<br />
wertvollen Beitrag für das Mikroklima. Pflanzen tragen zur<br />
Kühlung und Reinigung der Luft bei. Das Mikroklima eines<br />
Viertels profitiert von jedem einzelnen begrünten Gebäude.<br />
Vor allem in Ballungszentren werden diese nicht nur<br />
vorgeschrieben, sondern auch gefördert.<br />
Österreichischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF)<br />
T +43 (0)1 890 38 96<br />
info@oefhf.at<br />
www.oefhf.at<br />
+
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
126<br />
Produkt News<br />
MUREXIN GMBH<br />
T +43 (0)2622 27 401-0<br />
info@murexin.com<br />
www.murexin.com<br />
Exklusives Wohnen<br />
und Logieren im Lifestyle-Hotel<br />
Die 342 Parkapartments am Belvedere, auf Pylonen gestelzt, lassen ihre Bewohner<br />
Fernblicke über Wien genießen. Touristen und Geschäftsreisende, die coolen Lifestyle<br />
bevorzugen, werden sich im Hotel ANdAZ Vienna wohlfühlen. Beide Projekte<br />
stammen aus der Feder des italienischen Stararchitekten Renzo Piano. Bauherr des<br />
Komplexes ist SIGNA – beim Hotel im Joint Venture mit der Hyatt Gruppe.<br />
Neben der architektonischen Besonderheit und der in<br />
jedem Detail durchdachten Ausstattung ist es vor allem<br />
die besondere Lage im Quartier Belvedere, welche<br />
diese Location zu einer begehrenswerten Adresse in<br />
Wien macht. Denn einerseits liegen das Wiener Stadtzentrum<br />
und der Hauptbahnhof nur rund zehn Minuten<br />
Gehweite entfernt. Zudem wurden die Grün flächen<br />
des Schweizer Gartens optisch an die Gebäude herangeholt<br />
und zusätzlicher Grünraum geschaffen.<br />
Die umfangreichen Fliesenverlegearbeiten wurden<br />
von der HB Fliesen GmbH mit Produkten von Murexin<br />
ausgeführt. Für den Fachbetrieb war dabei die größte<br />
Herausforderung, neben der immensen Flächenleistung<br />
von insgesamt rund 24.000 Quadratmetern, die<br />
geforderte hohe Qualität der Verfliesung sowohl im<br />
Hotel als auch in den Wohnanlagen. Beispielsweise<br />
wurden Matrix Mosaike und hochwertige Großformatfliesen<br />
verlegt. „Die Logistik, um die Arbeiten in den<br />
fünf Türmen mit bis zu 19 Stockwerken reibungslos<br />
durchführen zu können, war nicht einfach zu bewerkstelligen.<br />
Zu Spitzenzeiten hatten wir bis zu 40 Personen<br />
auf der Baustelle und fünf im Büro für das Projekt<br />
gebunden“, so Projektleiter Hubert Ledersteger.<br />
Bewährt haben sich dabei die rasche Materialbereitstellung<br />
und flexible Lieferungen durch Murexin. „Gerade<br />
bei einem derart umfangreichen Bauvorhaben<br />
müssen sich die Verarbeiter auf das Material verlassen<br />
können, um den Kopf für andere Sachen frei zu haben“,<br />
bestätigt Murexin Vertriebsleiter Peter Reischer.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Produkt News<br />
Gute Ideen<br />
für Dämmung<br />
Die neue Hotelkollektion<br />
Gerade textile Böden werden bei der Wohnlichkeit oftmals unterschätzt.<br />
Maßgeblich für die Verwendung und den Einsatzort<br />
ist dabei die Struktur des Teppichs: Sie bestimmt letztlich, ob<br />
der textile Boden etwa in Schlaf- und Wohnräumen zum Wohlfühlen<br />
einlädt und Behaglichkeit sowie Gemütlichkeit ausstrahlt.<br />
Oder ob er durch seine Robustheit die nötige Strapazierfähigkeit<br />
für stark frequentierte Bereiche wie Flure, Büros<br />
oder Bars besitzt.<br />
SONNHAUS bietet mit der neuen, vorliegenden Teppichbodenkollektion<br />
Hotel 2.0 #UeberallZuhause eine Vielfalt an Möglichkeiten.<br />
Erstmalig enthält diese Kollektion Fliesen- als auch<br />
Bahnenware, die dank ihrer höhengleichen Rückenausrüstung<br />
individuell mit- und untereinander kombiniert werden können.<br />
Auch sind sämtliche Holzoptiken als Bahnen in 400 cm Breite<br />
verfügbar. Als wahrer Alleskönner bietet Business ein umfassendes<br />
Sortiment hochwertiger Objekt-Teppichböden für unterschiedlichste<br />
Verwendungsmöglichkeiten und vereint diese<br />
mit mehreren, innovativen Eigenschaften in einem einzigen<br />
Konzept. Als Bahnenware oder SL-Fliese (selbst liegend) verfügbar,<br />
eignen sich die Teppiche der Kollektion zum Einsatz im<br />
klassischen Büro-Objekt bis zum Semi-Objektbereich für die<br />
leichtere Beanspruchung in attraktiven Preiseinstiegslagen.<br />
Moderne Druckqualitäten sowie die Möglichkeit, ab ca. 240 m²<br />
individuelle, moderne Designs in drei Qualitätsstufen drucken<br />
zu können, ermöglichen in jedem Objekt einen breiten Gestaltungsspielraum.<br />
Sonnhaus GmbH<br />
T +43 (0)7242 634-100<br />
servicecenterwels@sonnhaus.at<br />
www.sonnhaus.at<br />
Information<br />
jetzt anfordern<br />
Liapor ® Ground<br />
Die Dämmung unter der<br />
Fundamentplatte und seitliche<br />
Arbeitsgraben Verfüllung<br />
Liapor<br />
Naturrein und circa 11,5<br />
Millionen Jahre alt –<br />
Illit-Ton bildet den hochwertigen<br />
Grundstoff für<br />
Liapor. Im Liapor-Werk wird<br />
das natürliche Rohmaterial<br />
gemischt und bei circa<br />
1.200 °C gebrannt.<br />
Dabei verbrennen die organischen<br />
Anteile und der Ton<br />
bläht sich auf. Gewicht,<br />
Größe und Festigkeit des<br />
luftporendurchsetzten<br />
Materials lassen sich im<br />
technisch ausgereiften Produktionsverfahren<br />
exakt<br />
steuern.<br />
So entsteht ein natürlicher<br />
Hochleistungsbaustoff mit<br />
besten Eigenschaften bei<br />
sehr geringem Gewicht.<br />
Liapor Ground eignet sich aufgrund seiner einzigartigen<br />
physikalischen Eigenschaften hervorragend<br />
zur hochbelastbaren Fundamentplattendämmung<br />
und zur seitlichen Arbeitsgrabenverfüllung.<br />
Die luftporen-durchsetzten, keramischen Tonkugeln<br />
vermindern den Erddruck dank seiner geringen<br />
Trockenschüttdichte deutlich. Die Schüttung<br />
ist formstabil und nahezu selbstverdichtend. Der<br />
Eintrag kann auch in schmalste Spalten erfolgen,<br />
zusätzliche Rüttler oder Verdichter sind nicht erforderlich.<br />
Liapor Ground ist nicht brennbar (A1), reduziert<br />
Wärmeverluste, kann gleichzeitig Wärme<br />
speichern und wirkt schalldämmend<br />
Lias Österreich GesmbH. - 8350 Fehring - Fabrikstraße 11<br />
Tel. +43 (0)3155 - 2368 - Email: info@liapor.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
128<br />
Heavy Metal in Beton<br />
Produkt News<br />
Schnell, einfach montierbar und eine Top-Performance<br />
mit hohem Leistungsniveau in Beton: Die fischer<br />
Betonschrauben stehen für absolute Verlässlichkeit<br />
und sind die ROCKSTARS – mit Heavy Metal in Beton.<br />
Die Bezeichnung ULTRACUT FBS II ROCKSTARS<br />
bringt die Vorteile des Betonschrauben-Sortiments<br />
schlagfertig auf den Punkt: Die innovative Gewindegeometrie<br />
sorgt für die Aufnahme hoher Zug- und<br />
Querkräfte in Beton. Beim Eindrehen schneiden sich<br />
die Flanken der Betonschrauben tief in den Beton ein.<br />
Durch diesen Formschluss überträgt die Betonschraube<br />
die Kräfte zuverlässig und verankert spreizdruckfrei<br />
im Verankerungsgrund. Mit ihren Montagevorteilen<br />
bieten sie eine einfache und schnelle Installation<br />
vor Ort: Die Betonschraube kann zulassungskonform<br />
bis zu zweimal gelöst, unterfüttert und nachjustiert<br />
werden. Die Unterkopfrippen verhindern ein unabsichtliches<br />
Lösen der Betonschraube. Bei senkrechten<br />
Bohrungen im Boden- und Deckenbereich oder der<br />
Verwendung von Hohlbohrern mit Absaugfunktion ist<br />
keine Bohrlochreinigung nötig.<br />
Fischer Austria GmbH<br />
T +43 (0)2252 53730-0<br />
office@fischer.at<br />
www.fischer.at<br />
EuGH-Urteil zur Zeiterfassung – Pflicht und Kür<br />
Der Europäische Gerichtshof EuGH hat<br />
mit seinem Urteil vom 14. Mai <strong>2019</strong> zum<br />
Schutz der Sicherheit und Gesundheit der<br />
Arbeitnehmer die EU-Mitgliedstaaten dazu<br />
verpflichtet, gesetzliche Regelungen zur<br />
Messung der täglichen Arbeitszeit jedes<br />
Arbeitnehmers zu verabschieden. Arbeitgeber<br />
sollen demnach die Arbeitszeiten ihrer<br />
Arbeitnehmer systematisch und vollständig<br />
erfassen und dadurch alle Überstunden dokumentieren.<br />
Auch wenn die Umsetzung in nationales<br />
Recht noch Monate, wenn nicht Jahre<br />
dauern wird, erhob sich eine kleine Welle<br />
der Aufregung aus besonders betroffenen<br />
Branchen, so auch aus dem Bereich der<br />
Bauplanung. Der zusätzliche bürokratische<br />
Aufwand erschwere es den Planungsbüros,<br />
sich auf ihre eigentlichen, planerischen<br />
Aufgaben zu konzentrieren. Anwender<br />
der Controlling Management Software untermStrich<br />
können sich derweil entspannt<br />
in den Schreibtischsessel sinken lassen und<br />
wichtigeren Themen zuwenden. Denn mit<br />
den Modulen „Stunden“ und „Zeitprotokoll“<br />
haben sie alles Nötige in Sachen Zeiterfassung<br />
längst an Bord. Das browserbasierte<br />
Programm läuft im stationären wie im mobilen<br />
Einsatz auf den verschiedensten Betriebssystem-<br />
und Geräteplattformen, auch<br />
als optimierte Smartphone-Version.<br />
untermStrich software GmbH<br />
T +43 (0)3862 58106-0<br />
office@untermstrich.com<br />
www.untermstrich.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
129<br />
Produkt News<br />
Visuell. Effizient. Einfach.<br />
VON BAUEXPERTEN<br />
FÜR BAUEXPERTEN.<br />
Wir entwickeln ganzheitliche<br />
Software-Lösungen, die<br />
intelligentes Arbeiten bei jedem<br />
Planungsschritt ermöglichen –<br />
ob AVA, BIM oder Kalkulation.<br />
Eine integrierte Bausoftware mit<br />
transparenten Kosten und einem<br />
effizienten Bauprozess.<br />
Bald auch für Sie?<br />
Abbildungen: CPU Pride, Moskau<br />
OPEN BIM in der Anwendung<br />
Das Moskauer Architekturbüro CPU Pride<br />
plante im integrierten Planungsprozess<br />
das Zentrum für Rhythmische Sportgymnastik<br />
(ZRG) und wurde im nationalen<br />
BIM-Technologiewettbewerb „BIM 2016“ in<br />
der Kategorie „BIM-Projekt: Sportstätten“<br />
prämiert. Die Architekten setzen in ihrem<br />
Projekt konsequent auf den Open-BIM-<br />
Ansatz und auch auf die BIM-Planungssoftware<br />
ARCHICAD. Das ZRG, das sich<br />
am Moskauer Olympiastützpunkt Luschniki<br />
kurz vor der Fertigstellung befindet,<br />
verfügt über 4 000 Sitzplätze und soll für<br />
Wettbewerbe und Trainingsveranstaltungen<br />
genutzt werden.<br />
Die Arbeit mit der digitalen Planungsmethode<br />
BIM ist eine der Kernkompetenzen<br />
von Pride. Die BIM-Technologie ermöglicht<br />
bei ihrem konsequenten Einsatz einen<br />
großen Mehrwert für alle Beteiligten – und<br />
das über alle Phasen des Lebenszyklus<br />
eines Gebäudes hinweg. Die Planer setzen<br />
bei ihrem Projekt in Moskau auf einen<br />
offenen, herstellerübergreifenden Datenaustausch<br />
(Open BIM) via IFC-Format<br />
und planen im Projekt modellorientiert mit<br />
ARCHICAD und der App BIMx. Im Sinne<br />
des Open-BIM-Ansatzes kamen darüber<br />
hinaus weitere Softwarelösungen von anderen<br />
Planungspartnern zum Einsatz. Mit<br />
dem IFC-BIM-Datenaustausch erreichten<br />
die Fachleute ein höheres Niveau der Zusammenarbeit.<br />
Auf diese Weise wurden<br />
viele Fehler verhindert und die Qualität der<br />
Dokumentation war wesentlich höher.<br />
GRAPHISOFT Deutschland GmbH<br />
Vertrieb Österreich<br />
mail@graphisoft.at<br />
www.archicad.at<br />
www.nevaris.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
130<br />
edv<br />
AVA-Textdatenbanken:<br />
Besser ausschreiben<br />
Datensammlungen für LV-Texte und Baupreise machen Ausschreibungen und Kostenkalkulationen<br />
komfortabler und sicherer. Worauf kommt es an, welche Anbieter<br />
gibt es und was bieten sie?<br />
Text: Marian Behaneck<br />
AVA-Software ohne Ausschreibungstexte<br />
ist wie ein Auto ohne Räder. Deshalb werden<br />
herstellerneutrale Texte teilweise mit den<br />
AVA-Programmen mitgeliefert. In der Praxis<br />
werden diese Texte häufig zusammen<br />
mit bürointernen, über viele Jahre gewachsenen<br />
Textsammlungen verwendet. Diese<br />
Mischung aus vorgefertigten und individuell<br />
formulierten Leistungsbeschreibungen<br />
auf aktuellem Stand zu halten, ist allerdings<br />
zeitintensiv. Eine Aktualisierung und Anpassung<br />
an neue Richtlinien unterbleibt<br />
deshalb häufig. Daraus können Probleme<br />
bei der Bewertung von Angeboten und Konflikte<br />
in der Ausführungsphase resultieren.<br />
Unvollständige, nicht mehr normgerechte<br />
oder fehlerhafte Leistungsbeschreibungen<br />
können zu Auftragnehmer-Nachforderungen<br />
und Schadensersatz ansprüchen gegenüber<br />
dem Planer führen. Eine optimale<br />
Leistungsbeschreibung sollte daher vollständig,<br />
eindeutig, stimmig, aktuell und<br />
rechtssicher sein.<br />
Online-Datenbanken für Ausschreibungstexte rationalisieren die Ausschreibung von Bauprojekten,<br />
machen sie komfortabler und sicherer.<br />
© W. Riemenschneider<br />
Was bieten Ausschreibungstext-<br />
Datenbanken?<br />
Ausschreibungstext-Datenbanken unterstützen<br />
Planer mit vorformulierten,<br />
normgerechten Texten bei der Erstellung<br />
eindeutiger, vollständiger, aktueller und<br />
rechtssicherer Leistungsbeschreibungen.<br />
Die Ausschreibungstexte werden dazu regelmäßig<br />
an die allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik, an Richtlinien, Normen<br />
und die Vorgaben der VOB (Vergabe- und<br />
Vertragsordnung für Bauleistungen), respektive<br />
der ÖNORM B 2110 angepasst und<br />
versprechen so mehr Rechtssicherheit.<br />
Einheitspreise und Kalkulationshinweise<br />
vereinfachen Kostenplanungen und Angebote.<br />
Diverse Offline-Datensammlungen<br />
auf CD-ROM oder zum Download sowie<br />
Online-Datenbanken bieten dazu entsprechende<br />
produktspezifische oder produktneutrale,<br />
teilweise richtlinienkonforme Ausschreibungstexte,<br />
als Kurz- oder Langtext,<br />
für international auszuschreibende Projekte<br />
manchmal auch mehrsprachig. Für Kostenkalkulationen<br />
und Angebote sind die<br />
Leistungsbeschreibungen bei einigen Anbietern<br />
auch mit marktorientierten, teilweise<br />
auch nach abgerechneten Bauprojekten<br />
ermittelten Einheitspreisen versehen.<br />
PDF-Anlagen, Richtlinien und Normen, Produktfotos,<br />
Pläne, Zertifikate und zunehmend<br />
auch BIM-Objekte unterstützen Planer<br />
und Bauunternehmer darüber hinaus<br />
bei der Auswahl des passenden Produktes,<br />
der Planung, Konstruktion und Angebotserstellung.<br />
Eine übersichtliche, nach Gewerken,<br />
Herstellern und Begriffen sortierte<br />
oder an der DIN 276, respektive ÖNORM B<br />
1801-1 orientierte Ordnungsstruktur sorgt<br />
ebenso dafür, dass man sich schnell zurechtfindet,<br />
wie eine Volltextsuche in der<br />
kompletten Datenbank oder in ausgewählten<br />
Gewerken. Auch Suchvorschläge oder<br />
eine Ähnlichkeitssuche vereinfachen die<br />
Suche, Ergebnisfilter erleichtern die Auswahl<br />
bei sehr vielen Suchtreffern. Die in der<br />
Textvorschau angezeigte Produkt- oder<br />
Leistungsbeschreibung kann meist einfach<br />
per Drag & Drop in einer Sammelbox<br />
abgelegt und ebenso einfach oder per Datenschnittstellen<br />
wie GAEB 90, GAEB DA<br />
XML, DATANORM, DOC, RT, XLS, teilweise<br />
auch in den ÖNORM-Formaten B2063 und<br />
A2063 in ein AVA-Programm importiert<br />
werden. Manchmal können die Datenbanken<br />
auch direkt aus der jeweiligen Software<br />
aufgerufen und genutzt werden.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
131<br />
edv<br />
Worauf sollte man achten?<br />
Das Datenbank-Konzept – offline als CD-<br />
ROM, respektive Download-Link oder online<br />
als Web-Lösung – hat mehrere Auswirkungen.<br />
Unter anderem auf die Aktualität<br />
der Daten und die Art und Weise, wie häufig,<br />
von wem und in welcher Form aktualisiert<br />
wird: beispielsweise jährlich vom Datenbankanbieter<br />
oder mehrmals jährlich als<br />
Download. Bei einer Web-Lösung aktualisieren<br />
die Bauprodukthersteller kontinuierlich<br />
ohne Zutun des Datenbanknutzers.<br />
Auch der Umfang des Angebots spielt eine<br />
wichtige Rolle, denn mit ihm steigt auch die<br />
Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer genau<br />
die Hersteller, Produkte, Gewerke und Leistungen<br />
findet, die er sucht. Bei öffentlichen<br />
Aufträgen dürfen einzelne Hersteller oder<br />
Produkte nicht bevorzugt werden, was in<br />
der Nennung eines Fabrikat- oder Produktnamens<br />
aber der Fall ist. Ausnahmen sind<br />
zulässig, wenn beispielsweise andernfalls<br />
der Aufwand für die Ersatzteilhaltung,<br />
Mitarbeiterschulung oder Wartung und<br />
Instandhaltung aus technischen oder wirtschaftlichen<br />
Gründen unvertretbar hoch<br />
wäre. Die weitere Frage ist deshalb, ob der<br />
Angebotsschwerpunkt auf produktspezifischen<br />
Angebotstexten liegt (z. B. AUS-<br />
SCHREIBEN.DE) oder ob ausschließlich<br />
produktneutrale Ausschreibungstexte offeriert<br />
werden (z. B. SIRADOS Baudaten).<br />
Gehören öffentliche und international ausgeschriebene<br />
Aufträge zum Tätigkeitsspektrum,<br />
sollte man auch auf Normen-Konformität,<br />
respektive mehrsprachige Texte<br />
achten. Sind zusätzliche Informationen und<br />
Daten enthalten, wie Einheitspreise, technische<br />
Informationen, Planskizzen oder Produktfotos,<br />
lassen sich auch Baukosten oder<br />
Angebote kalkulieren, Detailpläne zeichnen<br />
oder bebilderte und dadurch für Privatkunden<br />
attraktivere, weil anschaulichere Angebote<br />
erstellen. Angaben zu Einheitspreisen<br />
sollten aktuell sein, von Experten anhand<br />
von Marktdaten recherchiert werden oder<br />
aus abgerechneten Projekten stammen.<br />
Das gilt natürlich auch für die vorformulierten<br />
Ausschreibungstexte, die regelmäßig<br />
von Planern, respektive den Bauproduktherstellern<br />
geprüft und an aktuelle Entwicklungen<br />
angepasst werden sollten.<br />
Bei den Angaben zu den Kosten der Datenbank<br />
sollte man darauf achten, ob es sich<br />
um einen Kauf- oder Mietpreis handelt, respektive<br />
welche laufenden Kosten – etwa bei<br />
jeder Aktualisierung – zu berücksichtigen<br />
sind. Bei kostenpflichtigen Web-Lösungen<br />
respektive einer Software-Miete ist die<br />
Laufzeit des Mietvertrags wichtig. Welche<br />
Variante wirtschaftlicher ist, ob online oder<br />
offline, hängt vor allem von der Nutzungsdauer<br />
ab. Bei einer kurzfristigen Nutzung<br />
ist das Abonnement im Allgemeinen günstiger,<br />
eine Nutzung über mehrere Jahre ist<br />
meist als Offline-Variante sinnvoller.<br />
Wer bietet was?<br />
Folgende Datensammlungen für Ausschreibungen,<br />
Kostenkalkulationen und Angebote<br />
werden offeriert (ohne Anspruch auf<br />
Vollständigkeit):<br />
Die frei zugängliche und in viele AVA- und<br />
Handwerkerprogramme integrierte Online-Datenbank<br />
AUSSCHREIBEN.DE von<br />
ORCA Software bietet rund eine Million<br />
Leistungsbeschreibungen von Produktherstellern<br />
aus unterschiedlichen Gewerken<br />
sowie herstellerneutrale und normkonforme<br />
Texte zum kostenlosen Download. Die<br />
Texte werden von den Herstellern gepflegt<br />
und sind so stets aktuell. Suchfunktionen<br />
und eine klare Strukturierung ermöglichen<br />
eine schnelle LV-Zusammenstellung (www.<br />
ausschreiben.de).<br />
Offline- oder Online-Datenbanken bieten<br />
produktspezifische oder produktneutrale<br />
Ausschreibungstexte. © Heinze<br />
Dank zahlreicher Schnittstellen lassen sich die<br />
Daten praktisch in alle AVA- und Handwerkerprogramme<br />
importieren. © Orca Software<br />
BAUDATENBANK.AT von Info-Techno Baudatenbank<br />
ist ein Online-Portal für Baustoffe,<br />
Bau- und Ausstattungsprodukte für<br />
Planung, Kalkulation, Ausschreibung und<br />
Anwendung. Eine Produkt- und Firmendatenbank,<br />
herstellerspezifische CAD-/<br />
BIM-Daten, Preislisten und Normen gehören<br />
ebenso zum Leistungsumfang wie<br />
eine Ausschreibungstext-Datenbank. Diese<br />
bietet eine Vielzahl produktspezifischer<br />
LV-Texte von renommierten Herstellern aus<br />
den Bereichen Hochbau und Haustechnik<br />
nach ÖNORM B2063/A2063 und in anderen<br />
Formaten (www.bdb.at).
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
132<br />
edv<br />
Die kostenpflichtige Online-Datenbank BKI<br />
Positionen des Baukosteninformationszentrums<br />
enthält rund 5.600 Leistungspositionen<br />
aus 91 Gewerken mit über 13.000<br />
aktuellen Baupreisen, getrennt für die Bereiche<br />
Neu- und Altbau. Die Ausschreibungstexte<br />
sind von Fachverbänden geprüft und<br />
VOB-konform. Die statistischen Baupreise<br />
werden über die Auswertung abgerechneter<br />
Projekte ermittelt. Die Daten ermöglichen<br />
damit regelkonforme Ausschreibungen, präzise<br />
Kostenermittlungen und eine schnelle<br />
Prüfung von Baupreisen (www.bki.de).<br />
Einen alternativen Ansatz verfolgt Dr. Schiller<br />
& Partner mit DBD-BIM. Qualitäten und<br />
Kosten werden bereits während der BIM-/<br />
CAD-Planung definiert. Die dafür nötigen<br />
Baudaten wie Bauleistungen, Preise, Normen<br />
und Richtlinien stehen mit DBD-BIM<br />
direkt in der CAD-/BIM-Software passend<br />
zum bearbeiteten Bauteil zur Verfügung.<br />
Auch in BIM-fähigen AVA-Programmen lassen<br />
sich IFC-Bauteile bemustern, was eine<br />
durchgängige Datennutzung ermöglicht<br />
(www.dbd-bim.de).<br />
Auch in BIM-fähigen AVA-Programmen<br />
lassen sich IFC-Bauteile bemustern, was<br />
eine durchgängige Datennutzung ermöglicht<br />
(www.dbd-bim.de). Die kostenlose,<br />
nach Herstellern sortierte Online-Datensammlung<br />
Heinze Hersteller-Ausschreibungstexte<br />
von Heinze mit über 350.000<br />
produktspezifischen Leistungsbeschreibungen,<br />
Ausschreibungstexten und Muster-LVs<br />
von 410 Bau- und Ausstattungsprodukte-Herstellern<br />
beschleunigt die<br />
LV-Erstellung und erhöht die Rechtssicherheit.<br />
Einzelne Leistungsbeschreibungen<br />
oder ganze Strukturelemente werden entweder<br />
per GAEB-, Text- oder PDF-Format<br />
oder über eine direkte AVA-Schnittstelle<br />
in das aktuelle LV eingefügt. Mit den produktneutralen<br />
Stammpositionen Heinze<br />
Ausschreibungstexte vom gleichen Hersteller<br />
lassen sich Leistungsverzeichnisse<br />
schnell und präzise erstellen. Die vorformulierten<br />
Texte zu mehr als 40 Gewerken<br />
im Bereich Hochbau werden regelmäßig<br />
von Planern aktualisiert und beschleunigen<br />
die Erstellung rechtssicherer Leistungsverzeichnisse.<br />
Ebenfalls von Experten geprüfte<br />
Orientierungspreise und zugewiesene Kostengruppen<br />
runden die als Online- und Offline-Lösung<br />
erhältliche Datensammlung ab<br />
(www.heinze.de).<br />
LV-Texte – Leistungspositionen mit ZTV<br />
der Verlagsgesellschaft Rudolf-Müller enthalten<br />
über 5.500 Leistungspositionen aus<br />
40 Gewerken für Hoch- und Objektbau. Die<br />
Texte berücksichtigen auch Schnittstellen<br />
zu Vor- und Folgeleistungen. Einheitspreise<br />
und Kalkulationshinweise für die eigene<br />
Preisbildung vereinfachen die LV- und Angebotserstellung.<br />
Zusätzliche technische<br />
Vertragsbedingungen, Ausschreibungshinweise<br />
und eine Zuordnung zu Kostengruppen<br />
ergänzen das Angebot. Ein AVA-Datenimport<br />
ist über GAEB und native Formate<br />
möglich (www.besser-ausschreiben.de).<br />
STLB-Bau Online von DIN Bauportal offeriert<br />
mit mehr als einer Million Ausschreibungstexten<br />
aus 77 Gewerken eine umfangreiche<br />
Online-Sammlung aktueller, neutraler<br />
und VOB-gerechter Ausschreibungstexte.<br />
Die Datensammlung wird zweimal pro Jahr<br />
aktualisiert. Alle Ausschreibungstexte entsprechen<br />
der aktuellen VOB-<strong>Ausgabe</strong>, den<br />
einschlägigen technischen Regelwerken,<br />
den öffentlich rechtlichen Bestimmungen<br />
und den anerkannten Regeln der Technik<br />
(www.stlb-bau-online.de).<br />
Die sirAdos-Baudaten von WEKA Media<br />
werden in mehreren Varianten offeriert.<br />
Das Komplettpaket Architektur Premium<br />
enthält die Bereiche Neubau, Bauen im Bestand,<br />
Tiefbau/GaLa, Heizung, Lüftung, Sanitär,<br />
Elektro, Asbestsanierung, Reinigung/<br />
Wartung und Gebäudeelementen, inklusive<br />
VOB-Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen.<br />
Die Daten sind strukturiert und<br />
enthalten marktrecherchierte Baupreise,<br />
Zeitwerte, Skizzen und Kostengruppen. Die<br />
Daten lassen sich per GAEB-, DATANORM-,<br />
ÖNORM-, und weitere Schnittstellen importieren<br />
(www.sirados.de).<br />
Auf der Online-Baudatenbank www.euro-<br />
BAU.com der Inndata Datentechnik präsentieren<br />
rund 120 Anbieter ihre Produkte,<br />
davon 44 inklusive LV-Texten. Die kostenfreien<br />
produktspezifischen LV-Daten lassen<br />
sich per ÖNORM A 2063-Schnittstelle<br />
Weitere Infos und Quellen*<br />
https://besser-ausschreiben.de<br />
https://avanova.de/textsysteme<br />
www.cad.de<br />
Werden Bauteile bereits in der CAD-/BIM-Software<br />
beschrieben, lassen sich daraus VOB-konforme<br />
produktneutrale Leistungsbeschreibungen<br />
und Kosten generieren. © Dr. Schiller & Partner<br />
in AVA- oder Angebotsprogramme importieren.<br />
Integriert ist auch kostenpflichtiger<br />
BIM-Bauteilserver der nach ÖNORM<br />
A 6241-2 konforme Standardkalkulationen<br />
ermöglicht. BIM-Bauteile mit hinterlegten<br />
LV-Positionen sind kostenfrei (www.eurobau.com).<br />
Fazit und Trends<br />
Online-Datenbanken für Ausschreibungstexte<br />
und Preise rationalisieren die LV-Erstellung,<br />
machen sie komfortabler und<br />
sicherer, sofern die Daten regelmäßig aktualisiert<br />
werden. Sobald sich die modellorientierte<br />
Planung mittel- und langfristig<br />
durchsetzt, wird das auch die Bereiche<br />
Ausschreibung, Kostenplanung und Angebotskalkulation<br />
verändern. Ausschreibungstexte<br />
werden dann beispielsweise<br />
nicht mehr manuell zusammengestellt,<br />
sondern aus dem BIM-Modell automatisch<br />
generiert. DBD-BIM gibt hier die Richtung<br />
vor. Damit lassen sich Bauteile bereits in<br />
der CAD- oder BIM-Software beschreiben<br />
und bauteilorientiert verknüpfen. Daraus<br />
können normenkonforme, produktneutrale<br />
Leistungsbeschreibungen und Kosten<br />
generiert werden. Ein weiterer Trend sind<br />
BIM-Objektdatenbanken, die auch Ausschreibungs-<br />
und Kosteninformationen<br />
bieten sowie Ausschreibungstext-Datenbanken,<br />
die zunehmend BIM-Objekte offerieren.<br />
Langfristig wird wohl auch hier zusammenwachsen,<br />
was zusammengehört.<br />
Anbieter mit Ausschreibungstipps<br />
Übersicht LV-Textdatenbanken<br />
Rubrik „Foren AEC“, „AVA Bauwesen“<br />
Rösel, W./Busch, A.: AVA-Handbuch, Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung,<br />
9. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden 2017<br />
* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Jeder Einzelne von uns kann die Welt zum Besseren<br />
verändern. Helfen wir den Menschen in Äthiopien<br />
sich selbst zu helfen und die Armut zu besiegen!<br />
MEHR AUF MFM.AT<br />
Bankinstitut Raiffeisen<br />
IBAN AT28 3200 0000 0022 2000<br />
GEMEINSAM SIND WIR MENSCHEN FÜR MENSCHEN!<br />
Menschen für Menschen dankt für die Schaltung dieses Gratisinserats sowie PARTLHEWSON und der Werbeakademie für die Gestaltung.
Made of Stil.<br />
crona steel von Archirivolto.<br />
Den können Sie ruhig im Regen stehen lassen. Mit seinen ergonomisch<br />
geformten Flachstahlstreben passt crona steel zu jeder Umgebung<br />
und trotzt jedem Wetter – selbst in der Sitzkissenvariante. Mit den<br />
wasserfesten Polstern in verschiedenen Farben lassen sich auf Terrasse<br />
und Balkon die richtigen Akzente setzen. So sorgen Sie für eine starke<br />
Außenwirkung.<br />
www.selmer.at<br />
Exklusiver Partner der Brunner Group für Österreich<br />
www.brunner-group.com