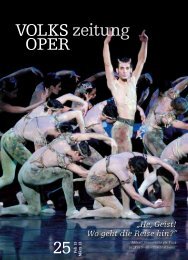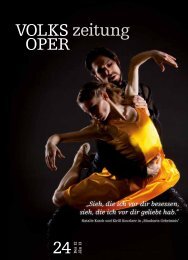Die lustigen Nibelungen - Volksoper Wien
Die lustigen Nibelungen - Volksoper Wien
Die lustigen Nibelungen - Volksoper Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Christian Drescher,<br />
Roman Sadnik,<br />
Michael Kraus<br />
Angesichts dieser Überlegungen ist Ernst<br />
Kreneks Werk „Kehraus um St. Stephan“ von<br />
schlechthin visionärer Größe: Er zeichnet eine<br />
skrupellose, machtgeile, ausbeuterische Gesellschaft<br />
des Herbstes 1918, erfüllt von politischem<br />
Zynismus, sozialer Gleichgültigkeit,<br />
grenzenloser Oberflächlichkeit und Geldsucht,<br />
wie sie in ihrer Ausschließlichkeit und Intensität,<br />
als Reinkultur sozusagen, eigentlich erst<br />
jetzt Realität geworden ist. Was Krenek damals<br />
als Satire bezeichnet hat, liest und hört sich<br />
heute als dramatisierte Dokumentation dieses<br />
real existierenden Materialismus, den wir als<br />
die „Beautiful People of the Western World“ im<br />
Global Village leben.<br />
Wenn er einen seiner Protagonisten, einen Fabrikbesitzer<br />
und Offizier, am Beginn des Wiederaufbaus singen lässt<br />
„Mit frischer Kraft ans alte Werk!“, erinnert mich das fatal<br />
an den Wahlslogan „Alles bleibt besser“ der ÖVP. Aber<br />
auch Statements anderer Figuren, wie zum Beispiel eines<br />
politischen Opportunisten, „Jetzt bin ich Demokrat und<br />
lebe von meiner Gesinnung“ (was heißen will, ich lasse<br />
mich für meine Gesinnung bezahlen und verkaufe sie an<br />
den Meistbietenden), könnten gut heute in den Gängen<br />
eines europäischen Parlaments fallen.<br />
Aber wie der oben angesprochene Christian Felber hat<br />
der visionäre Komponist und Künstler Ernst Krenek Hoffnung<br />
anzubieten: Er stattet einige Figuren durchaus mit<br />
Albert Pesendorfer Michael Kraus<br />
Andrea Bogner, Roman Sadnik<br />
einem Bewusstsein aus, das sie die Scheußlichkeit des<br />
Status quo erkennen lässt:<br />
„Kommt alles, wie es soll! Alles unters Rad! Das überrollt<br />
uns alle, wenn wir uns nicht befrei’n! Und an jedem selbst<br />
liegt’s, keiner hilft dir dabei, keine Gemeinschaft, keine<br />
Politik, keine Partei, keine Revolution, nur du selbst, allein!“<br />
(Alfred Koppreiter, 2. Teil, 16. Szene)<br />
Und auch die zwei Seiten von <strong>Wien</strong>, die er zwei seiner Figuren<br />
zeichnen lässt, sind an Schärfe kaum zu übertreffen:<br />
„Und dat jefällt mir so jut in eurem schönen <strong>Wien</strong>,<br />
dass man sich alles, alles richten kann.“ (Kabulke, 2. Teil,<br />
18. Szene)<br />
Einerseits – aber andererseits:<br />
„Darum lieb ich so diese Stadt, weil sie heute noch ein<br />
Spiegel – zerbrochen vielleicht –, aber jedes Stückchen<br />
zeigt immer noch den Abglanz von allen Farben, die einst<br />
leuchtend hineinfielen: Orient und Okzident, und der<br />
blaue Süden, wo das Leben leicht ist … und darum will<br />
ich hier sein.“ (Othmar Brandstetter, 1. Teil, . Szene)<br />
<strong>Die</strong>se Zeichnung einer zerbrochenen Welt ist damals die<br />
einer vom waffengewaltlichen Eingriff zerstörten Stadt<br />
<strong>Wien</strong> (wenn nicht der Häuser im Ersten Weltkrieg, so<br />
doch der Menschen – seelisch und körperlich). <strong>Die</strong> heute<br />
noch bestehende Gültigkeit dieses Bildes für <strong>Wien</strong> liegt ja<br />
nicht daran, dass danach noch ein Weltkrieg diese Stadt<br />
zerstört hat (dann nicht nur die Menschen in noch bestialischerer<br />
und noch dazu penibel selektiver Weise, sondern<br />
auch die Gebäude), sondern ein mehr als sechzig Jahre<br />
währender Friede, der allerdings Unsichtbares zerstört<br />
hat, das aber offenbar und Gott sei Dank nicht gänzlich