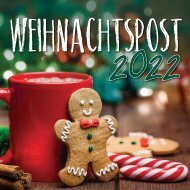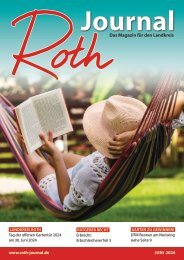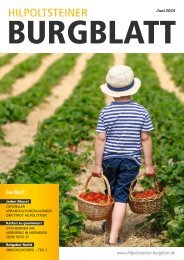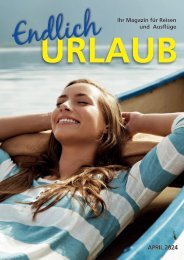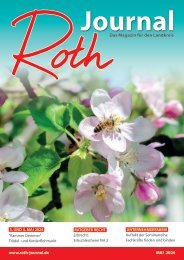Roth Journal_2021_06_01-28.red
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„ROTH IST BUNT“<br />
„Verbrannte Dichter“ – Online-Lesung<br />
„<strong>Roth</strong> ist bunt“ im „Bunten Landkreis <strong>Roth</strong>“<br />
Am 10. Mai jährte sich die „Bücherverbrennung“<br />
von 1933 zum 88. Mal.<br />
Da die von Sven Ehrhardt initiierte Lesung<br />
in 2020 der Pandemie zum Opfer<br />
fiel, wählten die Organisatoren „<strong>Roth</strong> ist<br />
bunt“, Stadtbücherei und die vhs im Landkreis<br />
<strong>Roth</strong> dieses Jahr für die Lesung das<br />
Online-Format mit „Gotomeeting“ und<br />
damit als Lesestätte die verschiedenen<br />
Wohn- oder Arbeitszimmern anstelle von<br />
Ratsstuben oder Stadtbücherei.<br />
18 interessierte Zuhörer verfolgten gebannt<br />
die unterschiedlichsten interessanten<br />
und bewegenden Beiträge. Da bei<br />
dieser Lesung vier Vertreter der „Bunten<br />
Initiativen“ im Landkreis vertreten waren,<br />
setzte das lose Bündnis ein starkes Zeichen<br />
für den „Bunten Landkreis <strong>Roth</strong>“.<br />
Nach einer Begrüßung durch den Schirmherrn,<br />
Herrn Ersten Bürgermeister Ralph<br />
Edelhäußer und der Koordinatorin von<br />
„<strong>Roth</strong> ist bunt“, eröffnete Herr Erster<br />
Bürgermeister Robert Pfann aus Schwanstetten<br />
die Lesung mit einem Auszug aus<br />
einem Buch des <strong>Journal</strong>isten Jürgen Serke<br />
„Die verbrannten Dichter“. In diesem<br />
Buch werden die Biographien von jüdischen<br />
Schriftstellern erzählt, deren Werke<br />
als „entartete Kunst“ bei der Bücherverbrennung<br />
durch die Nazis vernichtet<br />
wurden. Hier wählte er die Lebens- und<br />
Leidensgeschichte von Erich Mühsam mit<br />
dem Titel „Der Anarchist, der die Gewalt<br />
hasste“. Die Qual und die sinnlose Gewalt,<br />
die Erich Mühsams Sterben begleitete,<br />
machte die Zuhörer betroffen und der<br />
Sinn der Lesung, dass so etwas nie wieder<br />
geschehen dürfe, rückte bei diesem Beitrag<br />
besonders in den Fokus. Aber auch<br />
Mühsams starker Wille, sich nie feige zu<br />
ergeben, hallte noch nach.<br />
Herr Erster Bürgermeister Ralph Edelhäußer<br />
las danach Auszüge aus der Milieustudie<br />
„Berlin Alexanderplatz“, von Alfred<br />
Döblin, wo es um das Scheitern des einfachen<br />
Arbeiters Franz Bieberkopf ging, dem<br />
übel mitgespielt wurde und dessen Leben<br />
nicht recht gelingen wollte. Auch hier ging<br />
der Autor auf die menschlichen Abgründe<br />
und Schwächen ein, welche das Publikum<br />
mitfühlend zurückließen. Das Werk gilt<br />
nicht umsonst als einer der wichtigsten<br />
Romane der deutschsprachigen Literatur.<br />
„Tyho Brahes Weg zu Gott“ von Max Brod<br />
war der Lesebeitrag des Ersten Bürgermeisters<br />
Wolfram Göll aus Kammerstein.<br />
Max Brod ist nicht so sehr als Autor bekannt,<br />
sondern als Literatur-Nachlassverwalter<br />
seines Freundes Franz Kafka. Mit<br />
ihm und Franz Werfel verband Brod eine<br />
enge Freundschaft. Sein Protagonist Tycho<br />
Brahe war einer der bedeutendsten Astronomen<br />
seines Zeitalters. Er bewohnte eine<br />
eigene Insel mit Schloss und Sternwarte.<br />
Dort entwickelte er sein Weltsystem, mit<br />
dem er Kopernikus widersprach und die<br />
Erde im Zentrum des Universums behielt.<br />
Heute trägt die von Brahe entdeckte Supernova<br />
die Bezeichnung SN 1572.<br />
Auch für die Erklärung der einst so rätselhaften<br />
Erscheinungen der Kometen schuf<br />
Tycho Brahe eine wesentliche Voraussetzung.<br />
Er fand heraus, dass es sich um<br />
Himmelskörper handelt, die weiter als der<br />
Planet Saturn von der Erde entfernt sein<br />
können.<br />
Brahe verbrachte sein Leben damit, den<br />
Sternenhimmel möglichst exakt zu vermessen<br />
und erfand zu diesem Zweck sogar<br />
riesige neue Messinstrumente. Anhand<br />
seiner über viele Jahrzehnte hinweg<br />
gesammelten Himmelsdaten konnte Johannes<br />
Kepler, ein Assistent bei ihm, später<br />
die elliptische Bahn des Mars nachweisen.<br />
Bis dahin galt, dass sich die Planeten<br />
auf perfekten Kreisbahnen bewegen. Ein<br />
besonderes (körperliches) Merkmal Tycho<br />
Brahes war seine goldene Nase. Als Student<br />
hatte er einmal eine handfeste Auseinandersetzung<br />
mit einem Kommilitonen,<br />
der ihm einen Teil seiner Nase abschlug.<br />
Fortan trug Tycho eine Nasen-Prothese<br />
aus Gold und Silber.<br />
Als Vierter im Bunde las der Hilpoltsteiner<br />
CSU-Stadt- und Kreisrat Christoph Raithel<br />
aus dem Roman „Jud Süß“ von Lion<br />
Feuchtwanger. Abseits des eigentlichen<br />
Handlungskerns zeichnet Feuchtwanger<br />
ein facettenreiches, in Teilen dennoch<br />
klischeebehaftetes Bild des deutschen<br />
Judentums zur Zeit der Aufklärung. Die<br />
jüdischen Romanfiguren stehen im Spannungsfeld<br />
zwischen Armut und wirtschaftlichem<br />
Aufstieg, zwischen kollektiver Ohnmacht<br />
und individueller wirtschaftlicher<br />
Macht, zwischen der bewussten Abgrenzung<br />
gegenüber den Gojim (im weitesten<br />
Sinne alle Nichtjuden) und der Assimilation<br />
bis hin zur Annahme der christlichen<br />
Religion. Der durch seinen Geschäftssinn<br />
zu Geld und Macht gelangte Süß strebt<br />
danach, von den Christen als ebenbürtig<br />
anerkannt zu werden, will im Gegensatz<br />
zu seinem Bruder, dem Baron Tauffenberger,<br />
den jüdischen Glauben jedoch nicht<br />
ablegen. Der ebenfalls reiche und einflussreiche<br />
kurpfälzische Hoffaktor Landauer<br />
unterstreicht geradezu provokativ seine<br />
jüdische Identität durch Kleidung und Auftreten.<br />
Er strebt nach Macht, nicht nach<br />
ihren äußeren Zeichen und der Anerkennung<br />
durch die christliche Gesellschaft.<br />
Der Kabbalist Rabbi Gabriel, Onkel des<br />
Süß, wählt sogar den Weg der radikalen<br />
Weltabkehr.<br />
Jud Süß hieß eigentlich Joseph Süß Oppenheimer<br />
- im 18. Jahrhundert Finanzrat am<br />
württembergischen Hof von Herzog Karl<br />
Alexander - wird vom Volk bewundert, gefürchtet<br />
und zugleich verachtet. Um seine<br />
eigene Tochter vor dem Treiben am Stuttgarter<br />
Hof zu schützen, schickt Oppenheimer<br />
sie zu seinem Onkel, einem Rabbiner<br />
- der Herzog stellt ihr jedoch nach. Diesen<br />
Nachstellungen entzieht sie sich und begeht<br />
Selbstmord, was den Menschen Oppenheimer<br />
bricht.<br />
Später besinnt er sich aber und bietet sich<br />
- ganz auf seine rabbinischen Vorfahren<br />
besonnen - selbst als Sündenbock an und<br />
wird für sämtliche Machenschaften des<br />
intriganten und ausschweifenden Herzogs<br />
verantwortlich gemacht.<br />
Der Volkszorn richtet sich nun voll gegen<br />
ihn, er wird zum Tode verurteilt. Ein Urteil,<br />
das er abwenden hätte können, wenn er<br />
sich zum christliche Glauben bekannt hätte,<br />
was er nicht tat.<br />
Nun zum Autor: Lion Feuchtwanger, 1884<br />
in München, als Sohn eines Margarinefabrikanten,<br />
geboren, zählte in der Weimarer<br />
Republik zu den einflussreichen Persönlichkeiten<br />
im Literaturbetrieb. Er gilt heute<br />
>>><br />
<strong>06</strong> | <strong>2021</strong><br />
25