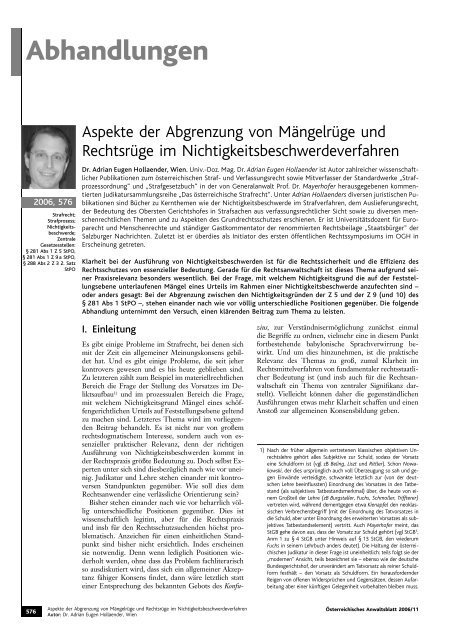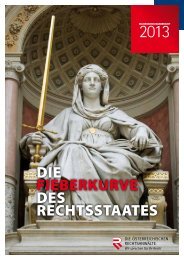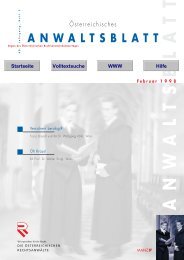Anwaltsblatt 2006/11 - Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Anwaltsblatt 2006/11 - Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Anwaltsblatt 2006/11 - Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abhandlungen<br />
576<br />
<strong>2006</strong>, 576<br />
Strafrecht;<br />
Strafprozess;<br />
Nichtigkeitsbeschwerde;<br />
Zentrale<br />
Gesetzesstellen:<br />
§ 281 Abs 1 Z 5 StPO,<br />
§ 281 Abs 1 Z 9 a StPO,<br />
§ 288 Abs 2 Z 3 2. Satz<br />
StPO<br />
Aspekte der Abgrenzung von Mängelrüge und<br />
Rechtsrüge im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren<br />
Dr. Adrian Eugen Hollaender, Wien. Univ.-Doz. Mag. Dr. Adrian Eugen Hollaender ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher<br />
Publikationen zum österreichischen Straf- und Verfassungsrecht sowie Mitverfasser der Standardwerke „Strafprozessordnung“<br />
und „Strafgesetzbuch“ in der von Generalanwalt Prof. Dr. Mayerhofer herausgegebenen kommentierten<br />
Judikatursammlungsreihe „Das österreichische Strafrecht“. UnterAdrian Hollaenders diversen juristischen Publikationen<br />
sind Bücher zu Kernthemen wie der Nichtigkeitsbeschwerde im Strafverfahren, dem Auslieferungsrecht,<br />
der Bedeutung des Obersten Gerichtshofes in Strafsachen aus verfassungsrechtlicher Sicht sowie zu diversen menschenrechtlichen<br />
Themen und zu Aspekten des Grundrechtsschutzes erschienen. Er ist Universitätsdozent für Europarecht<br />
und Menschenrechte und ständiger Gastkommentator der renommierten Rechtsbeilage „Staatsbürger“ der<br />
Salzburger Nachrichten. Zuletzt ist er überdies als Initiator des ersten öffentlichen Rechtssymposiums im OGH in<br />
Erscheinung getreten.<br />
Klarheit bei der Ausführung von Nichtigkeitsbeschwerden ist für die Rechtssicherheit und die Effizienz des<br />
Rechtsschutzes von essenzieller Bedeutung. Gerade für die Rechtsanwaltschaft ist dieses Thema aufgrund seiner<br />
Praxisrelevanz besonders wesentlich. Bei der Frage, mit welchem Nichtigkeitsgrund die auf der Feststellungsebene<br />
unterlaufenen Mängel eines Urteils im Rahmen einer Nichtigkeitsbeschwerde anzufechten sind –<br />
oder anders gesagt: Bei der Abgrenzung zwischen den Nichtigkeitsgründen der Z 5 und der Z 9 (und 10) des<br />
§ 281 Abs 1 StPO –, stehen einander nach wie vor völlig unterschiedliche Positionen gegenüber. Die folgende<br />
Abhandlung unternimmt den Versuch, einen klärenden Beitrag zum Thema zu leisten.<br />
I. Einleitung<br />
Es gibt einige Probleme im Strafrecht, bei denen sich<br />
mit der Zeit ein allgemeiner Meinungskonsens gebildet<br />
hat. Und es gibt einige Probleme, die seit jeher<br />
kontrovers gewesen und es bis heute geblieben sind.<br />
Zu letzteren zählt zum Beispiel im materiellrechtlichen<br />
Bereich die Frage der Stellung des Vorsatzes im Deliktsaufbau<br />
1) und im prozessualen Bereich die Frage,<br />
mit welchem Nichtigkeitsgrund Mängel eines schöffengerichtlichen<br />
Urteils auf Feststellungsebene geltend<br />
zu machen sind. Letzteres Thema wird im vorliegenden<br />
Beitrag behandelt. Es ist nicht nur von großem<br />
rechtsdogmatischem Interesse, sondern auch von essenzieller<br />
praktischer Relevanz, denn der richtigen<br />
Ausführung von Nichtigkeitsbeschwerden kommt in<br />
der Rechtspraxis größte Bedeutung zu. Doch selbst Experten<br />
unter sich sind diesbezüglich nach wie vor uneinig.<br />
Judikatur und Lehre stehen einander mit kontroversen<br />
Standpunkten gegenüber. Wie soll dies dem<br />
Rechtsanwender eine verlässliche Orientierung sein?<br />
Bisher stehen einander nach wie vor beharrlich völlig<br />
unterschiedliche Positionen gegenüber. Dies ist<br />
wissenschaftlich legitim, aber für die Rechtspraxis<br />
und insb für den Rechtsschutzsuchenden höchst problematisch.<br />
Anzeichen für einen einheitlichen Standpunkt<br />
sind bisher nicht ersichtlich. Indes erscheinen<br />
sie notwendig. Denn wenn lediglich Positionen wiederholt<br />
werden, ohne dass das Problem fachliterarisch<br />
so ausdiskutiert wird, dass sich ein allgemeiner Akzeptanz<br />
fähiger Konsens findet, dann wäre letztlich statt<br />
einer Entsprechung des bekannten Gebots des Konfu-<br />
Aspekte der Abgrenzung von Mängelrüge und Rechtsrüge im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren<br />
Autor: Dr. Adrian Eugen Hollaender, Wien<br />
zius, zur Verständnisermöglichung zunächst einmal<br />
die Begriffe zu ordnen, vielmehr eine in diesem Punkt<br />
fortbestehende babylonische Sprachverwirrung bewirkt.<br />
Und um dies hinzunehmen, ist die praktische<br />
Relevanz des Themas zu groß, zumal Klarheit im<br />
Rechtsmittelverfahren von fundamentaler rechtsstaatlicher<br />
Bedeutung ist (und insb auch für die Rechtsanwaltschaft<br />
ein Thema von zentraler Signifikanz darstellt).<br />
Vielleicht können daher die gegenständlichen<br />
Ausführungen etwas mehr Klarheit schaffen und einen<br />
Anstoß zur allgemeinen Konsensbildung geben.<br />
1) Nach der früher allgemein vertretenen klassischen objektiven Unrechtslehre<br />
gehört alles Subjektive zur Schuld, sodass der Vorsatz<br />
eine Schuldform ist (vgl zB Beling, Liszt und Rittler). Schon Nowakowski,<br />
der dies ursprünglich auch voll Überzeugung so sah und gegen<br />
Einwände verteidigte, schwankte letztlich zur (von der deutschen<br />
Lehre beeinflussten) Einordnung des Vorsatzes in den Tatbestand<br />
(als subjektives Tatbestandsmerkmal) über, die heute von einem<br />
Großteil der Lehre (zB Burgstaller, Fuchs, Schmoller, Triffterer)<br />
vertreten wird, während dementgegen etwa Kienapfel den neoklassischen<br />
Verbrechensbegriff (mit der Einordnung des Tatvorsatzes in<br />
die Schuld, aber unter Einordnung des erweiterten Vorsatzes als subjektives<br />
Tatbestandselement) vertritt. Auch Mayerhofer meint, das<br />
StGB gehe davon aus, dass der Vorsatz zur Schuld gehört (vgl StGB 5 ,<br />
Anm 1 zu § 4 StGB unter Hinweis auf § 13 StGB, den wiederum<br />
Fuchs in seinem Lehrbuch anders deutet). Die Haltung der österreichischen<br />
Judikatur in dieser Frage ist uneinheitlich: teils folgt sie der<br />
„modernen“ Ansicht, teils bezeichnet sie – ebenso wie der deutsche<br />
Bundesgerichtshof, der unverändert am Tatvorsatz als reiner Schuldform<br />
festhält – den Vorsatz als Schuldform. Ein herausfordernder<br />
Reigen von offenen Widersprüchen und Gegensätzen, dessen Aufarbeitung<br />
aber einer künftigen Gelegenheit vorbehalten bleiben muss.<br />
Österreichisches <strong>Anwaltsblatt</strong> <strong>2006</strong>/<strong>11</strong>