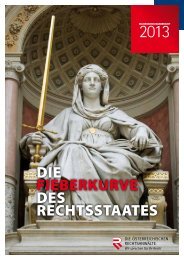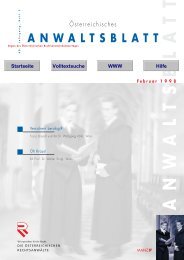Anwaltsblatt 2006/11 - Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Anwaltsblatt 2006/11 - Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Anwaltsblatt 2006/11 - Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abhandlungen<br />
580<br />
Gründe nicht angibt, aus denen es diese Beweise für<br />
nicht stichhältig erachtet.<br />
Als mit einem inneren Widerspruch behaftet wird<br />
der Ausspruch des Gerichtes über entscheidende Tatsachen<br />
dann angesehen, wenn das Urteil entscheidungswesentliche<br />
Erwägungen enthält, die nach den<br />
Gesetzen logischen Denkens einander ausschließen.<br />
Es geht somit um die Feststellung verschiedener Tatsachen<br />
oder um Schlussfolgerungen tatsächlicher<br />
Art, die nach den Gesetzen logischen Denkens nicht<br />
nebeneinander bestehen können (zB verschiedene<br />
Angaben über den Tatort, soweit dieser Frage im gegebenen<br />
Zusammenhang entscheidende Bedeutung für<br />
die Schuldfrage zukommt).<br />
Keine oder nur offenbar unzureichende Gründe<br />
liegen hingegen vor, wenn für den Ausspruch über eine<br />
entscheidende Tatsache überhaupt keine Gründe<br />
oder nur solche angeführt sind, aus denen sich nach<br />
den Denkgesetzen oder nach allgemeiner Lebenserfahrung<br />
ein Schluss auf die zu begründende Tatsache<br />
entweder überhaupt nicht ziehen lässt, oder der logische<br />
Zusammenhang kaum noch erkennbar ist. Erfasst<br />
werden Verstöße gegen die Logik, gegen die Denkgesetze<br />
und gegen gesichertes (allgemeines) Erfahrungswissen.<br />
Aktenwidrigkeit des Urteils wiederum liegt vor,<br />
wenn in den Entscheidungsgründen als Inhalt einer<br />
Urkunde oder Aussage etwas angeführt wird, was deren<br />
Inhalt nicht bildet, wenn also der Inhalt einer Aussage<br />
oder eines anderen Beweismittels im Urteil unrichtig<br />
oder in verzerrender Weise unvollständig<br />
wiedergegeben wird.<br />
Im Hinblick auf die sich aus dem Vorgesagten ergebende<br />
Aufspaltung von Feststellungs- und Begründungsebene<br />
im Rahmen der Z 5 lässt sich somit der<br />
Anwendungsbereich der Z 5 (iSd vorstehend referierten<br />
Position) insgesamt wie folgt beschreiben: 20)<br />
" Undeutlichkeit: Feststellungs- und Begründungsebene,<br />
" Unvollständigkeit: nur Begründungsebene,<br />
" innerer Widerspruch: Feststellungs- und Begründungsebene,<br />
" keine oder offenbar unzureichende Gründe: nur<br />
die Begründungsebene,<br />
" Aktenwidrigkeit: nur die Begründungsebene.<br />
Was bedeutet dieser differenzierende Standpunkt<br />
nun? Nichts anderes, als dass es bei der Undeutlichkeit<br />
zu Überschneidungen kommen kann. Ist nämlich<br />
nach der vorreferierten Position bei einer undeutlichen<br />
Feststellung dennoch für das Rechtsmittelgericht<br />
klar, dass die Tatrichter die entscheidenden Tatsachen<br />
feststellen wollten, liegt keine Nichtigkeit nach<br />
Z 9 oder Z 10 vor, sondern allenfalls eine nach Z 5, sofern<br />
die Unvollständigkeit nach Z 5 angefochten<br />
wurde (da es bezüglich der Nichtigkeit nach Z 5 keine<br />
Aspekte der Abgrenzung von Mängelrüge und Rechtsrüge im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren<br />
Autor: Dr. Adrian Eugen Hollaender, Wien<br />
amtswegige Wahrnehmung gibt). Z 9 und 10 betreffen<br />
demnach nur den Willen der Tatrichter, der für<br />
das Rechtsmittelgericht unzweideutig feststehen muss,<br />
um materielle Nichtigkeit zu vermeiden, während Z5<br />
die gelungene Darstellung betrifft (deshalb wird die<br />
Rüge nach Z 5 auch Darstellungsrüge genannt).<br />
Nach dieser differenzierenden Position würde auch<br />
die klassische Faustregel, 21) dass der Mangel an Feststellungen<br />
über das Vorhandensein der einzelnen Tatbestandsmerkmale<br />
nach Z 9 anzufechten ist, während<br />
das Fehlen einer Begründung dafür, warum ein Tatbestandsmerkmal<br />
als erwiesen angenommen worden ist,<br />
nach Z 5 zu bekämpfen ist (das bedeutet also: Feststellungsmängel<br />
> Z 9 a, 9 b, 9 c und 10; hingegen Begründungsmängel<br />
> Z 5) nicht – oder zumindest nicht ausnahmslos<br />
– zutreffend sein.<br />
VI. Fazit<br />
1. Angesichts der insofern bis heute fortbestehenden<br />
Uneinigkeit zwischen Lehre und Judikatur (aber<br />
auch der Judikatur selbst in ihrer zeitlichen Entwicklung<br />
und zudem in der – wie dargestellt – auch heute<br />
teilweise unterschiedlichen Behandlung der einzelnen<br />
Fallgruppen der Z 5) empfehlen in dieser wichtigen<br />
Frage manche praxisbezogene Formbücher 22) auch<br />
heutzutage vorsorglich die doppelte (also „aushilfsweise“<br />
zusätzliche) Geltendmachung von Feststellungsmängeln<br />
unter Z5 und Z9. Dies mag im Interesse<br />
des Rechtsschutzes pragmatisch erscheinen, 23) verwischt<br />
aber jede Abgrenzung und begünstigt eigentlich<br />
nur die Unsicherheit bei den Rechtsmittelwerbern<br />
und vermehrt solcherart die bestehende Konfusion. 24)<br />
Was kann also gegen eine solche, dem Rechtsschutz<br />
abträgliche Uneinheitlichkeit der vertretenen Positionen<br />
in einer für die Anfechtung schöffengerichtlicher<br />
(und analog dazu auch anderer) Urteile wesentlichen<br />
Kernfrage getan werden? Wie kann nun zu deren<br />
Aufklärung und somit zu einer – die diesbezüglich<br />
wünschenswerte und rechtsstaatlich wesentliche<br />
Rechtssicherheit im Rechtsmittelverfahren ermöglichenden<br />
– Lösung beigetragen werden?<br />
2. Entweder man entscheidet sich für die Ansicht der<br />
überwiegenden Lehre, alle mangelnden Feststellungen<br />
mit dem Nichtigkeitsgrund der Z5zu relevieren<br />
und solcherart unter den Begriff des „unvollständigen<br />
20) Vgl Ratz, aaO.<br />
21) Heidrich, Urteile und andere Entscheidungen im Strafverfahren 169.<br />
22) Zöchling, Schriftsätze, Urteile, Rechtsmittel in Strafsachen 3 263,<br />
Bsp 2.<br />
23) Zumal es in einer Nichtigkeitsbeschwerde freilich rechtlich nicht<br />
schadet, gilt doch in Bezug auf die ziffernmäßige Einordnung der<br />
Nichtigkeitsgründe insofern der Grundsatz „falsa demonstratio<br />
non nocet“.<br />
24) Siehe auch FN 6.<br />
Österreichisches <strong>Anwaltsblatt</strong> <strong>2006</strong>/<strong>11</strong>