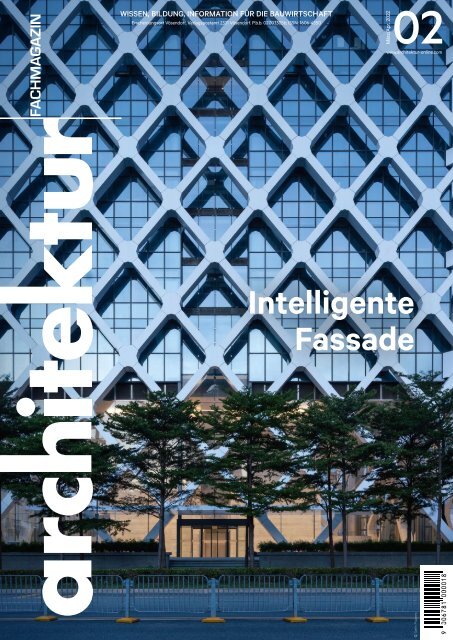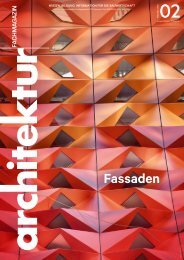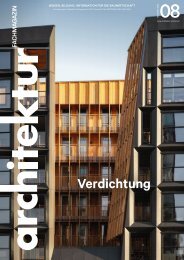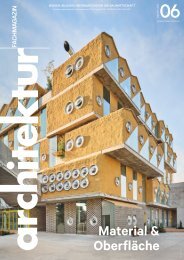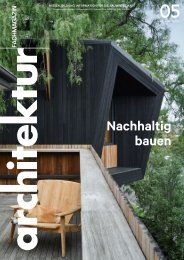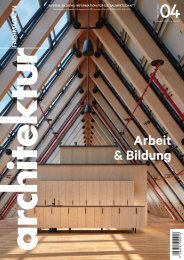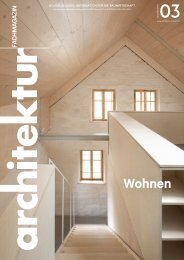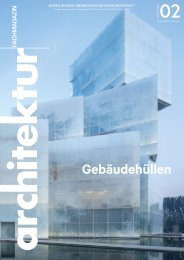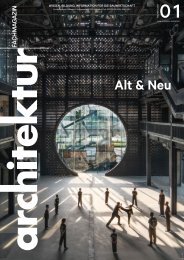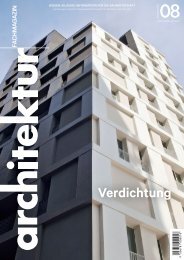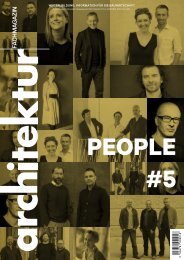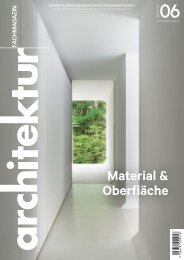architektur FACHMAGAZIN Ausgabe 2 2022
Gebäude energieeffizienter und resilienter gegen Umwelteinflüsse zu machen, ist eine der großen Aufgaben moderner Architektur. Die Fassade, als äußerste Schutzhülle, bietet hier besonders großes Potenzial. Probleme wie zu hoher Hitzeeintrag, die schon hier gelöst werden, entlasten vor allem die Haustechnik und können bei der Energiebilanz entscheidend sein. Doch moderne Fassaden können mehr. Sie erzeugen Strom, lüften selbstständig, kühlen überhitzte Städte und bieten mitunter sogar Lebensraum für allerlei Tiere. So legen sie einen Grundstein für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Die Projektberichte, die wir für diese Ausgabe zusammengestellt haben, könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie spannen den Bogen zwischen smarten High-Tech- sowie cleveren Low-Tech-Ansätzen.
Gebäude energieeffizienter und resilienter gegen Umwelteinflüsse zu machen, ist eine der großen Aufgaben moderner Architektur. Die Fassade, als äußerste Schutzhülle, bietet hier besonders großes Potenzial. Probleme wie zu hoher Hitzeeintrag, die schon hier gelöst werden, entlasten vor allem die Haustechnik und können bei der Energiebilanz entscheidend sein. Doch moderne Fassaden können mehr. Sie erzeugen Strom, lüften selbstständig, kühlen überhitzte Städte und bieten mitunter sogar Lebensraum für allerlei Tiere. So legen sie einen Grundstein für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.
Die Projektberichte, die wir für diese Ausgabe zusammengestellt haben, könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie spannen den Bogen zwischen smarten High-Tech- sowie cleveren Low-Tech-Ansätzen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
WISSEN, BILDUNG, INFORMATION FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT<br />
Erscheinungsort Vösendorf, Verlagspostamt 2331 Vösendorf. P.b.b. 02Z033056; ISSN: 1606-4550<br />
02<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
März/Apr. <strong>2022</strong><br />
Intelligente<br />
Fassade<br />
© Seth Powers
CIELUMA<br />
DER LICHTHIMMEL<br />
Z.LIGHTING | ZUMTOBEL.COM/CIELUMA
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
3<br />
Auch auf die Hülle kommt es an<br />
Gebäude energieeffizienter und resilienter gegen Umwelteinflüsse zu machen,<br />
ist eine der großen Aufgaben moderner Architektur. Die Fassade, als äußerste<br />
Schutzhülle, bietet hier besonders großes Potenzial. Probleme wie zu hoher Hitzeeintrag,<br />
die schon hier gelöst werden, entlasten vor allem die Haustechnik und<br />
können bei der Energiebilanz entscheidend sein. Doch moderne Fassaden können<br />
mehr. Sie erzeugen Strom, lüften selbstständig, kühlen überhitzte Städte und<br />
bieten mitunter sogar Lebensraum für allerlei Tiere. So legen sie einen Grundstein<br />
für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.<br />
Die Projektberichte, die wir für diese <strong>Ausgabe</strong><br />
zusammengestellt haben, könnten<br />
kaum unterschiedlicher sein. Sie spannen<br />
den Bogen zwischen smarten High-Techsowie<br />
cleveren Low-Tech-Ansätzen.<br />
Ein gelungenes Zusammenspiel aus<br />
aktiven und passiven Maßnahmen zur<br />
Gebäudeklimatisierung zeigt das Architekturbüro<br />
Skidmore, Owings & Merrill<br />
(SOM). Sie realisierten in der chinesischen<br />
Millionenstadt Shenzhen ein „atmendes“<br />
Hochhaus mit natürlicher Belüftung,<br />
basierend auf einer Struktur aus<br />
außenliegenden, sich diagonal kreuzenden<br />
Trägern. Ebenfalls in China realisierten<br />
CLOU architects mit dem FarmLab einen<br />
Multifunktionsbau, der sich vor allem<br />
Editorial<br />
der Forschung in den Bereichen Landwirtschaft<br />
und Tourismus widmet. Rund<br />
um die innovativen Arbeits- und Präsentationsbereiche<br />
im Inneren legt sich eine<br />
ebenso smarte Rasterfassade.<br />
Beim Neubau des Amts für Umwelt und<br />
Energie in Basel ist der Name Programm.<br />
Besonderes Gestaltungsmerkmal des von<br />
jessenvollenweider entworfenen Nullenergiehauses<br />
in Holz-Beton-Hybridbauweise,<br />
ist die leichte Photovoltaikfassade,<br />
die ein flexibles Raum- und Tragsystem<br />
umhüllt.<br />
Weniger Technik, dafür umso mehr Grün<br />
bietet ein vom Büro Maison Edouard<br />
François gestaltetes Wohnquartier auf<br />
dem Areal eines ehemaligen Fußballstadions.<br />
Dieses offeriert nämlich nicht nur<br />
qualitativen Wohn- und Lebensraum,<br />
sondern auch eine der größten begrünten<br />
Fassaden Europas.<br />
Das neue dreizehnstöckige Gebäude der<br />
Buckle Street Studios im Londoner Stadtteil<br />
Whitechapel wiederum überzeugt vor<br />
allem auf ästhetischer Ebene. Das New<br />
Yorker Design Studio Grzywinski+Pons<br />
entwarf eine dreigeteilte Fassade, die sich<br />
perfekt in das dichte Konglomerat von Gebäuden<br />
verschiedenster Epochen einfügt.<br />
Abgerundet wird das Leitthema durch ein<br />
Interview mit Architekt und Professor Dr.<br />
Philipp Lionel Molter. Er erklärt seine Arbeitsweise<br />
an praktischen Beispielen und<br />
gewährt einen Einblick, was eine intelligente<br />
Fassade in seinen Augen auszeichnet.<br />
Im Schwerpunkt RETAIL<strong>architektur</strong> dreht<br />
sich diesmal alles um kleine, aber feine<br />
Shop-Konzepte. Zum Abschluss zeigen wir<br />
in der Rubrik EDV, warum Künstliche Intelligenz<br />
auch im Baubereich zu den Schlüsseltechnologien<br />
der nächsten Jahre gehört.<br />
Andreas Laser<br />
Design zum Wohlfühlen<br />
- bei Tag und Nacht.<br />
Die neue Zetra Lamelle für Raff storen<br />
Der SonnenLicht Manager<br />
Maximale Abdunkelung bei Tag und Nacht<br />
Geradlinige Geometrie für eine harmonische Fassadenoptik<br />
Maximale Gestaltungsfreiheit - von Farbe bis Oberfl äche<br />
Jetzt Muster bestellen: www.warema.at/zetra-muster<br />
Jetzt auf unserer<br />
Digitalmesse:<br />
www.sunlight-interactive.de
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
4<br />
36<br />
Inhalt<br />
Editorial 03<br />
Architekturszene 06<br />
Die grüne Fassade der Moderne<br />
Magazin 12<br />
Bau & Recht 24<br />
Suffizienz als 26<br />
Entwurfsstrategie<br />
Interview mit Architekt und Professor<br />
Dr. Philipp Lionel Molter<br />
Atmungsaktive Architektur 30<br />
Shenzhen Rural Commercial Bank<br />
Headquarters / Shenzhen, China / SOM<br />
Schimmerndes Sonnenkleid 36<br />
Amt für Umwelt und Energie /<br />
Basel, Schweiz / jessenvollenweider<br />
Gläserne Krone 42<br />
Buckle Street Studios / London /<br />
Grzywinski+Pons<br />
Kreuz und quer gedacht 48<br />
Sanya Jinmao FarmLab /<br />
Hainan, China / CLOU architects<br />
Urbanes Wohnen im Grünen 54<br />
Le Ray / Nizza /<br />
Maison Edouard François<br />
RETAIL<strong>architektur</strong> 60<br />
Produkt News 74<br />
edv 94<br />
KI am Bau: Maschinell<br />
planen und bauen<br />
30<br />
42 48<br />
54<br />
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Laser Verlag GmbH; Ortsstraße 212/2/5, 2331 Vösendorf, Österreich<br />
CHEFREDAKTION Andreas Laser (andreas.laser@laserverlag.at)<br />
REDAKTION DI Linda Pezzei, Edina Obermoser, Dolores Stuttner, DI Marian Behaneck,<br />
GESCHÄFTSLEITUNG Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n LTG. PRODUKTREDAKTION Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14<br />
GRAFISCHE GESTALTUNG & WEB Andreas Laser n LEKTORAT Mag. Heidrun Schwinger n DRUCK Bauer Medien & Handels GmbH<br />
ABONNEMENTS Abonnement (jeweils 8 <strong>Ausgabe</strong>n/Jahr): € 94,- / Ausland: € 115,-, bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):<br />
€ 64,- / Ausland: € 91,- (Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht mind. 6 Wochen vor Erscheinen der letzten <strong>Ausgabe</strong> eine schriftliche Kündigung bei uns einlangt.)<br />
EINZELHEFTPREIS € 14,- / Ausland € 18,-<br />
BANKVERBINDUNG BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000<br />
IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v; n ISSN: 1606-4550<br />
Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen. Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mitglied<br />
der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Gästehaus Textilakademie NRW, Mönchengladbach, Deutschland I slapa oberholz pszczulny | architekten<br />
concrete skin<br />
| Fassadenplatten aus Glasfaserbeton<br />
| Lebendiger und authentischer Materialcharakter<br />
| Brandschutzklasse A1 – nicht brennbar<br />
| Neue Farben und Texturen<br />
www.rieder.cc | | #riederfacades
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
6<br />
Architekturszene<br />
Die grüne Fassade<br />
der Moderne<br />
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Städten. Derzeit ist<br />
davon auszugehen, dass sich der Anteil an Stadtbewohnern in Zukunft weiter vergrößert.<br />
Dabei sind Städte heute für mehr als 70 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs<br />
und der Erzeugung von CO 2 -Emissionen verantwortlich. Es stellt sich daher<br />
durchaus die Frage, ob urbane Konglomerationen zum Erreichen der Klimaziele nicht<br />
kontraproduktiv sind. Laut Architekt Rudi Scheuermann ist die voranschreitende<br />
Urbanisierung und Globalisierung aber nicht etwa das Problem, sondern vielmehr<br />
ein Teil der Lösung.<br />
Text: Dolores Stuttner<br />
Wird nämlich der CO 2 -Ausstoß in einer Großstadt pro<br />
Kopf ermittelt, fällt der Wert in urbanen Arealen um<br />
bis zu 40 Prozent geringer aus als in dünn besiedelten<br />
Gebieten. Für die bessere Umweltbilanz sind kleinere<br />
Wohnräume, die vermehrte Nutzung des Öffentlichen<br />
Verkehrs und kürzere Wege verantwortlich.<br />
Und trotzdem stehen auch Städte vor der Herausforderung,<br />
bis 2050 klimaneutral zu werden. Gemäß<br />
Experten ist der Einsatz von Stadtbegrünung, erneuerbarer<br />
Energie und nachhaltiger Mobilitätskonzepte<br />
dafür unverzichtbar. Große Entwicklungen gab es in<br />
den letzten Jahren vor allem in Bezug auf Fassadenund<br />
Dachbegrünungen.<br />
u<br />
Amtsgebäude der MA 48 am Wiener Gürtel<br />
© C. Fürthner
7<br />
Holz und Aluminium stilvoll und funktional kombiniert: Die BEGA<br />
Systempollerleuchten mit extrem langlebigen Holzpollerrohren setzen<br />
qualitativ Maßstäbe und optisch Akzente. Das Accoya ® -Holz aus<br />
nachhaltiger Forstwirtschaft bereichert den Einsatzbereich dieser<br />
Leuchten um das angenehme Gefühl von Wärme und Natürlichkeit.<br />
BEGA Leuchten GmbH – Competence Center Innsbruck · Grabenweg 3<br />
6020 Innsbruck · Telefon 0512 34 31 50 · Fax 0512 34 31 50 89<br />
info-austria@bega.com · www.bega.com<br />
Architekturszene<br />
Das gute Licht.<br />
Für natürliche Akzente.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
8<br />
Architekturszene<br />
Das 2016 sanierte Gebäude der MA 31 im 6. Wiener Gemeindebezirk<br />
© Salama Iman<br />
Die Folgen des Klimawandels eindämmen<br />
– Lebensqualität steigern<br />
Begrünte Städte helfen nicht nur bei der<br />
Bekämpfung des Klimawandels, sondern<br />
sie steigern langfristig auch die Wohn- und<br />
Lebensqualität der Bewohner. Pflanzen an<br />
der Fassade wirken obendrein wärme- und<br />
schalldämmend. Mit ihnen ist es möglich,<br />
störende Umgebungsgeräusche im Gebäude<br />
zu reduzieren – im Winter fungieren sie<br />
als lokale Isolation, wobei sie die Wärme<br />
speichern, während sie im Sommer einen<br />
kühlenden Effekt haben. Der Dämmungseffekt<br />
der Fassadenbegrünung ist dadurch<br />
mit positiven Auswirkungen auf die Heizkosten<br />
und den CO 2 -Verbrauch durch Klimageräte<br />
verbunden.<br />
Nicht zu vernachlässigen ist schließlich der<br />
gestalterische Effekt grüner Hausfassaden.<br />
Sie werten das Gebäude und – in weiterer<br />
Folge – den betreffenden Stadtteil ästhetisch<br />
auf.<br />
Werden zusätzlich Dachbegrünungen realisiert,<br />
findet damit eine Rückgabe versiegelter<br />
Flächen an die Natur statt. Kleintieren<br />
wird somit mehr Lebensraum in urbanen<br />
Gebieten zur Verfügung gestellt, wobei die<br />
Pflanzen Vögeln und Bienen Nahrungsquellen<br />
und Nistplätze bieten. Ist ausreichend<br />
Fläche vorhanden, lassen sich bepflanzte<br />
Dachbereiche auch von Menschen zur Erholung<br />
nutzen.<br />
Stadtbegrünung als essenzielle<br />
Zutat für die zukunftsfähige Stadt<br />
Die Stadtbegrünung leistet also zweifelsohne<br />
einen essenziellen Beitrag zum Klimaschutz.<br />
Um nachhaltige Veränderung zu<br />
erzielen, darf die grüne Architektur gemäß<br />
Scheuermann aber nicht bloße „Zutat“ bei<br />
Neubauten sein. Nicht selten wird das üppige<br />
Grün an den Fassaden bei sogenannten<br />
Nachhaltigkeitsprojekten zu Marketingzwecken<br />
genutzt. Die Frage nach dem Klimaschutz<br />
stellt sich besonders dann, wenn der<br />
Bestand solchen Neubauten weichen muss.<br />
Laut Architekt Scheuermann setzen Städte,<br />
die dies oft nicht nötig hätten, auf kostspielige<br />
und ressourcenintensive Wohntürme,<br />
die durch grüne Wände umweltbewusst erscheinen<br />
sollen. Wollen Planer ein Quartier<br />
tatsächlich klimaneutral gestaltet, geht es<br />
in erster Linie darum, Instandhaltungs- und<br />
Sanierungsmöglichkeiten auszuloten.<br />
Natürlich ist unbestritten, dass Begrünungen<br />
von Dächern und Fassaden die Auswirkungen<br />
des Klimawandels eindämmen. Im<br />
Sommer heizen sich die betreffenden Bauteile<br />
nicht so stark auf, wobei sich die Verdunstungskälte<br />
der Pflanzen auch für die<br />
Kühlung des Innenbereichs einsetzen lässt.<br />
Bei intelligenter Planung ist es sogar möglich,<br />
Grünelemente mit Photovoltaik zu kombinieren.<br />
Diese Anlagen arbeiten bei mittleren<br />
Temperaturen äußerst effektiv, wodurch<br />
es also die Dach- und Fassadenbegrünung<br />
schafft, deren Effizienz zu maximieren.<br />
Klimaneutral wird ein Stadtteil aber erst<br />
dann, wenn die Fassadenbepflanzung in<br />
Kombination mit umweltschonender Architektur<br />
zum Einsatz kommt. Positivbeispiel<br />
für die Umsetzung einer grünen Fassade am<br />
Bestand ist das Amtsgebäude der MA 48<br />
am Wiener Gürtel. Auf einer Fläche von 850<br />
Quadratmetern wurden nach den Plänen<br />
von Rataplan Architektur 2.850 Laufmeter<br />
Pflanzentröge aus Aluminium angebracht.<br />
Die Verkleidung aus 17.000 Pflanzen dient<br />
auf dem Bau aus den 1960er-Jahren nicht<br />
nur dem CO 2 -Ausgleich, sondern sie ist<br />
gleichzeitig Wärme- und Schalldämmung.<br />
Ursachen statt Symptome bekämpfen<br />
Mit der Stadt- und Gebäudebegrünung<br />
wird es niemals möglich sein, die Auslöser<br />
des Klimawandels zunichte zu machen. Die<br />
nachhaltige Gebäudeverkleidung lindert<br />
zwar die Symptome, aber nicht die Ursache<br />
der globalen Erwärmung. Es spricht<br />
selbstverständlich nichts dagegen, die<br />
Auswirkungen der zunehmenden Luftverschmutzung<br />
und Temperaturzunahme in<br />
Siedlungsgebieten auf diese Weise zu mildern.<br />
Allerdings ist die Baubranche dazu<br />
angehalten, weitreichendere Lösungen für<br />
eines der wohl größten Probleme der heutigen<br />
Zeit zu finden.<br />
Anstatt auf kostspielige und CO 2 -lastige<br />
Prestigeprojekte mit grünen Fassaden zu<br />
setzen, empfiehlt es sich eher, bestehende<br />
Objekte zu begrünen und so im Kleinen zu<br />
agieren. Das Ziel besteht darin, die Bepflanzung<br />
an Fassaden und Dächern zur Selbstverständlichkeit<br />
werden zu lassen – und<br />
das nicht nur bei Großprojekten. u
Max Exterior Oberflächen:<br />
• kreative Freiheit<br />
• individuelle Gestaltungsmöglichkeiten<br />
• Fassadengestaltung, Balkonbekleidungen<br />
und Outdoor-Möbel<br />
9<br />
Magazin<br />
Fundermax GmbH<br />
office@fundermax.at<br />
www.fundermax.at<br />
„Sei das Original,<br />
nicht die Kopie.“<br />
(Hannes K., Architekt)
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
10<br />
Architekturszene<br />
Stadthaus M1 in Freiburg<br />
© Zooey Braun<br />
Das Zusammenspiel der Materialien<br />
Die Kombination von Pflanzen und Fassaden<br />
verlangt Architekten auch ein genaues Wissen<br />
über Bausubstanzen und deren Eigenschaften<br />
ab. Ist ein Haus zu begrünen, muss<br />
dieses in einwandfreiem Zustand sein. Liegt<br />
eine hohe Widerstandsfähigkeit vor, können<br />
auf dem Gebäude selbst Haftwurzler wie<br />
Wilder Wein oder Efeu wachsen. Allein aus<br />
diesem Grund werden Fassadenbegrünungen<br />
häufig auf Neubauten installiert. Bereits<br />
während dem Hausbau ist es möglich, die<br />
Anbringung der Bepflanzung mit einzuplanen<br />
und die Außenhülle entsprechend robust<br />
zu gestalten – besonders gut eignen<br />
sich Aluminium- und Stahlfassaden. Noch<br />
junge Fassaden haben zudem den Vorteil,<br />
frei von Rissen zu sein.<br />
Das heißt allerdings nicht, dass bei Altbauten<br />
auf Begrünungen dieser Art verzichtet<br />
werden muss. Allerdings ist im Vorfeld der<br />
Zustand der Fassade genau zu untersuchen.<br />
Bestimmte Pflanzenarten können bei<br />
Materialien, die bereits in die Jahre gekommen<br />
sind, etwaige Schäden verschlimmern.<br />
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn<br />
sich erwähnte Haftwurzler in Spalten oder<br />
Rissen festsetzen. Aus diesem Grund eignen<br />
sich Häuser mit Verkleidungen aus<br />
Schindeln oder vorgehängten Wandplatten<br />
ebenfalls schlecht für die Bepflanzung.<br />
Dass Fassadenbegrünung am Bestand<br />
funktioniert, zeigt das 2016 sanierte Gebäude<br />
der MA 31 im 6. Wiener Gemeindebezirk.<br />
In diesem Fall wurde die Bepflanzung am<br />
Bau aus den 1960er-Jahren nicht direkt angebracht<br />
– die Installation erfolgt über eine<br />
Tragkonstruktion, die die Architekten von<br />
Rataplan auf eigenem Fundament vor das<br />
Gebäude stellten.<br />
Beliebt ist aber nicht nur die Fassadenbegrünung<br />
mit Kletterpflanzen, sondern auch<br />
die Bepflanzung von Bauten mithilfe von<br />
Trögen. Solche Maßnahmen sind von den<br />
zuständigen Architekten bereits bei der<br />
Planung mitzudenken. Andere Varianten –<br />
wie beispielsweise Tragkonstruktionen für<br />
Ranken – lassen sich aber auch im Nachhinein<br />
realisieren.<br />
Die Fassadenbegrünung<br />
dem Gebäude anpassen<br />
Heute ist es auf unterschiedliche Weise<br />
möglich, Pflanzen an die Fassade zu bringen.<br />
Bei Alt- sowie bei Bestandsbauten erfreut<br />
sich vor allem die Fassadenbegrünung<br />
mit Kletterpflanzen großer Beliebtheit.<br />
Durch die Unterstützung ausgeklügelter<br />
Ranksysteme lassen sich die Gewächse an<br />
der Wand hinauf leiten. Hierbei wird zwischen<br />
einem Edelstahlseilnetz und einem<br />
Gerüstsystem zur Rankhilfe unterschieden.<br />
Das Seilkonstrukt leitet die Pflanzen<br />
mit einer Kombination aus Edelstahlseilen<br />
und Klemmen in die gewünschte Richtung,<br />
während das Gerüst als Stütze entlang der<br />
Wand fungiert – gelungen setzten diese<br />
Technik die Architekten Barkow Leibinger<br />
am Stadthaus M1 in Freiburg um.<br />
Experten bedienen sich heute aber auch der<br />
flächigen Fassadenbegrünung. Diese setzt<br />
sich aus bepflanzten Vliesmodulen mit einer<br />
Unterkonstruktion als Verbindungselement<br />
zusammen. Dadurch ist es möglich, die Konstrukte<br />
mit der Fassade zu verbinden – die<br />
Außenhaut des Gebäudes ist damit bereits<br />
nach der Montage begrünt, sodass keine<br />
langen Wuchszeiten abgewartet werden<br />
müssen. Die Pflanzen wachsen des Weiteren<br />
in der Fassade selbst, womit eine hohe<br />
Gestaltungsvielfalt gegeben ist – das Beund<br />
Entwässerungssystem ist übrigens in<br />
die Bauteile integriert und von außen nicht<br />
zu sehen. Da die begrünten Elemente bereits<br />
mit der gewünschten Bepflanzung geliefert<br />
werden, ist es ganz einfach möglich,<br />
die Fassadenbegrünung in sämtlichen Teil-
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
11<br />
Magazin<br />
bereichen und Höhen unterzubringen. Der<br />
Einsatz dieser Variante ist natürlich mit höheren<br />
Baukosten verbunden, wobei sie sich<br />
fast ausschließlich für Neubauten eignet.<br />
Geht es um den Klimaschutz, ist die Fassadenbegrünung<br />
für den Städtebau sicherlich<br />
eine wichtige Ergänzung. Sie<br />
zählt mittlerweile zu den Maßnahmen, die<br />
in der Stadt der Zukunft als essenzielle<br />
Zutat gehandelt wird, wobei sie nicht nur<br />
dem Umweltschutz, sondern obendrein der<br />
Lebens- und Wohnqualität dient. Das Problem<br />
des Klimaschutzes vermag die Gebäudebegrünung<br />
aber allein nicht zu lösen.<br />
Architekten stehen heute vor der Herausforderung,<br />
die Bauplanung ganzheitlich zu<br />
betrachten – es gilt, veraltete Strukturen<br />
zu durchbrechen und den Lebenszyklus<br />
von Baumaterialien und Gebäuden zu maximieren.<br />
Dabei ist zu bedenken, dass die<br />
Konstruktion von neuen Gebäuden mit<br />
einem hohen CO 2 -Verbrauch einhergeht.<br />
Kurz gesagt: Auch eine noch so grüne<br />
Stadt, kann die negativen Folgen der Materialverschwendung<br />
nicht ausgleichen. •<br />
Stadthaus M1 in Freiburg<br />
© Zooey Braun<br />
Solargründach<br />
System-Symbiose für nachhaltige Städte<br />
Solargründächer verbinden viele Vorteile:<br />
Effizienzsteigerung der Photovoltaikanlage<br />
Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes<br />
Biodiversitätssteigerung<br />
Erfüllung von Einleitbeschränkungen<br />
OPTIGRÜN-SOLAR<br />
ist eine auflastgehaltende Solaraufständerung.<br />
Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 1 und 9.<br />
Optigrün international AG | optigruen.at
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
12<br />
Magazin
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
13<br />
Magazin<br />
Vom Wolkenkratzer<br />
zum Baumhaus<br />
404 Bäume, 4.620 Sträucher und fast 2.500 m 2 Gras, Blumen und Kletterpflanzen<br />
– was wie ein Konzept für Park- oder Grünflächen klingt, ist die begrünte Fassade<br />
zweier Wohntürme. Mit dem Easyhome Huanggang Vertical Forest City Complex<br />
brachten Stefano Boeri Architetti ein Stück vertikalen Wald nach Huanggang. Die<br />
Hochhäuser zeigen, wie man urbanes Grün in neuen Dimensionen denkt und so<br />
die Natur in die Stadt bringt.<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: RAW VISION studio<br />
Auf dem über 4.5 Hektar großen Areal in der Metropole<br />
in der Provinz Hubei entstehen mit dem<br />
Easyhome-Komplex neue Wohn-, Hotel- und Gewerbeflächen.<br />
Die fertiggestellten Türme sind die ersten<br />
beiden – von insgesamt fünf – und den italienischen<br />
Architekten zufolge der erste vertikale Wald Chinas.<br />
Mit dieser Typologie beschäftigten sich Stefano<br />
Boeri und sein Team bereits beim Bosco Verticale in<br />
Mailand und vielen anderen Projekten. Für die Fassade<br />
der chinesischen Wohnbauten kombinierten sie<br />
offene und geschlossene Balkone, die sich in einem<br />
diagonalen Muster und in unterschiedlichen Größen<br />
aneinanderfügen. Während die verglasten Loggien<br />
die Ansichten der 80 m hohen Türme wie 3D-Pixel<br />
überziehen, wachsen in den Freiräumen dazwischen<br />
Bäume, Sträucher und andere Pflanzen aus großen<br />
Trögen. Sie umspielen die Fenster, ranken sich an den<br />
Fassaden entlang in die Höhe oder hängen nach unten<br />
und umrahmen die Aussicht der Bewohner. Der<br />
Blick in die natürliche Umgebung soll ein naturnahes,<br />
urbanes Wohnerlebnis bieten.<br />
Bei der Bepflanzung setzte die Botanikerin und Landschaftsarchitektin<br />
Laura Gatti auf lokale Arten. Neben<br />
chinesischem Ginkgo kamen immergrüne Bäume<br />
mit duftenden Blüten sowie Ahorn, Bambus und kleinere<br />
Weidengewächse zum Einsatz. Dazwischen verdichten<br />
Gräser den vertikalen Wald. Die spezifischen<br />
Eigenschaften wie Laubfärbung, Wuchshöhe und<br />
Ausrichtung der Vegetation wurden in die Gestaltung<br />
der Wohntürme miteinbezogen. Die lebendigen<br />
Ansichten sorgen aber nicht nur für einen grünen<br />
Farbtupfer in der Stadt, der sich mit den Jahreszeiten<br />
verändert, sondern haben zudem einen positiven<br />
Einfluss auf das Klima: Laut Berechnungen der Planer<br />
nimmt die bewachsene Hülle pro Jahr 22 Tonnen<br />
CO 2 auf und produziert gleichzeitig 11 Tonnen Sauerstoff.<br />
Mit diesen klimaaktiven Qualitäten birgt das<br />
Projekt insbesondere für asiatische Großstädte mit<br />
hoher Luftverschmutzung interessante Chancen und<br />
trägt vielleicht dazu bei, dass in Zukunft – Mensch<br />
und Planet zuliebe – auch in China mehr urbane Räume<br />
überwiegend Grün statt Grau gebaut werden.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
14<br />
Magazin<br />
Hightech Blattgrün<br />
Mit einer begrünten Fassade setzt das Hotel Gilbert im 7. Bezirk in Wien Maßstäbe<br />
in der nachhaltigen Klimawandelanpassung. Bei dem im Herbst vergangenen Jahres<br />
eröffneten Beherbergungsbetrieb ist neben der Dachflächenbegrünung und<br />
dem Pflanzkonzept der Innenräume die begrünte Fassade ein integraler Bestandteil<br />
der Gebäude<strong>architektur</strong>.<br />
Fotos: Wolf-Dieter Grabner, Sempergreen
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
15<br />
Magazin<br />
Zum Einsatz kam dafür das Living-Wall-System des<br />
holländischen Begrünungsspezialisten Sempergreen,<br />
das vom Wiener Büro Green4Cities geplant und speziell<br />
für das Gilbert an den Standort in der Breite<br />
Gasse 9 angepasst wurde: Ein individueller, ganzjährig<br />
grüner Pflanzenmix aus Gräsern, Stauden und<br />
Gehölzen sorgt dort an heißen Sommertagen durch<br />
die natürliche Verdunstung für eine Kühlleistung<br />
zwischen 250 bis 337 kWh pro Tag. Das entspricht<br />
ungefähr der Leistung von fünf Raumklimageräten<br />
über den gleichen Zeitraum. Gemeinsam mit der aktiven<br />
Kühlung durch den Verdunstungseffekt ist so für<br />
deutliche Abkühlung gesorgt – um bis zu 3° Celsius.<br />
Hinter der Pflanzenwand schläft es sich aber nicht<br />
nur aus Temperaturgründen besser: Um rund 10<br />
Dezibel verringert die bepflanzte Gebäudehülle die<br />
Lärmbelastung. Der Geräuschpegel wird also – die<br />
Skala verläuft exponentiell – halbiert.<br />
Die einzelnen Paneele dieses Fassaden-Systems<br />
wurden im Glashaus unter optimalen Bedingungen<br />
vorkultiviert und fertig begrünt angeliefert. Durch<br />
die automatisch gesteuerte und über Sensoren überwachte<br />
Wasser- und Nährstoffversorgung erhalten<br />
die Pflanzen in den Cradle-to-Cradle zertifizierten<br />
Fassadenteilen nun auch genau das, was sie zum<br />
Wachsen benötigen – die Living Wall kümmert sich<br />
sozusagen um sich selbst, einzig für den Pflanzenschnitt<br />
müssen die Hausgärtner noch Hand anlegen.<br />
Die Neugestaltung des Gilbert leistet einen aktiven<br />
Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel – die Fassade<br />
speichert etwa 1 kg CO 2 /m 2 im Jahr –, und ist<br />
vor allem eine Maßnahme zur Klimawandelanpassung.<br />
Gemeinsam mit umfangreicher Bepflanzung<br />
der Terrassen im Dachgeschoß, Begrünung des Innenhofes<br />
und einem modernen Pflanzkonzept für<br />
den Innenbereich ist die ganzjährig grüne Gebäudefront<br />
ein Beitrag zu einer belebten Stadt, die nicht<br />
nur für Menschen lebenswert ist, sondern in der auch<br />
Biodiversität und Artenvielfalt ihren Platz finden. Als<br />
Grüninsel ist sie dauerhafter oder temporärer Lebensraum<br />
für unzählige Arten von Vögeln und Insekten<br />
und trägt so auch entscheidend zum Artenschutz<br />
in der Stadt bei.<br />
WER<br />
SUCHET<br />
ERFINDET.<br />
Setzen Sie auf die CLArin von ASCHL. Punkt.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
16<br />
Magazin<br />
Textil-Twist<br />
Lang Vonier Architekten realisierten mit Gantner Instruments IV in Schruns<br />
bereits das vierte Projekt für den Prüf- und Messgerätehersteller. Nach der Errichtung<br />
der Firmenzentrale, einer Erweiterung und einem Innenumbau gestalteten<br />
die ebenfalls in der Vorarlberger Gemeinde ansässigen Planer nun einen kompakten<br />
Anbau. Dieser tanzt mit seiner textilen Fassade subtil aus der Reihe und sorgt<br />
so für einen dynamischen Twist.<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Lang Vonier Architekten<br />
Gantner Instruments legte großen Wert darauf, dass<br />
der Unternehmenssitz nicht nur räumliche Anforderungen<br />
erfüllt, sondern auch zur Firmenphilosophie<br />
passt. Bereits der längliche Haupttrakt wurde deshalb<br />
so gestaltet, dass er wachsen und sich flexibel<br />
an neue Bedürfnisse anpassen kann. Im Zuge der<br />
vierten Erweiterung dockt jetzt ein schlichter Kubus<br />
an den Bestand an. Der Neubau beinhaltet über drei<br />
Etagen verteilt Labor- und Versuchsräume im Erdgeschoss<br />
sowie Büro- und Arbeitsflächen in den oberen<br />
Bereichen, die sich rund um einen Erschließungskern<br />
mit zentralem Oberlicht anordnen. Der Zugang zum<br />
Annex erfolgt ausschließlich über eine Brücke im ersten<br />
Stock vom Hauptgebäude aus. Dieses bleibt mit<br />
seiner zentralen Treppe und der Gemeinschaftszone<br />
weiterhin das Herzstück des Headquarters. Wie auch<br />
der Riegelbau ist das neue Volumen orthogonal zur<br />
vorbeiführenden Straße positioniert und hat die gleiche<br />
Breite, steht jedoch leicht versetzt ein paar Meter<br />
weiter innen am Grundstück. Der quadratische Anbau<br />
ist in Stahlbeton ausgeführt. Anders als beim bestehenden<br />
Gebäude – wo der Beton außen konventionell<br />
gedämmt, verputzt und abschließend rundum mit<br />
einer Fassade aus Metalllamellen verkleidet wurde –<br />
entschieden sich die Architekten hier für einen anderen<br />
Ansatz: Sie ließen den grauen Sichtbeton außen<br />
sichtbar und kombinierten ihn mit einer innenliegenden<br />
Schaumglasdämmung, die mit Gips verspachtelt<br />
wurde. Die Oberfläche ergibt leicht angeschliffen eine<br />
raue, lebendige Struktur. Lediglich vereinzelte, neuralgische<br />
Stellen hydrophobierte man.<br />
u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
17<br />
Magazin<br />
Thermisch sanieren<br />
Dämmung rauf,<br />
Kosten runter!<br />
Warm im Winter – kühl im Sommer<br />
Eine effiziente Dämmung der Außenwände schützt im<br />
Winter nicht nur vor Kälte, sondern auch im Sommer vor<br />
Überhitzung. Bei der thermischen Sanierung der Außenwand<br />
ist die Baumit open air KlimaschutzFassade die erste Wahl.<br />
Baumit open air ist die kostengünstigste atmungsaktive<br />
Fassadendämmung. Baumit open air ist<br />
atmungsaktiv wie ein Ziegel und<br />
dämmt mit 99 % Luft.<br />
Hier mehr<br />
erfahren:<br />
■ Energie sparen und Klima schützen<br />
■ für ein behagliches & gesundes Raumklima<br />
■ hohe Lebensdauer<br />
Baumit. Ideen mit Zukunft.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
18<br />
Magazin<br />
Die Außenansichten umhüllt in den oberen zwei<br />
Dritteln des Baukörpers eine textile Fassade. Sie<br />
setzt sich aus drei Streifen zusammen, die das Volumen<br />
horizontal umschließen. Als Unterkonstruktion<br />
für die Membranen dient ein Stahlrahmensystem.<br />
Rechteckige Formrohre verbinden die Stahlbügel<br />
mit den Fassadenprofilen, in denen die Bahnen<br />
eingespannt sind. Da die vorgehängte Struktur im<br />
Grundriss um vier Grad verdreht wurde, variiert der<br />
Abstand zwischen den beiden Schichten der Gebäudehülle.<br />
Diese leichte Rotation verleiht dem Annexbau<br />
nicht nur eine gewisse Dynamik, sondern hat<br />
zudem konstruktive Gründe: An den Berührungspunkten<br />
befestigte man den Stahlrahmen an den<br />
Betonwänden. Über die Ansichten zieht sich eine<br />
schwarz-weiße Punktewolke, die je nach Blickwinkel<br />
dichter oder lockerer wirkt und auf einem Luftbild<br />
der Region basiert. Das Konzept für das abstrahierte<br />
Muster entstand gemeinsam mit der Grafikagentur<br />
Sägenvier aus Dornbirn. Besonders spannend fanden<br />
Lang Vonier Architekten den Effekt der transluzenten<br />
Gebäudehülle, die sich je nach Licht und<br />
Tageszeit verändert: Während sie von außen tagsüber<br />
eher geschlossen erscheint, macht sie den Bau<br />
nachts zum diffusen Leuchtkörper. In den Innenräumen<br />
nimmt man die Membran hingegen kaum wahr.<br />
Dort lässt sie Blicke nach draußen nahezu uneingeschränkt<br />
zu, schützt aber gleichzeitig vor Sonne und<br />
Blendung. Besonders erfreulich: Trotz etwas höherer<br />
Kosten setzte man beim gesamten Projekt auf Regionalität<br />
und wählte für Planung und Umsetzung<br />
ausschließlich lokale Unternehmen.<br />
•
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
19<br />
Magazin<br />
Urbanes Leben –<br />
ohne Unterbrechung<br />
KONE 24/7 Connected Services liefert wertvolle Informationen über anstehende Wartungsanforderungen und<br />
identifiziert potenzielle Probleme, bevor sie Störungen verursachen. Wir vernetzen Ihre Aufzüge, Rolltreppen<br />
und automatischen Gebäudetüren mit unserem cloud-basierten Service und nutzen auf künstlicher Intelligenz<br />
basierende Analysen, um klügere vorausschauende Wartungsentscheidungen zu treffen, die den Personenfluss<br />
in Gebäuden auf ein ganz neues Niveau heben.<br />
kone.at
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
20<br />
Magazin<br />
Energetische<br />
Innovation aus Holz<br />
Einen neuen städtebaulichen Maßstab setzten a+r Architekten mit der „Westspitze“.<br />
Mit dem Gewerbe- und Bürobau aus Holz realisierten sie das erste Holz-Hybrid-Gebäude<br />
in dieser Größenordnung in Deutschland. Das siebengeschossige<br />
Bauwerk wird als Musterbeispiel für Klimafreundlichkeit angesehen und hat sich<br />
in Tübingen bereits als „kompaktes Kraftwerk der Nachhaltigkeit“ einen Namen<br />
gemacht – verantwortlich dafür, ist nicht zuletzt die fast unsichtbare Solarfassade.<br />
Die energieerzeugende Außenhaut arbeitet effizient, wobei sie optisch nicht<br />
zu technisch wirkt.<br />
Text: Dolores Stuttner Fotos: Brigida Gonzalez
21<br />
Magazin<br />
Die PV-Elemente mit farbiger Beschichtung integrieren<br />
sich geradezu spielend in die pulverbeschichtete,<br />
vorgehängte Außenhaut aus Aluminiumblech. Je<br />
nach Lichteinfall ändert die Fassade ihre Farbe, was<br />
den Bau lebendig – und bisweilen gar emotional –<br />
wirken lässt.<br />
Die Holz-Hybrid-Bauweise stellte die Architekten<br />
zweifelsohne vor eine Herausforderung – zur Meisterung<br />
des Zusammenspiels der Materialien war bei<br />
der Planung als auch beim Bau ein genaues Vorgehen<br />
gefragt. Es galt nämlich, die Fassadengeometrie<br />
den Anforderungen des Holz-Tragwerks anzupassen.<br />
Die Raumdecken und die Außenwand bestehen aus<br />
rund 1.100 Kubikmetern Fichtenholz. Gemäß den Architekten<br />
handelt es sich dabei um über 1.000 Tonnen<br />
gebundenes CO 2 , wobei im Vergleich zum Bauen<br />
mit Stahlbeton ebenfalls weniger CO 2 -Verbrauch<br />
stattfand. Die Holz-Hybrid-Bauweise ist damit eine<br />
effektive ökologische Alternative zu konventionellen<br />
Baustoffen – das Innovationsprojekt zeigt auf, dass<br />
sich die noch junge Technik auch bei Hochhäusern sicher<br />
einsetzen lässt. Bereits ab dem ersten Geschoss<br />
wurde das Tragwerk des Gewerbegebäudes in dieser<br />
Ausführung errichtet, während die Planer Beton und<br />
Stahl so sparsam wie möglich anwendeten. Als Beispiel<br />
sind hier die Zimmerdecken zu erwähnen: diese<br />
setzen sich aus einem Holz-Brettschicht-Verbund<br />
mit sieben Metern Spannweite und Aufbeton von nur<br />
zehn Zentimetern zusammen.<br />
Klimagerechte Bauweise fand auch in der Innenraumgestaltung<br />
Einzug. Für jede Ebene sahen die Planer<br />
vertikale Gärten aus Orchideen, Farnen und anderen<br />
Regenwaldpflanzen vor. Die Atmosphäre gleicht auf<br />
den 4.500 m 2 Gewerbefläche damit einem Gewächshaus,<br />
sorgt für Komfort und Wohlbefinden.<br />
Visuell ansprechend und durchaus atmosphärisch ist<br />
des Weiteren die Holz-Verbund-Bauweise an den Unterseiten<br />
der Zimmerdecken sowie den Stützen der<br />
Fassade. Durch raumhohe Verglasungen werden die<br />
Räume durch Tageslicht erhellt. In Kombination mit<br />
der natürlichen Beleuchtung und dem weißen Mobiliar<br />
schafft die freundliche, offene Gestaltung der<br />
Zimmer ein einladendes Gefühl von Weite.<br />
Bei der Raumaufteilung stoßen intime Zonen auf offene<br />
Bereiche. So befinden sich im Gebäude nicht<br />
nur Büros – das Erdgeschoss wurde speziell für die<br />
Abhaltung von Kongressen, Events und anderen<br />
Großveranstaltungen konzipiert, während im siebten<br />
Stock ein Gemeinschaftsraum mit Terrasse allen<br />
Mietern zur Verfügung steht.<br />
Das Tübinger Innovationsprojekt zeigt auf, wie sich<br />
eine klimagerechte Holz-Hybrid-Bauform auch in<br />
Form von Gewerbeeinrichtungen realisieren lässt.<br />
Das Ziel der Architekten – und auch der Bauherrin<br />
Westspitze Gewerbebau GmbH – war es, ein Gebäude<br />
mit langlebiger und wartungsarmer Fassadenverkleidung<br />
auf hölzernem Grundgerüst zu entwickeln;<br />
energetisch wurde die Einhaltung des KfW-55-Standards<br />
angestrebt. Das Vorhaben der Planer ging mit<br />
ihrem Büroturm am Fuße eines jungen Wohnquartiers<br />
voll auf. Auch bei Mietern stieß das einzigartige<br />
Design auf Anklang – nur wenige Wochen nach<br />
seiner Fertigstellung im August 2020 war das Haus<br />
vollständig bezogen.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
22<br />
Magazin<br />
Hightech-Hülle<br />
Gegenüber des historischen Universitätsgeländes der Harvard University entsteht<br />
auf der anderen Seite des Charles River im Bostoner Stadtteil Allston ein<br />
neuer Campus, der die nachhaltige Ausrichtung der renommierten Hochschule<br />
zeigen soll. Mit dem Science and Engineering Complex (SEC) planten Behnisch Architekten<br />
eines der ersten Gebäude am neuen Standort. Dafür entwickelten sie ein<br />
Forschungs- und Lehrgebäude mit innovativem Fassaden- und Lüftungssystem.<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Brad Feinknopf<br />
Auf 50.000 m 2 finden in dem Neubau der School of<br />
Engineering and Applied Science (SEAS) Labore,<br />
Schulungs- und Seminarräume nebeneinander Platz.<br />
Sie verteilen sich auf drei achtstöckige Volumen, die<br />
sich rund um zwei Atrien legen und auf Terrassengeschossen<br />
ruhen. Die ersten drei Etagen gehen mit<br />
ihren begrünten Dachterrassen stufenweise in die<br />
südlichen Freiflächen über. Sämtliche Grünflächen<br />
tragen maßgeblich zu einem angenehmen Klima auf<br />
dem Gelände bei. Gemeinsam mit Transsolar arbeitete<br />
das Planerteam ein effizientes Klima- und Energiekonzept<br />
für den Bau aus. Dieses setzt sich aus einer<br />
intelligenten Fassade und einem optimierten System<br />
zusammen, das mittels natürlicher Belüftung den<br />
Lüftungsbedarf um bis zu einem Drittel senkt. Das<br />
verringert die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu ähnlichen<br />
Forschungsbauten um 50% und brachte dem<br />
Projekt eine LEED-Platinum-Auszeichung ein.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
23<br />
Magazin<br />
Eine Dreifachverglasung mit Fenstern zur Frischluftzufuhr<br />
bildet die erste Schicht und den thermischen<br />
Abschluss der intelligenten Gebäudehülle. Davor<br />
legt sich in den obersten vier Stockwerken ein feststehender<br />
Sonnenschutz aus 12.000 filigranen Edelstahlelementen<br />
in 14 Formen, der zum charakteristischen<br />
Merkmal des Universitätsgebäudes wird. Mit<br />
den Ingenieuren von Knippers Helbig entwickelten<br />
die Architekten die erste hydrogeformte Fassade. Die<br />
einzelnen Paneele presste man dafür mit dem Verfahren<br />
aus der Automobilindustrie mittels Innendruck in<br />
die jeweilige Form. Für maximale Stabilität und niedrige<br />
Blendung wurden die 1.5 mm dünnen Bleche anschließend<br />
gefaltet und perforiert. Jedes Einzelteil<br />
des Brisesoleils ist perfekt auf seine Position und<br />
die Sonneneinstrahlung abgestimmt. Die Verschattungselemente<br />
ermöglichen Ausblicke nach draußen<br />
und lenken das Tageslicht gleichzeitig angenehm in<br />
die Forschungs- und Lehrräume. Je nach Jahreszeit<br />
reduziert das Fassadensystem Kühl- und Heizlast sowie<br />
Gebäudetechnik um bis zu 65%. Im Sockel und<br />
den terrassierten Geschossen prägen Fensterbänder<br />
und bodentiefe Verglasungen das Bild. In den Atrien<br />
gibt es öffenbare Elemente zur Nachtluftkühlung und<br />
außenliegende, horizontale Lamellen. Sie komplettieren<br />
die innovative Gebäudehülle des Bildungsbaus<br />
auf dem neuen Harvard-Campus, schützen vor Überhitzung<br />
und lassen diffuses Licht ins Innere.<br />
SKYFOLD<br />
Das vertikale Trennwandsystem öffnet sich<br />
komplett in den Deckenbereich. Es ist platzsparend,<br />
benötigt keine Führungs- oder<br />
Laufschienen und bietet Schalldämmung<br />
bis zu Rw 59 dB. Die elegante, stabile<br />
Trennwand lässt sich per Knopfdruck schnell<br />
und vollautomatisch Verfahren.<br />
T +43 732 600451<br />
offi ce@dorma-hueppe.at<br />
www.dorma-hueppe.at
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
24<br />
Bau & Recht<br />
Pop-up-Stores und<br />
Showroom-Konzepte<br />
Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 haben auch den Wirtschaftssektor<br />
der Retail-Immobilien nicht verschont. Restrukturierungen und Insolvenzen<br />
von Retailern lassen einen erhöhten (auch großflächigen) Leerstand von Immobilien<br />
erwarten, sofern er noch nicht eingetreten ist. Vermieter sind daher vermehrt<br />
gezwungen, alternative Nutzungen ihrer Objekte ins Auge zu fassen.<br />
Text: Mag. Matthias Nödl<br />
Als alternative Nutzungen von Immobilien<br />
erleben vor diesem Hintergrund Pop-up-<br />
Stores und Showroom-Konzepte derzeit<br />
einen regelrechten Boom. Beide Nutzungsarten<br />
haben gemeinsam, dass sie auf eine<br />
eher kurzfristige und flexible Verwendung<br />
der Immobilien ausgerichtet sind. Sowohl<br />
die Kurzfristigkeit, als auch die Flexibilität<br />
der Nutzung stehen in aller Regel jedoch im<br />
Widerspruch zum Interesse des Vermieters<br />
an einer langfristigen und gleichförmigen<br />
Vermietung.<br />
Das gesetzliche Mietrecht bietet dem Vermieter<br />
im Falle solcher kurzfristigen, flexiblen<br />
Nutzungen kaum Handhabe. Denn das<br />
Mietrechtsgesetz (MRG) ist auf Geschäftsraummietverträge,<br />
deren ursprüngliche<br />
oder verlängerte Vertragsdauer ein halbes<br />
Jahr nicht übersteigt, nicht anwendbar.<br />
Und das – im Wesentlichen mittels Vereinbarung<br />
abdingbare – Mietrecht des ABGB<br />
(§§ 1090 ff) gibt nur einen groben rechtlichen<br />
Rahmen für Mietverhältnisse vor.<br />
Folglich liegt es – von wenigen Ausnahmen<br />
wie z.B. dem zwingenden Mietzinsminderungsrecht<br />
iSv § 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB<br />
abgesehen – in der Privatautonomie von<br />
Mieter und Vermieter, im Mietvertrag Bedingungen<br />
und Konditionen zu vereinbaren,<br />
die einerseits dem Wunsch des Mieters<br />
nach einer kurzfristigen, flexiblen Nutzung<br />
der Immobilie gerecht werden, andererseits<br />
das Interesse des Vermieters an einer möglichst<br />
friktionsfreien Vermietung absichern.<br />
Steht das Mietobjekt im Wohnungseigentum<br />
des Vermieters sind auch die Interes-<br />
sen der übrigen Wohnungseigentümer und<br />
die im Wohnungseigentumsvertrag getroffenen<br />
Vereinbarungen zu berücksichtigen,<br />
die einer kurzfristigen, flexiblen Nutzung<br />
des Mietobjekts – z.B. aufgrund des ständigen<br />
Mieterwechsels, häufiger baulicher Anpassung<br />
der Ausstattung des Mietobjekts<br />
und des Hauses an die Bedürfnisse des<br />
Mieters, Wechsels der Klientel, etc. – entgegenstehen<br />
könnten.<br />
Das besondere Risiko, das mit einer kurzfristigen<br />
Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten<br />
zur flexiblen Nutzung verbunden<br />
sein kann, liegt darin, dass ein Mieter den<br />
vereinbarten Mietzins nicht bezahlt, aber<br />
die zwangsweise Räumung des Mietobjektes<br />
aufgrund der Rechtslage vor Ablauf der<br />
kurzen Vertragsdauer nicht gelingen kann,<br />
auch wenn der Vermieter unverzüglich die<br />
sofortige Auflösung des Mietverhältnisses<br />
erklärt.<br />
Dies liegt zum einen daran, dass der Vermieter<br />
gemäß § 1118 ABGB zu einer Auflösung<br />
des Mietverhältnisses erst berechtigt ist,<br />
wenn der Mieter den Mietzins trotz Mahnung<br />
bis zum nächstfolgenden Zinstermin<br />
nicht bezahlt hat (qualifizierter Zahlungsverzug).<br />
Die Vereinbarung von vermietergünstigeren<br />
Auflösungsbestimmungen ist<br />
daher überlegenswert, auch wenn eine solche<br />
von der Rechtsprechung allenfalls als<br />
rechtsunwirksam gewertet werden könnte.<br />
Zum anderen bedingt die Dauer eines gerichtlichen<br />
Räumungsverfahrens und die<br />
Möglichkeit des Mieters, die gerichtliche<br />
Durchsetzung der Räumung selbst durch<br />
unbegründete Einwendungen in die Länge<br />
ziehen zu können, dass gerichtliche Hilfe<br />
bei kurzfristigen Vermietungen stets zu<br />
spät kommt. Und Selbsthilfemaßnahmen<br />
des Vermieters könnte der Mieter mittels<br />
Besitzstörungsklage und Maßnahmen des<br />
einstweiligen Rechtsschutzes bekämpfen.<br />
Bei kurzfristigen Mietverhältnissen sollte<br />
der Vermieter daher darauf bestehen, dass<br />
der Mieter die Bezahlung des Mietzinses für<br />
die gesamte oder einen Gutteil der Mietdauer,<br />
in welcher Form immer (z.B. durch Mietzinsvorauszahlung,<br />
Barkaution oder unbare<br />
Sicherstellung in Form einer Bank-, Versicherungs-<br />
oder Konzerngarantie), sicherstellt.<br />
Im Falle einer unbaren Sicherstellung<br />
sollte der Vermieter überdies darauf wertlegen,<br />
dass die beigestellte Garantie abstrakt<br />
ist. Das heißt: Die Auszahlung der vom Vermieter<br />
angeforderten Garantiesumme sollte<br />
nach den Garantiebestimmungen über<br />
erste Anforderung des Vermieters erfolgen,<br />
und dies innerhalb kurzer Frist und unter<br />
Verzicht des Garanten auf jedwede Einreden<br />
oder Einwendungen aus dem zugrunde<br />
liegenden Mietverhältnis.<br />
Im Zusammenhang mit einer kurzfristigen<br />
Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten<br />
zur flexiblen Nutzung kann sich aber auch<br />
aus der flexiblen Nutzung des Mietobjektes<br />
durch den Mieter selbst ein erhebliches Risiko<br />
für den Vermieter ergeben, insbesondere<br />
wenn der Rahmen der Flexibilität des<br />
Mieters zwischen Mieter und Vermieter<br />
– auch im Interesse allfälliger Wohnungseigentümer<br />
oder anderer Nutzer der Immobilie<br />
– nicht klar und deutlich vereinbart ist.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
| MT12-01G |<br />
Vom Konferenzraum …<br />
Magazin<br />
© Eric Ferguson / Getty Images<br />
Auch öffentlich-rechtliche Restriktionen<br />
(z.B. Bestimmungen des Baurechts, des<br />
Gewerberechts, des Feuerpolizeirechts,<br />
etc.) können einer flexiblen Nutzung des<br />
Mietobjektes allenfalls entgegenstehen. Für<br />
den Vermieter gilt es daher zu vermeiden,<br />
dass der Mieter daraus (z.B. wegen einer<br />
behördlichen Untersagung der Gewerbeausübung)<br />
Ansprüche ableiten kann, weil<br />
das Mietobjekt allenfalls zur vereinbarten<br />
flexiblen Nutzung nicht taugt.<br />
… bis zur Gebäudeautomation<br />
© Cultura / Getty Images<br />
So wäre es beispielsweise denkbar, dass<br />
Geschäftsräumlichkeiten, die bisher zum<br />
Betrieb eines Textilhandels genutzt wurden,<br />
aufgrund einer Neuorientierung des<br />
Mieters (der sich z.B. auf die Überlassung<br />
der Geschäftsräumlichkeiten an einen Untermieter<br />
beschränkt, ohne selbst ein Gewerbe<br />
in den Räumlichkeiten zu betreiben)<br />
zumindest vorübergehend als Showroom<br />
oder Verkaufsraum für E-Automobile verwendet<br />
werden; einer Nutzungsart, von der<br />
völlig andere Risiken für Nutzer, Kunden,<br />
etc. ausgehen können, als im Falle eines<br />
Textilhandels.<br />
In einer solchen Konstellation kann sich<br />
eine überschießende Beanspruchung der<br />
eingeräumten Flexibilität durch den Mieter<br />
unter Umständen zu einem erheblich<br />
nachteiligen Gebrauch des Mietobjektes<br />
auswachsen, der nicht nur den Bestand<br />
des Mietverhältnisses selbst, sondern auch<br />
den Hausfrieden zwischen den Wohnungseigentümern,<br />
Mietern oder sonstigen Nutzern<br />
des Hauses zum Nachteil des Vermieters<br />
gefährden kann.<br />
Vor diesem Hintergrund ist es im Falle einer<br />
kurzfristigen, flexiblen Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten<br />
empfehlenswert, im<br />
Mietvertrag den Rahmen der Flexibilität der<br />
mieterseitigen Nutzung möglichst klar und<br />
deutlich zu definieren, eine möglichst strikte<br />
Zuordnung der damit allenfalls einhergehenden<br />
Haftungsrisiken gegenüber Dritten<br />
vorzunehmen und auch die Einhaltung<br />
allfälliger Restriktionen des öffentlichen<br />
Rechts durch den Mieter sicherzustellen.<br />
Eine Plattform für Medientechnik,<br />
Gebäudeautomation und<br />
Entertainment: PC-based Control<br />
Medientechnik neu gedacht: Als Spezialist für PC-basierte Steuerungssysteme<br />
ermöglicht es Beckhoff mit einem umfassenden und<br />
industrieerprobten Automatisierungsbaukasten, Multimedia, Gebäudeautomation<br />
sowie Entertainmentkonzepte vernetzt und integriert<br />
umzusetzen. Mit der modularen Steuerungssoftware TwinCAT und<br />
direkter Cloud- und IoT-Anbindung werden alle Gewerke von der<br />
A/V-Technik über die Gebäudeautomation bis hin zu Digital Signage<br />
Control, Device Management und Condition Monitoring, auf einer<br />
Plattform kombiniert. Hinzu kommt die maximale Skalierbarkeit aller<br />
Komponenten und die Unterstützung aller gängigen Kommunikationsstandards.<br />
So schafft Beckhoff die Grundlage für neue mediale und<br />
architektonische Erlebniswelten.<br />
Scannen und die<br />
Beckhoff-Highlights<br />
für die AV- und<br />
Medientechnik<br />
entdecken<br />
IoT
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
26<br />
Interview<br />
Suffizienz<br />
als Entwurfsstrategie<br />
Interview mit Architekt und Professor Dr. Philipp Lionel Molter<br />
© Andreas Heddergott
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
27<br />
Philipp Lionel Molter<br />
Philipp Lionel Molter versteht sein Atelier studiomolter<br />
als interdisziplinäres Atelier, das in den Bereichen<br />
Architektur und Design forscht und praktiziert. Als Professor<br />
für Architektur an der IU International University<br />
setzt Molter in seinem Verständnis von Architektur und<br />
Design auch auf einen wissenschaftlichen Forschungsansatz.<br />
Im Interview erklärt er seine Arbeitsweise an<br />
praktischen Beispielen und gewährt einen Einblick, was<br />
eine intelligente Fassade in seinen Augen auszeichnet.<br />
In seinem Münchner Atelier studiomolter setzt Architekt<br />
Philipp Lionel Molter auf eine interdisziplinäre Arbeitsweise.<br />
Da das Bauen und Planen in der heutigen<br />
Zeit zunehmend an Komplexität gewinnt, ist in der<br />
Konzeption auch immer mehr Expertenwissen nötig.<br />
Dabei stellen sich nicht nur Fragen der Energieeinsparung,<br />
des Lebenszyklus oder betreffend der Materialien<br />
– auch rechtliche Belange werden zunehmend<br />
zum Thema. Entgegen der Tendenz zu immer größer<br />
werdenden Bürostrukturen, setzt Molter auf ein eher<br />
kleines und dafür agiles Konstrukt, das im Netzwerk<br />
und projektweise äußerst systematisch, strategisch<br />
und zielgerichtet agieren kann. Die Basis bildet aber<br />
dennoch sein internationales und interdisziplinäres<br />
Team mit verschiedenen Kompetenzen, das für Projekte<br />
oder für Wettbewerbe fachspezifisch erweitert<br />
werden kann. Der Arbeitsalltag im studiomolter ist<br />
dank der Forschungstätigkeiten des Büroleiters geprägt<br />
von einem sich gegenseitig befruchtenden Wissens-<br />
und Inspirationstransfer zwischen Hochschultätigkeit<br />
und Praxis. Das gilt auch für das wichtige<br />
Thema der intelligenten Fassade der Zukunft.<br />
Herr Molter, wie leben Sie den wissenschaftlichen<br />
Designforschungsansatz und wie lässt sich dieser in<br />
die Praxis übersetzen?<br />
Hier setze ich auf „research by design“ – das heißt,<br />
dass ich aus der entwerferischen Fragestellung heraus<br />
einen Forschungsansatz entwickle oder meine<br />
eigene Forschungstätigkeit wiederum in die Bürotätigkeit<br />
einfließen lasse. So wie bei dem Projekt<br />
„Wohnhochhaus in Regensburg“, bei dem es um eine<br />
Lebenszyklusanalyse der Fassade und die Möglichkeit<br />
der Stromerzeugung für die MieterInnen ging. In<br />
meiner Tätigkeit generieren sich die Lösungen immer<br />
sowohl aus der Forschung als auch aus dem Netzwerk<br />
heraus.<br />
„Getrieben von Neugierde erforschen wir mit<br />
einem wissenschaftlichen Ansatz die Komplexität<br />
und Vielfalt aller Maßstäbe, die Architektur<br />
und Design zu bieten haben. Unsere Methodik<br />
zur Gestaltung unserer gebauten Umwelt<br />
basiert auf einer tiefgreifenden kulturellen und<br />
geographischen Recherche. Die Art und Weise,<br />
wie wir arbeiten, spiegelt sowohl den persönlichen<br />
als auch den sozialen Kontext wider, innerhalb<br />
derer wir versuchen, in einer offenen<br />
und kollaborativen Weise mit Architekten, Ingenieuren,<br />
Wissenschaftlern und Experten gemeinsam<br />
die passende Lösung zu finden.“<br />
Wie und mit welchen (Hilfs- oder Arbeits-) Mitteln arbeiten<br />
Sie in der Forschung und in der Praxis?<br />
Ob Pappmodell, 3D-Druck oder 1:1-Mockup – wir<br />
setzen die jeweiligen Mittel ganz individuell ein und<br />
verlassen uns dabei auf unseren Werkzeugkasten an<br />
digitalen und analogen Komponenten, wobei wir alles<br />
nutzen, was uns zur Verfügung steht. In der Lehre<br />
beobachte ich, dass die Studierenden als Digital Natives<br />
oft sehr fit sind am Computer, das Physische<br />
kommt dabei allerdings manchmal zu kurz. In meinen<br />
Augen ist ein Pappmodell meist sehr hilfreich und<br />
auch im Arbeitsprozess leicht zu adaptieren. Später<br />
übersetzen wir dieses ohnehin in die Dreidimensionalität<br />
der CAD-Programme. Ich würde sagen, dass<br />
sich letztlich alle Werkzeuge ergänzen und keinesfalls<br />
ausschließen.<br />
u<br />
Philipp Lionel Molter
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
28<br />
Interview<br />
© studiomolter<br />
Wohnhochhaus in Regensburg:<br />
Bestandsobjekte des Wohnungsbaus<br />
aus den 60er- bis 80er-Jahren bilden<br />
eine der klassischen Bauaufgaben der<br />
kommenden Jahre. Um diese zukunftsfit<br />
zu machen, ist eine Erneuerung der<br />
Gebäudehülle und ein damit einhergehendes<br />
Einläuten der weiteren<br />
Lebensphasen unumgänglich. Das<br />
Wohnhochhaus in Regensburg dient als<br />
exemplarisches Beispiel einer detaillierten<br />
Betrachtung der Lebenszyklusanalyse<br />
sowie der Energiegewinnung<br />
durch gebäudeintegrierte Photovoltaik<br />
in der Fassade.<br />
Inwiefern hat Sie Ihre Zeit im Renzo Piano Building<br />
Workshop beeinflusst bzw. tut es noch?<br />
Die Zeit war tatsächlich sehr entscheidend und prägend<br />
für meine Tätigkeit und ganz klar eine Vertiefung<br />
der universitären Ausbildung. So ist das Büro<br />
wohl auch konzipiert. Renzo Pianos Architektur wird<br />
oft fälschlicherweise auf eine Art Hightech-Architektur<br />
reduziert, wobei ich seine Werke als eine zutiefst<br />
humanistische Architektur empfinde, die ungemein<br />
zeitlos ist. Diese Grundeinstellung und auch die Arbeitsweise<br />
trage ich noch immer in mir. Auch die Methodik,<br />
in der sich der architektonische Entwurf aus<br />
sehr vielen Disziplinen, die sich aus der Gesellschaft<br />
und den jeweiligen kulturellen sowie geografischen<br />
Kontexten speist, ist Grundlage einer jeden Aufgabenstellung<br />
im Atelier.<br />
In Ihrer Forschung und Lehre konzentrieren Sie sich<br />
auf adaptive Gebäudehüllen und ihre thermische,<br />
visuelle und ökologische Leistung – was kann man<br />
darunter konkret verstehen?<br />
Adaptive Architektur geht davon aus, dass sich Architektur<br />
an verändernde Situationen anpassen<br />
kann. Das heißt, eine adaptive Gebäudehülle kann<br />
auf Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Temperatur<br />
usw. reagieren – ganz analog zu einem biologischen<br />
Organismus. Wenn die Epidermis unsere erste Haut<br />
ist und die Kleidung unsere zweite, dann kann man<br />
die Gebäudehülle als dritte Haut verstehen. Allesamt<br />
können diese auf Umwelteinflüsse reagieren – meiner<br />
Meinung nach sollte eine Gebäudehülle in diesem<br />
Zusammenhang mehr können, als nur Fenster zum<br />
Öffnen und Schließen bereitzustellen. In Zukunft soll-
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
29<br />
Philipp Lionel Molter<br />
© Philipp Lionel Molter<br />
Climate Active Bricks: Das in Kooperation mit der TU München und climateflux<br />
entstandene Rechercheprojekt befasst sich mit der Auswirkung von Fassaden im<br />
urbanen Kontext und deren Einfluss auf die Aufenthaltsqualität unserer verdichteten<br />
Innenstädte. Um der Überhitzung der Stadt sowie dem Entstehen von Wärmeinseln<br />
entgegenzuwirken, wurden in diesem Zuge anpassungsfähige Wände entwickelt, die<br />
sich weniger stark aufheizen, das Mikroklima verbessern und somit den BewohnerInnen<br />
mehr Aufenthaltsqualität versprechen.<br />
te unsere dritte Haut nicht nur extrem anpassungsfähig<br />
sein, sondern durch das Verknüpfen von Technik<br />
und Design auch gestalterisch überzeugen. Ich sehe<br />
eine Weiterentwicklung von der technischen Werkschau<br />
hin zu architektonischen Entwurfskomponenten.<br />
Die Forschung befindet sich momentan an einem<br />
Punkt, an dem Einzelentwicklungen in angepasste<br />
Anwendungen überführt werden, das heißt es gibt<br />
immer mehr Produkte am Markt und der Einzelfall<br />
wird langsam zur Systemlösung.<br />
Was macht für Sie eine intelligente Fassade aus?<br />
Der Unterschied zwischen einer rein adaptiven (reaktiven)<br />
und einer autoreaktiven, sich selbst anpassenden,<br />
Fassade. Hier besteht ein großes Potenzial<br />
in der Vereinfachung aber auch Selbstregulation. Die<br />
Beschaffenheit der Geometrie oder Materialität wird<br />
immer noch allzu oft unterschätzt.<br />
Wo sehen Sie Trends und Potenziale?<br />
Im Moment lässt sich ein extremer Holzbau-Boom<br />
beobachten, in Zukunft aber muss die Architektur<br />
insgesamt eher zum Ort passen. Klimagerechte Architektur<br />
stützt sich auf Prinzipien der vernakulären –<br />
also historisch gewachsenen – und lokalen Architektur.<br />
Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne Cedric<br />
Price, der bereits 1966 provokant fragte: „Technology<br />
is the answer, but what was the question?“ Das drückt<br />
für mich aus, wohin der Weg gehen sollte. Bisher wurde<br />
allzu viel mit Technik beantwortet, jetzt sollten wir<br />
aus unserem Wissen schöpfen und uns fragen, was<br />
wir wirklich brauchen – Stichwort Suffizienz.<br />
Eine Fassade, die Sie gerne realisieren würden?<br />
Ich sehe ein enormes Potenzial in begrünten Fassaden,<br />
auch um unseren Energiedurst zu stillen. Generell<br />
würde mir mehr “Grün” in all unseren Lebensbereichen<br />
gefallen.<br />
•<br />
www.philippmolter.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
30<br />
Intelligente Fassade<br />
Atmungsaktive<br />
Architektur<br />
Shenzhen Rural Commercial Bank Headquarters / Shenzhen, China / SOM<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Seth Powers<br />
Das Architekturbüro<br />
Skidmore, Owings &<br />
Merrill (SOM) realisierte<br />
in der chinesischen<br />
Millionenstadt Shenzhen<br />
ein „atmendes“ Hochhaus<br />
mit natürlicher Belüftung.<br />
Für die neuen Headquarters<br />
der Rural Commercial<br />
Bank entwarfen sie eine<br />
Struktur aus sich diagonal<br />
kreuzenden Trägern. Diese<br />
verleihen dem Gebäude<br />
nicht nur ihr markantes<br />
Aussehen, sondern dienen<br />
zudem als gigantischer<br />
Sonnenschutz.<br />
Wolkenkratzer sind in der Metropole im Südosten<br />
Chinas nichts Besonderes – das 158 Meter hohe<br />
Bankgebäude allerdings schon: Natürlich belüftet<br />
tanzt es aus der Reihe und zeigt, wie nachhaltiges<br />
Design in tropischen Breitengraden aussehen kann.<br />
Mit seinen 33 Stockwerken steht der Turm am Rande<br />
eines öffentlichen Parks im Geschäftsviertel von<br />
Shenzhen. Die Grünfläche steht im Zentrum des<br />
Masterplans für den Stadtbezirk. Durch seine Gestaltung<br />
soll der Neubau auf die Geschichte und die<br />
ländlichen Wurzeln der Bank sowie deren Vision für<br />
die Zukunft hinweisen und traditionelle Komponenten<br />
mit modernen Ideen verbinden.<br />
SOM setzten auf eine simple, quadratische Grundform<br />
und kombinierten diese mit innovativer Technologie.<br />
Das Herzstück des Bankhauptsitzes ist seine<br />
charakteristische Fassade, die als Brisesoleil und<br />
Konstruktion fungiert. Wie ein Exoskelett umschließt<br />
sie den Turm mit einer engmaschigen Struktur. Diese<br />
besteht aus weißen Stahlträgern, die sich überkreuzen.<br />
Als außenliegendes Tragwerk ermöglichen<br />
sie im Inneren offene Grundrisse und eine flexible<br />
Nutzungsanpassung. Die Diagonalen sind in jedem<br />
zweiten Stockwerk über horizontale Rahmen mit<br />
dem Betonkern verbunden, der die Kräfte in den Boden<br />
abführt. Zudem schirmt das Gitter die dahinterliegende<br />
Glasfassade vor der Sonne ab, schützt vor<br />
Blendung in den Büros und reduziert den solaren<br />
Wärmeeintrag um 34 Prozent. Am Fuße des Baus<br />
weiten sich die Abstände zwischen den Rauten der<br />
Außenhülle. Sie umrahmen den Blick in den Park und<br />
markieren die Zugänge zum Gebäude.<br />
u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
31<br />
SOM
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
32<br />
Intelligente Fassade<br />
Zwei Atrien stellen die Lunge der Rural Commercial<br />
Bank dar. Sie verlaufen zentral entlang der Westund<br />
Ostansicht über die gesamte Höhe, begleiten<br />
die offenen Treppenhäuser und teilen die Bürogeschosse<br />
als Verlängerung des Erschließungskerns<br />
in zwei gleich große Bereiche. Die beiden Schächte<br />
lassen den Headquarterbau „atmen“ und sorgen für<br />
eine kontinuierliche Luftzirkulation. Je nach Jahreszeit<br />
und Qualität kommt die Luft dafür entweder<br />
von außen oder von der internen Kühlung. Durch lamellenartige<br />
Öffnungen strömt die Frischluft in die<br />
einzelnen Etagen. Anders als in vollautomatisierten<br />
Bürotürmen können die Nutzer hier selbst zwischen<br />
mechanischer und natürlicher Belüftung wählen. Das<br />
erhöht den Komfort und spart Energiekosten. Hinter<br />
der Stahlkonstruktion bildet eine durchgängige<br />
Glasfassade den thermischen Abschluss. Sie erwies<br />
sich während des Bauprozesses als besondere Herausforderung,<br />
da die außenliegende Tragstruktur zuerst<br />
montiert werden musste. Erst dann konnte man<br />
die Vorhangkonstruktion dahinter anbringen. Die<br />
Verglasungen sind mit einem zusätzlichen Verschattungssystem<br />
ausgestattet, das auf den Lichteinfall<br />
reagiert und automatisch vor der Sonne schützt. Mit<br />
der effizienten Planung und verminderten Kühllast<br />
erfüllt der Bau sämtliche Kriterien für eine LEED Platin-Zertifizierung.<br />
Im Erdgeschoss legt sich<br />
das Exoskelett eindrucksvoll<br />
vor die Glasfassade.<br />
Die größeren Abstände<br />
zwischen den weißen<br />
Stahlträgern schaffen<br />
Eingänge und rahmen den<br />
Blick in die Umgebung ein.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
33<br />
SOM<br />
Dank der tragenden Gebäudehülle sind sämtliche<br />
Geschosse stützenfrei ausgeführt und lassen sich<br />
individuell bespielen. Die Glasfassade bietet Ausblicke<br />
nach draußen und ein angenehm helles Arbeitsumfeld.<br />
Bei der Gestaltung der Innenräume<br />
bedienten sich die Planer Elementen des Feng-Shui<br />
und verbesserten durch sie das Ambiente merklich.<br />
Wasser steht in der chinesischen Harmonielehre für<br />
Wohlstand und kommt im repräsentativen Eingangsbereich<br />
zum Einsatz. Dort fassen Pools – in denen<br />
sich das Licht spiegelt – und 15 Meter hohe Glaswände<br />
die Lobby ein. Das kühle Nass setzt sich auch<br />
in der Vertikale fort: An einem „Regenvorhang“ fließt<br />
es nach unten und benetzt die Oberfläche. Diese<br />
Wasserspiele kühlen in den heißen Monaten durch<br />
Verdunstung das gesamte Bankgebäude. Tropfenförmige<br />
Hängeleuchten greifen das Thema Wasser<br />
erneut auf. Der Erschließungskern ist in Marmor verkleidet<br />
und soll mit seiner wellenartigen Musterung<br />
an nassen Stein erinnern. Wasser- und Grünflächen<br />
sowie Sitzgelegenheiten und in Granit gepflasterte<br />
Wege prägen die Außenräume und leiten Besucher<br />
und Mitarbeiter ins Gebäude. Ein niedriger, gläserner<br />
Anbau dockt direkt an die Eingangshalle an. Er<br />
ist verglast, schimmert in edlem Bronze und verfügt<br />
über eine zweischalige Außenhaut. Im Gegensatz<br />
zum transparenten Hauptgebäude umgibt ihn ein<br />
leichter Lamellenvorhang. Dieser schafft die nötige<br />
Privatsphäre für die Räumlichkeiten des exklusiven<br />
VIP-Banking-Bereichs im Inneren. Oben auf dem<br />
Turm rundet eine Dachterrasse vor dem Panorama<br />
des geschäftigen Shenzhens und der südchinesischen<br />
See das Programm ab. Mit mobilen Trennwänden<br />
scheinen Innen- und Außenraum hier in luftiger<br />
Höhe fließend ineinander überzugehen. u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
34<br />
Intelligente Fassade<br />
Eine Dachterrasse bildet<br />
den krönenden Abschluss<br />
des intelligenten<br />
Wolkenkratzers. Sie wird<br />
ebenfalls von den diagonalen<br />
Trägern eingefasst<br />
und überblickt Shenzhen<br />
bis hin zum südchinesischen<br />
Meer.<br />
Wasser, Wind, Sonne – für das Design der Shenzhen<br />
Rural Commercial Bank ließen sich die Planer<br />
von SOM, die für ihre innovativen Entwürfe bekannt<br />
sind, von der Natur inspirieren. Mit dem auffälligen<br />
Exoskelett entwickelten sie in Zusammenarbeit mit<br />
den Ingenieuren von Arup die perfekte Balance zwischen<br />
Stabilität, Sonnenschutz, Licht und Luft für<br />
das Projekt. Die weiße Gitterkonstruktion bereichert<br />
die chinesische Metropole nicht nur um ein neues<br />
Wahrzeichen, sondern ist außerdem effizient und<br />
berücksichtigt das Wohlbefinden der Nutzer. Durch<br />
optimierte Planung entstand das perfekte Zusammenspiel<br />
aus aktiven und passiven Maßnahmen zur<br />
Gebäudeklimatisierung. Somit ist bewiesen, dass<br />
eine saisonale, natürliche Belüftung selbst in hohen<br />
Bauten in tropischen Regionen möglich ist. Ein nachhaltiger<br />
Ansatz, der die nächsten Finanzgeschäfte im<br />
Headquarter – in vielerlei Hinsicht – zum atemberaubenden<br />
Erlebnis macht.<br />
•
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
35<br />
SOM<br />
Shenzhen Rural Commercial Bank Headquarters<br />
Shenzhen, China<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Projektleitung:<br />
Brandschutz/Licht:<br />
Gebäudehöhe:<br />
158 m<br />
Grundstücksfläche: 7.665 m 2<br />
Nutzfläche: 94.049 m 2<br />
Fertigstellung: 2021<br />
www.som.com<br />
Shenzhen Rural Commercial Bank<br />
Skidmore, Owings & Merrill (SOM)<br />
Scott Duncan<br />
Arup<br />
„Wir sind immer auf der Suche nach<br />
Möglichkeiten, originelle, technische<br />
Lösungen mit architektonischem<br />
Design zu verbinden. Beim<br />
Hauptsitz der Rural Commercial<br />
Bank konnten wir ein Diagrid – ähnlich<br />
einem Exoskelett – einbauen.<br />
So brachten wir die Tragstruktur<br />
an die Außenseite und hängten den<br />
Turm innen ab, um stützenfreie Arbeitsbereiche<br />
zu schaffen.“<br />
Scott Duncan, SOM
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
36<br />
Intelligente Fassade
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
37<br />
jessenvollenweider<br />
Schimmerndes<br />
Sonnenkleid<br />
Amt für Umwelt und Energie / Basel, Schweiz / jessenvollenweider<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: Philip Heckhausen<br />
Der Neubau des Amts für<br />
Umwelt und Energie am<br />
Fischmarkt in Basel ist<br />
so konzipiert, dass seine<br />
Elemente, ihre Funktion<br />
und deren Zusammenspiel<br />
nach innen wie außen erkennbar<br />
sind. Besonderes<br />
Gestaltungsmerkmal des<br />
von jessenvollenweider<br />
entworfenen Nullenergiehauses<br />
in Holz-Beton-Hybridbauweise<br />
ist die leichte<br />
Photovoltaikfassade,<br />
die das flexible Raum- und<br />
Tragsystem umhüllt.<br />
Energie, Abfallbewirtschaftung, Gewässer- und Lärmschutz,<br />
Altlastensanierung sowie Landwirtschaft sind<br />
die Kerngeschäfte des Amts für Umwelt und Energie<br />
in Basel. 2021 bezog das Amt den neu errichteten,<br />
markanten, achtgeschossigen Holz-Beton-Hybridbau<br />
mit Photovoltaikfassade im Herzen der Stadt. Das<br />
ortsansässige Architekturbüro jessenvollenweider<br />
konzipierte den Entwurf als Antwort auf den dichten<br />
städtebaulichen Kontext und konnte mit einer ausgefeilten<br />
energietechnischen Lösung die gewünschte<br />
Zertifizierung als Minergie-A-ECO erreichen.<br />
Die Ausschreibung für den Neubau der AUE BS forderte<br />
bereits 2013 ein Leuchtturmprojekt in Hinblick<br />
auf Nachhaltigkeit und Minergie-A, die für das Bauen<br />
in Basel eine Vorbildfunktion einnehmen sollte. Mit<br />
der gelungenen Umsetzung des Projekts konnte der<br />
Kanton die Chance nutzen, weit über die gesetzlichen<br />
Vorgaben hinauszugehen. Kein anderes Bürogebäude<br />
in Basel weiß bislang die Verwendung von regionalem<br />
Holz, eine ans Stadtbild angepasste PV-Fassade oder<br />
eine aktive Raumkühlung aufzuweisen. Die Zuständigen<br />
erhoffen sich auf interner Ebene aber auch von<br />
der offenen Arbeitswelt ohne individuelle Arbeitsplätze<br />
neue Impulse, sowie regen, externen Besucherandrang<br />
im neuen Kompetenzzentrum.<br />
Um allen Ansprüchen gerecht werden zu können, war<br />
für die Architekten bereits früh klar, dass es darum<br />
gehen würde, eine Einheit im grundsätzlich Gegensätzlichen<br />
zu schaffen. Dies bot die Chance sichtbar<br />
zu machen, wie ein zeitgemässes städtisches Haus,<br />
das die Grundsätze des nachhaltigen Bauens und ein<br />
sinnvolles Maß an gezielten technischen Innovationen<br />
verwirklicht, selbstverständlich in einen historischen<br />
Stadtkontext integriert werden kann. jessenvollenweider<br />
positionierten einen leichten Holzbau in<br />
Hybridbauweise inklusive hochmoderner Photovoltaikfassade<br />
inmitten der Altstadt von Basel, die vom<br />
Baustoff Stein dominiert wird. Das Fassadenkonzept<br />
entwickelte sich als besondere Herausforderung im<br />
Laufe der Planungsphase analog zur rasant voranschreitenden<br />
Evolution der Technik stetig weiter. So<br />
verlagerte sich der konzeptionelle Fokus von der polykristallinen<br />
Zelle – die in der Materialität und Farbigkeit<br />
die Verwandschaft zu den angrenzenden Gebäuden<br />
in Naturstein sucht – hin zur monokristallinen<br />
Zelle mit bis zu 30 Prozent mehr Leistungsfähigkeit.<br />
Die Erscheinung ist dabei grundlegend anders, nämlich<br />
dunkel und monoton. Das Trägermaterial Glas<br />
erhält somit eine besondere Bedeutung. In diesem<br />
Zusammenhang wurde ein Schmelzglas entwickelt,<br />
das eine plastische, unregelmäßige und im Licht changierende<br />
Lebendigkeit entfaltet und durch seine<br />
Struktur die dahinter liegenden PV Zellen abbildet.<br />
Zusammen mit den in das Glas integrierten metallischen<br />
Farbpunkten aus Titannitrid wird die dunkle<br />
Farbe der PV-Zellen überlagert und die charakteristische<br />
Erscheinung der Fassade ermöglicht.<br />
Die Entscheidung, die Photovoltaikflächen auf die<br />
Fassade zu packen, ist auch der Tatsache geschuldet,<br />
dass die zur Verfügung stehende Dachfläche schlicht<br />
zu klein war, um den Bedarf an Betriebsenergie für<br />
das Klimagebäude aus erneuerbaren Quellen in Form<br />
von Sonnenenergie decken zu können. Die Module<br />
enthalten effiziente monokristalline PERC-Zellen, die<br />
auch über Bereiche mit weniger Sonneneinstrahlung<br />
Energie erzeugen können. Das Fassadenkleid vereint<br />
Leistung, Langlebigkeit und Ästhetik in besonderem<br />
Maße. Der Reiz des Erscheinungsbildes rührt aus<br />
dem unterschiedlichen Lichteinfall zu verschieden<br />
Tageszeiten her: Die Bandbreite reicht vom dunklen<br />
technischen Kraftwerk über die farbliche Einbindung<br />
in den Kontext der sandsteinfarbenen Nachbarn bis<br />
hin zum leuchtenden Glashaus, das die Umgebung<br />
widerspiegelt und das Sonnenlicht bricht. u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
38<br />
Intelligente Fassade<br />
Die künftige Überprüfung der Wirksamkeit des<br />
Energiekonzepts des Gebäudes kann mithilfe eines<br />
digitalen Zwillings evaluiert und entsprechende Parameter<br />
gegebenenfalls justiert werden. Dieses Monitoring<br />
soll im Eingangsbereich auch den Besuchern<br />
und Mitarbeitern aufbereitet präsentiert werden.<br />
Neben der Fassade überzeugt das Amt für Umwelt<br />
und Energie aber auch in räumlicher und konstruktiver<br />
Hinsicht. Als Basis für ein ressourcenschonendes<br />
Bauen setzten die Architekten einen kompakten<br />
Baukörper auf das trapezoid verzogene Grundstück.<br />
Einerseits Solitär, definiert das achtgeschossige Gebäude<br />
andererseits den Straßenraum der Spiegelgasse<br />
und bildet mit seiner Attika an der Blumengasse<br />
eine Torsituation für die Passage zwischen<br />
Marktgasse und Spiegelhof aus. Haupteingang, Foyer<br />
und Empfang orientieren sich zum Fischmarkt,<br />
während sich der Eingang für die Mitarbeiter mit<br />
integriertem Veloabgang ins Untergeschoss an der<br />
Blumengasse befindet.<br />
Auf struktureller Ebene fungiert die stringente<br />
Skelettstruktur ohne aussteifenden Kern als wirtschaftliches<br />
und flexibles Raum- und Tragsystem.<br />
Die Arbeitsbereiche orientieren sich aufgrund der<br />
Lichtsituation in Richtung Westen, während die Archivflächen<br />
in Richtung Nordosten zum beengten<br />
Innenhof hin verortet wurden. Im Zentrum befindet<br />
sich ein zenital belichtetes Treppenhaus mit Lift,<br />
von dem aus sich auch die Besprechungs- und Nebenräume<br />
erschließen lassen. Dank einer gewissen<br />
Großzügigkeit bildet das Treppenhaus den zentralen<br />
Ort im Haus, der zur fußläufigen Bewegung zwischen<br />
den Ebenen animiert und zufällige Begegnungen unter<br />
Kollegen und Besuchern fördert und fordert. u<br />
In Verbindung mit dem Sonnenschutz und der automatisierten<br />
Nachtauskühlung sichern die Closed-Cavity Fassaden von WICONA<br />
einen sehr guten sommerlichen Wärmeschutz.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
39<br />
jessenvollenweider
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
40<br />
Intelligente Fassade<br />
Die Gestaltung der Innenräume<br />
überzeugt nicht<br />
nur funktional, auch die<br />
Ästhetik kommt dank der<br />
gelungenen Materialkombination<br />
nicht zu kurz.<br />
Die Decken wurden als Holzbetonverbundkonstruktion<br />
mit Bauteilaktivierung ausgeführt. In Kombination<br />
mit dem Lüftungskonzept, welches eine<br />
natürliche Nachtauskühlung ermöglicht, konnte auf<br />
die heute für konventionelle Bürogebäude übliche<br />
Klimatisierung verzichtet werden. Der extrem hohe<br />
energetische Standard basiert zudem auf einer sehr<br />
gut gedämmten Gebäudehülle, der kompakten Gebäudeform<br />
sowie einem einfachen Haustechnikkonzept,<br />
das auf einer klaren Systemtrennung und der<br />
Nutzung von Sonnenenergie fußt. Die Maßnahmen<br />
wirken sich in ihrer Gesamtheit – mit wenig Technik,<br />
aber ausgeklügelter Gebäudeautomation – zudem<br />
positiv auf die Raumbehaglichkeit aus.<br />
In Zukunft hofft man, mit der innovativen Fassade<br />
sogar mehr Energie produzieren zu können, als für<br />
den Eigenbedarf nötig. Und dass zahlreiche neugierige<br />
Besucher das Gebäude für sich entdecken und<br />
sich für die Zukunft inspirieren lassen. Ein (Sonnen-)<br />
Kleid für alle Fälle anstelle von High Fashion lautet<br />
die Devise.<br />
•
Spiegelgasse<br />
Spiegelgasse<br />
N<br />
N<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
41<br />
jessenvollenweider<br />
AUE - Amt für Umwelt und Energie, Basel<br />
18.11.21<br />
AUE - Amt für Umwelt und Energie, Basel<br />
18.11.2<br />
Schnitt A-A<br />
Schnitt B-B<br />
Schnitt C-C<br />
2. Untergeschoss<br />
1. Untergeschoss<br />
Erdgeschoss<br />
1./2./4. Obergeschoss<br />
0 5 10 25<br />
Schnitte 1:500<br />
jessenvollenweider<br />
UG22. Untergeschoss<br />
UG1 1. Untergeschoss<br />
Erdgeschoss<br />
EG OG 1./2./4. 1/2/4 Obergeschoss<br />
Blumenr ain<br />
Blumenr ain<br />
Blumengasse<br />
Schi f lände<br />
Blumengasse<br />
Mar k tgasse<br />
Schi f lände<br />
OG 3./5. 3/5Obergeschoss OG 6. Obergeschoss 6 OG 7. Obergeschoss<br />
7<br />
Situation, 1:2000<br />
Mar k tgasse<br />
3./5. Obergeschoss 6. Obergeschoss 7. Obergeschoss<br />
Situation, 1:2000<br />
Grundrisse, 1:500<br />
Grundrisse, 1:500<br />
0<br />
Amt für Umwelt und Energie<br />
Basel, Schweiz<br />
0<br />
5 10 25<br />
Bauherr: Kanton Basel-Stadt,<br />
vertreten durch das Hochbauamt des Kantons Basel-Stadt<br />
Planung: jessenvollenweider <strong>architektur</strong> ag, Basel<br />
Projektleitung: Mira Lüssow GP-Leiter: Sven Kowalewsky<br />
Statik:<br />
SJB. Kemter.Fitze AG, Frauenfeld<br />
Fassadensystem: WICONA / Hydro Building Systems Switzerland AG<br />
Grundstücksfläche: 335 m 2<br />
Bebaute Fläche: 335 m 2<br />
Haupt-Nutzfläche: 1.267 m 2<br />
Planungsbeginn: 2014 (WB 1. Preis 2013)<br />
Bauzeit: 2018-2021<br />
Fertigstellung: 11/2021<br />
Baukosten:<br />
18,3 Mio. CHF (Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.)<br />
www.jessenvollenweider.ch<br />
5 10 25<br />
N<br />
N<br />
„Der Neubau des Amts für Umwelt und Energie<br />
am Fischmarkt in Basel verwirklicht als<br />
zeitgemässes Bürohaus Grundsätze des<br />
nachhaltigen Bauens mit einem sinnvollen<br />
Maß an technischen Innovationen und ist<br />
glaubwürdig in den historischen Stadtkontext<br />
integriert.“<br />
Anna Jessen, Ingemar Vollenweider,<br />
Sven Kowalewsky<br />
jessenvollenweider<br />
jessenvollenweide<br />
©Nelly Rodriguez
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
42<br />
Intelligente Fassade<br />
Gläserne<br />
Krone<br />
Buckle Street Studios / London / Grzywinski+Pons<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: Nicholas Worley<br />
Neben 103 Wohnungen, einem Co-Working-Space und<br />
einem Café finden auch Tagungsräume sowie ein Concept<br />
Store Platz in in dem neuen dreizehnstöckigen Gebäude<br />
der Buckle Street Studios im Londoner Stadtteil Whitechapel.<br />
Das New Yorker Design Studio Grzywinski+Pons<br />
zeichnet neben der Architektur auch für das gesamte Interior<br />
Design und einen Großteil der Möbel verantwortlich.<br />
Besonderer Hingucker: die Fassadengestaltung.<br />
Im Zuge ihres Entwurfs der Buckle Street Studios<br />
im Londoner Stadtteil Whitechapel sah sich<br />
das Planungsteam des New Yorker Design Studios<br />
Grzywinski+Pons mit einem Standort konfrontiert,<br />
der geprägt ist durch ein dichtes Konglomerat von<br />
Gebäuden, die sich sowohl in ihrer Größe als auch ihrem<br />
Stil unterscheiden. Niedrige, denkmalgeschützte<br />
Gebäude befinden sich in direkter Nachbarschaft zu<br />
modernen Hochhäusern und definieren das sogenannte<br />
Londoner East End östlich des mittelalterlichen<br />
Stadtkerns und nördlich der Themse. Arbeiterviertel<br />
trifft hier auf hippes Szenequartier. Matthew<br />
Grzywinski wurde schnell klar: Der geplante dreizehnstöckige<br />
Neubau sollte unbedingt als Bindeglied<br />
zwischen den Welten fungieren.<br />
„Während des Planungsprozesses arbeiteten wir<br />
von Anfang an eng mit den städtischen Behörden<br />
zusammen, um sicherzustellen, dass unser Entwurf<br />
die angestrebte Rolle eines architektonischen Vermittlers<br />
sowohl in Bezug auf das Gebäudevolumen<br />
als auch auf die Gliederung der Fassade erfüllt“, sagt<br />
Grzywinski. „Wir waren uns unserer Verantwortung<br />
bewusst, den größeren städtebaulichen Kontext<br />
unseres Standorts zu berücksichtigen, und haben<br />
in diesem Sinne Materialien spezifiziert und unsere<br />
Formensprache definiert, um den architektonischen<br />
Clash zwischen den kleineren historischen Gebäuden<br />
zu den jüngeren Hochhäusern zu mildern.“ u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
43<br />
Grzywinski+Pons
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
44<br />
Intelligente Fassade<br />
Dank der abgerundeten<br />
Ecken, der Materialität<br />
und der Maßstäblichkeit<br />
fügen sich die Buckle<br />
Street Studios harmonisch<br />
in das bestehende<br />
Stadtgefüge ein.<br />
Entstanden ist ein einprägsames, elegantes Bauwerk,<br />
das sich sanft in den bestehenden Block einfügt. In<br />
seinem äußeren Erscheinungsbild zum einen geprägt<br />
durch die runden Ecken, zum anderen definiert durch<br />
die stringente vertikale Gliederung. „Wir übertrugen<br />
einen Großteil der strukturellen Lasten auf einen expressionistischen<br />
Parabelbogen von doppelter Höhe,<br />
während wir uns gleichzeitig von den Rundbogenfenstern,<br />
bogenförmigen Gesimsen und abgerundeten<br />
Ziegeln der historischen Gebäude in den benachbarten<br />
Straßen inspirieren ließen“, erklärt Grzywinski<br />
die Herangehensweise.<br />
Um das Gebäude mit zunehmender Höhe heller und<br />
transparenter erscheinen zu lassen, setzten die Architekten<br />
auf eine stufenweise Gliederung und eine<br />
Teilung des Volumens in drei Abschnitte. Aufgrund<br />
der eingeschränkt zur Verfügung stehenden Grundfläche<br />
griffen Grzywinski+Pons anstelle von formalen<br />
Rücksprüngen auf eindrückliche, aber geordnet<br />
vorgenommene Materialwechsel über alle Schichten<br />
des Gebäudes hinweg zurück, um in Folge einen Giebel<br />
und eine Krone abzubilden. Die Materialwahl und<br />
-verarbeitung war letztlich ausschlaggebend für den<br />
gesamten optischen Eindruck der Fassade.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
45<br />
Grzywinski+Pons<br />
Der Sockelbereich wurde mit gealterten, vernickelten<br />
Metallpaneelen in Form von unterschiedlich dimensionierten,<br />
vertikal positionierten Kassettenelementen<br />
verkleidet, die gleichermaßen als Brüstungsabdeckungen<br />
und kunstvoll gestaltete Lüftungsgitter fungieren<br />
und die geschichtete Fassade harmonisieren.<br />
„Unsere moderne Interpretation einer progressiven,<br />
geordneten Skalierung“, so Grzywinski. Über diesem<br />
ersten Giebel schließen warmgraue Handstrichziegel<br />
mit vorspringenden Lisenen an, die in ein Gesims am<br />
Fuß der Krone münden und einen erneuten Materialwechsel<br />
einläuten. Die Lisenen und die raffinierten<br />
Anknüpfungspunkte verleihen der ohnehin strukturierten<br />
Gebäudehülle zusätzlich Plastizität und Tiefe.<br />
Der krönende Abschluss der Buckle Street Studios<br />
entspricht in seinen Proportionen dem Sockel und<br />
wurde vollständig mit Glasbausteinen verkleidet.<br />
Durchscheinend, hell und leicht wirkt dieser Teil<br />
nahezu entmaterialisiert und scheint nahtlos in den<br />
Himmel überzugehen. Die Wohnungen in diesem Bereich<br />
verfügen über Fenster mit Ausblick über die<br />
Stadt sowie Fassadenflächen, durch die das durch<br />
die Glasbausteine gefilterte Licht gedämpft nach<br />
innen fällt und eine einmalige Atmosphäre schafft.<br />
Auch um eine maximale thermische und akustische<br />
Effizienz zu erreichen, besteht die Hülle der Krone<br />
aus zwei Wänden, wobei die Außenhaut sowohl als<br />
Brüstung als auch als Fassade dient. Die erforderlichen<br />
haustechnischen Geräte auf dem Dach ließen<br />
sich durch eine entsprechende Überhöhung vollständig<br />
verdecken, während die Lichtdurchlässigkeit der<br />
Glaselemente einen diffusen und sanften Abschluss<br />
des oberen Teils des Gebäudes in der Vertikalen<br />
erzeugt. Trotz dieser Leichtigkeit mutet dieser Gebäudeteil<br />
ebenso wie der darunter liegende schwere<br />
Ziegelstein extrem haptisch und dauerhaft an. „Das<br />
Volumen erscheint solide und flüchtig zugleich, während<br />
die Bewohner durch die Aktivierung der Innenräume<br />
ein natürliches kinetisches Leuchten erzeugen“,<br />
erklärt Grzywinski.<br />
u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
46<br />
Intelligente Fassade<br />
Die Planer nahmen die Gelegenheit dankbar wahr,<br />
sowohl die Konstruktion als auch die Innenräume gestalten<br />
zu dürfen, um schließlich einen umfassenden<br />
Raumeindruck auf Basis des ambitionierten architektonischen<br />
Konzepts kreieren zu können. Gerade auf<br />
den öffentlichen Flächen des Projekts ist diese Integration<br />
von innen nach außen für die Architekten von<br />
grundlegender Bedeutung: „Das wichtigste strukturierende<br />
Element dieser Bereiche ist der parabolische<br />
Bogen. Er ist von der Straße aus durch eine großflächige<br />
Verglasung sichtbar und stützt und definiert<br />
das Zwischengeschoss im Inneren des erdgeschossigen,<br />
überhöhten Raums, während er gleichzeitig die<br />
Last der vorderen Hälfte des Gebäudes aufnimmt.“<br />
Dieser strukturelle Expressionismus wird durch eine<br />
integrierte Holzbalustrade sowie geriffelte Verkleidungen,<br />
warmen Lehmputz, wallende Vorhänge und<br />
die zarte Möblierung abgemildert. In Anlehnung an<br />
die Fassade wurden die Fußböden und Sockelleisten<br />
der Einbaumöbel mit eben jenen Ziegeln verkleidet.<br />
Den Concept Store im Erdgeschoss definieren Vitrinen<br />
aus rautenförmigen, mit Porzellan und Glas<br />
verkleideten Volumina, die die kuratierten Produkte<br />
in Szene setzen. Großzügig geschwungene und gepolsterte<br />
Sitzbänke, weiche Sofas und Poufs laden<br />
zum Verweilen ein. Die Gestaltung befindet sich –<br />
passend zum Inhalt der Vitrinen – an der Schnittstelle<br />
zwischen Kunst und Kommerz. Der Raum, der zu<br />
gleichen Teilen als Galerie, Lounge, Café, Shop und<br />
Wohnzimmer fungiert, wirkt ebenso einladend wie<br />
undefinierbar – eine gewünschte Intention der Architekten:<br />
„Wir hoffen, dass sich die Passanten gezwungen<br />
sehen, hineinzugehen, um zu erfahren, was<br />
genau das ist, und dass sie sich dann wohl fühlen und<br />
eine Weile bleiben.“<br />
Das durchdachte, materialbetonte und detailverliebte<br />
Design zieht sich von der Fassade bis in die Innenräume<br />
durch alle Bereiche stringent durch und eröffnet<br />
Bewohnern und Gästen ein umfassendes Raumerlebnis.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
47<br />
Grzywinski+Pons<br />
Mezzanin<br />
Während sich in den Buckle Street Studios öffentliche<br />
und private Räume grundsätzlich verzahnen, beginnen<br />
sie sich in Richtung der Krone mit den Wohneinheiten<br />
dennoch mehr und mehr von dem bunten<br />
Londoner Trubel zu abzugrenzen – auch wenn eine<br />
gewisse Offenheit durch die schimmernden Glasbausteine<br />
stets bewahrt bleibt. Hier kommen der Reiz<br />
und der Nutzen der leuchtenden Glasverkleidung<br />
in den Innenräumen voll zur Geltung, deren Anmutung<br />
von Licht und Wärme geprägt sind. Helle Holzböden,<br />
erdfarbener Lehmputz, cremefarbener Stein<br />
und samtige Nude-Töne verleihen dem Interior einen<br />
hochwertigen und einladenden Charakter.<br />
„Für uns als Architekten und unseren Bauherrn fördert<br />
dieses Projekt auch die gleichermaßen urbane wie<br />
persönliche Auseinandersetzung von Öffentlichkeit<br />
und Privatheit, zwischen Bewohnern und Besuchern.<br />
Diese Mischung ist der Stoff, aus dem so viele der erfolgreichsten<br />
und lebendigsten Gemeinden Londons<br />
gemacht sind“, bringt Grzywinski seine Motivation auf<br />
den Punkt. Whitechapel darf sich jedenfalls über einen<br />
rätselhaften und doch verlockenden öffentlichen<br />
Raum freuen, der einen integrativen und einladenden<br />
Kontext eröffnet, in dem die Gemeinschaft und die<br />
Besucher miteinander interagieren und sich gegenseitig<br />
inspirieren können – und sollen.<br />
•<br />
EG - Lobby<br />
Buckle Street Studios<br />
London, Großbritannien<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Mitarbeiter:<br />
Statik:<br />
Oaktree Capital<br />
Grzywinski+Pons<br />
Matthew Grzywinski, Amador Pons<br />
Manhire Associates<br />
Nutzfläche: 3.530 m 2<br />
Planungsbeginn: 2018<br />
Bauzeit:<br />
2 Jahre<br />
Fertigstellung: <strong>2022</strong><br />
www.gp-arch.com<br />
„Unser Studio hat sich einem herausragenden<br />
Design verschrieben, das<br />
auf Qualität, Schönheit, Innovation und<br />
einer rigorosen Herangehensweise an<br />
Details beruht. Design-Elemente wie<br />
Licht, Gestalt, Erschließung und Materialien<br />
haben stets Funktion, Ästhetik<br />
und Erlebnis in ihrer Gesamtheit im<br />
Blick. Wir betrachten Projektbeschränkungen<br />
immer auch als Chance, um Innovationen<br />
zu forcieren.“<br />
Matthew Grzywinski
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
48<br />
Intelligente Fassade
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
49<br />
CLOU architects<br />
Kreuz und<br />
quer gedacht<br />
Sanya Jinmao FarmLab / Hainan, China / CLOU architects<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Shining Laboratory<br />
4.600 m 2 Forschungs- und Ausstellungsflächen<br />
realisierten CLOU architects mit dem FarmLab im<br />
chinesischen Sanya. Der Multifunktionsbau vereint<br />
mit Landwirtschaft und Tourismus die beiden wichtigsten<br />
Wirtschaftssektoren der Region unter einem<br />
Dach und bietet Platz für Showrooms, vertikalen<br />
Indoor-Anbau und ein Farm-to-table-Restaurant.<br />
Rund um die innovative Forschung im Inneren legt<br />
sich eine ebenso smarte Rasterfassade.<br />
Mit ihrem tropischen Klima und den weiten Sandstränden<br />
zieht die Insel vor der Südküste Chinas vor<br />
allem Urlauber an. Neben dem Tourismus ist auf Hainan<br />
aber auch die Landwirtschaft von großer Bedeutung.<br />
Der Anbau und Vertrieb von Kaffee, Früchten<br />
und Nüssen floriert. Doch nicht nur der Agrarhandel,<br />
sondern auch die damit verbundene Forschung erlebt<br />
in Sanya, dem Zentrum im Süden des Eilands,<br />
einen regelrechten Boom. Denn immer häufiger wird<br />
die Nahrungsmittelproduktion – in Folge des Klimawandels<br />
– von knappen Ressourcen wie Wasser<br />
oder Boden beeinträchtigt. Auch die lokale Regierung<br />
erkannte den Bedarf an neuen, zukunftsfähigen<br />
Optionen und investiert zunehmend in Projekte<br />
dieser Art. Im Zuge dessen entwickelt sich der Nanfan-Bezirk<br />
sukzessive zum Silicon Valley der Saatgutindustrie<br />
und widmet sich als Hightech-Hub der<br />
landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technologie<br />
von morgen. Im Auftrag der Immobilienfirma Jinmao<br />
gestalteten CLOU architects mit dem FarmLab den<br />
jüngsten Zuwachs als neuen Fokus im Stadtteil. u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
50<br />
Intelligente Fassade<br />
Das L-förmige Gebäude entwickelt sich über vier<br />
Geschosse in die Höhe und wird von einer auffälligen<br />
Hülle umschlossen: Ab dem zweiten Stockwerk<br />
verlaufen die Fassaden schräg und werden mit dem<br />
Flachdach Teil des oberen Abschlusses. Oberhalb<br />
einer teils offenen, teils verglasten Sockelzone legt<br />
sich eine enorme Gitterstruktur über den kompakten<br />
Baukörper. Für diese ließ sich das Planerteam von<br />
den auskragenden Dachkonstruktionen der auf Hainan<br />
ansässigen Li-Minderheit inspirieren. Aus den<br />
traditionellen Strukturen wurde ein großformatiges<br />
Raster, welches dem Neubau sein charakteristisches<br />
Aussehen verleiht. Es stellt die erste Schicht der Außenhülle<br />
dar, schließt diese allerdings nicht hermetisch<br />
ab, sondern lässt mit seiner Transparenz Ausund<br />
Einblicke zu.<br />
Das holzfurnierte<br />
Stahlgitter legt sich vor<br />
Fassade und Dach. Hinter<br />
der gerasterten Hülle<br />
befinden sich nicht nur<br />
geschlossene Forschungsräume,<br />
sondern auch ganz<br />
oder halb außenliegende<br />
Bereiche.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
51<br />
CLOU architects<br />
Aufgrund von baubehördlichen Entscheidungen<br />
durfte das Gitter nicht – wie ursprünglich geplant –<br />
als tragende Fassade in Schichtholzträgern gebaut<br />
werden. Stattdessen besteht es nun aus einem mit<br />
furnierten Aluminiumelementen verkleideten Stahltragwerk.<br />
Die regelmäßig angeordneten Rasterträger<br />
sind bis zu einem Meter tief. Sie dienen mit ihren breiten<br />
Laibungen hauptsächlich als Sonnenschutz und<br />
garantieren die passive Kühlung des Sanya FarmLab.<br />
Neben der Beschattung sorgt die Dach- und Fassadenebene<br />
zudem für die natürliche Belüftung des<br />
Gebäudes: Während die Zwischenräume des Gitters<br />
an den Seiten offen bleiben, sind sie in den schrägen<br />
Abschnitten verglast. Das Glas ist je nach Programm<br />
innenseitig bedruckt oder klar, und schützt die Räume<br />
als zweite Hülle vor der Witterung. Es reduziert<br />
die Solarabsorption um bis zu 70%, lässt gleichzeitig<br />
aber jede Menge Licht einfallen und erinnert damit<br />
an landwirtschaftliche Gewächshäuser. Dadurch<br />
herrscht in dem neuen Zentrum ein durchwegs helles<br />
und freundliches Ambiente sowie ein angenehmes<br />
Raumklima, das durch die freie Luftzirkulation<br />
begünstigt wird. Integrierte Entwässerungsrinnen<br />
sammeln das Regenwasser, das anschließend für die<br />
Bepflanzung im Gebäude und die umgebenden Grünflächen<br />
genutzt wird. Für den ganzheitlichen Ansatz<br />
erhielt der Multifunktionsbau unter anderem den<br />
Iconic Award für innovative Architektur und wurde<br />
beim German Design Award für herausragende Architektur<br />
speziell gewürdigt.<br />
u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
52<br />
Intelligente Fassade<br />
Im Bereich der geneigten<br />
Dach- und Fassadenflächen<br />
schützt Glas vor<br />
tropischem Regen. Je<br />
nach Ausrichtung ist es<br />
matt bedruckt und sorgt<br />
so für eine geringere<br />
Solar absorption sowie<br />
helle Innenräume.<br />
Hinter der auffälligen Fassaden- und Dachstruktur<br />
verbirgt sich ein bunter Mix aus Außen- und Innenräumen<br />
sowie halboffenen Bereichen. Dynamische<br />
Grundrisse sollen auf allen Etagen den Austausch<br />
zwischen Wissenschaftern, Besuchern und Touristen<br />
fördern. Nur die Labore und Büros sind in gestapelten,<br />
geschlossenen Glasboxen untergebracht und<br />
aktiv klimatisiert. Ein zentraler Kern mit Treppe und<br />
Lift nutzt den Kamineffekt und führt warme Luft aus<br />
dem Gebäude nach oben hin ab. Rund herum ordnen<br />
sich – umschlossen von der Gitterstruktur – mit begrünten<br />
Plattformen, Spielflächen für Kinder, Multimedia-Ausstellungen<br />
und Café sämtliche öffentlichen<br />
Besucherfunktionen an. Im Erdgeschoss kragt<br />
die gerasterte Hülle über den Haupteingang und<br />
die Erschließungsflächen aus. Besucher empfängt<br />
hier nicht nur eine großzügige Lobby, sondern auch<br />
eine skulpturale Wendeltreppe, deren Spiralform den<br />
Raum beherrscht. Sie wird lediglich durch das Fassadenraster<br />
vom Außenraum abgegrenzt und verbindet<br />
vertikal die überdachten Freibereiche innerhalb<br />
des FarmLab. Ein großes offenes Auditorium rundet<br />
das Raumprogramm ab.<br />
Start-ups und innovative Unternehmen widmen sich<br />
in dem neuen Mehrzweckgebäude Themen wie Agrarrobotik<br />
und vertikalem Indoor-Farming. Die Forschung<br />
findet nicht nur hinter verschlossenen Türen<br />
statt, sondern wird in den anschließenden Ausstellungsbereichen<br />
auch den Besuchern nähergebracht.<br />
Diese sollen ihren eigenen Konsum bewusst überdenken<br />
und erhalten praktische Vorschläge für einen<br />
nachhaltigeren Lebensstil. Die angebauten Lebensmittel<br />
kommen im hauseigenen Restaurant direkt auf<br />
die Teller der Gäste und machen so das Farm-to-table-Konzept<br />
schmackhaft.<br />
Mit dem Forschungs- und Ausstellungszentrum wollten<br />
CLOU architects eine moderne Interpretation des<br />
Landwirtschaftsbetriebes schaffen, in dem Büro, Labor<br />
und Ausstellung nebeneinander und miteinander<br />
Platz finden. Diese Vision verkörperten sie in einem<br />
Entwurf, der Nachhaltigkeitsbewusstsein auf programmatischer<br />
wie architektonischer Ebene thematisiert.<br />
Das Sanya FarmLab zeigt neue Wege für die<br />
Landwirtschaft der Zukunft auf, lädt zum Entdecken,<br />
Verstehen und Probieren ein und wird so zum vielschichtigen<br />
Vermittler. Die effiziente Gebäudehülle<br />
ergänzt den zukunftsweisenden Ansatz mit ihrem<br />
Lowtech-Konzept perfekt und zeigt, wie ein komfortables<br />
Raumklima durch passive Planungselemente<br />
auch in tropischen Breitengraden ohne flächendeckende<br />
Klimatisierung umgesetzt werden kann. •
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
53<br />
CLOU architects<br />
Sanya Jinmao FarmLab<br />
Sanya, Hainan, China<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Projektleitung:<br />
Team:<br />
Jinmao Sanya Nanfan Rongmao Real Estate<br />
CLOU architects<br />
Jan Clostermann, Lin Li<br />
Na Zhao, Sebastian Loaiza, Julien Douillet, Yaxi Wang,<br />
Tianshu Liu, Tiago Tavares, Principia Wardhani,<br />
Javier Pelaez, Yiqiao Zhao<br />
Urban Architecture Design<br />
Statik/ TGA:<br />
Fassadenplanung: China Building Technique Group<br />
Lichtplanung: Fuzhou Bovs Lighting Design<br />
Grundstücksfläche: 3.485 m 2 (Teilfläche)<br />
Bebaute Fläche: 1.280 m 2<br />
Nutzfläche: 4.800 m 2<br />
Planungsbeginn: Januar 2020<br />
Bauzeit:<br />
12 Monate<br />
Fertigstellung: Juli 2021<br />
www.clouarchitects.com<br />
„In unserem internationalen Team verfolgen wir<br />
gemeinsam eine Mission: die besten sozial interaktiven<br />
Orte der Welt zu gestalten. Wir entwerfen<br />
und realisieren innovative Gesamtkonzepte,<br />
Gebäude und Innenräume, die positiven Einfluss<br />
haben – auf die, die sie planen und bauen, auf die<br />
unmittelbar lokale und weitere Umgebung, und<br />
auf die Menschen, Gruppen und Gemeinschaften,<br />
die sie nutzen.“<br />
Jan Clostermann, CLOU architects
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
54<br />
Intelligente Fassade
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
55<br />
Maison Edouard François<br />
Urbanes Wohnen<br />
im Grünen<br />
Le Ray / Nizza / Maison Edouard François<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Wearecontents<br />
Wo bis 2013 Torjubel<br />
erklang, befindet sich mit<br />
le Ray heute ein urbanes<br />
– und äußerst grünes –<br />
Viertel im Norden von<br />
Nizza. Das Büro Maison<br />
Edouard François konnte<br />
den Wettbewerb auf dem<br />
Areal des ehemaligen<br />
Fußballstadions für ein<br />
neues Wohnquartier mit<br />
Mischnutzung für sich<br />
entscheiden. Mit einem<br />
Masterplan à la Manhattan<br />
gestalteten die<br />
Pariser Planer nicht nur<br />
qualitativen Wohn- und<br />
Lebensraum, sondern<br />
auch eine der größten<br />
begrünten Fassaden<br />
Europas.<br />
Nach dem Abriss des Stadions blieben rund um das<br />
Gelände einige Sportplätze erhalten und auf dem<br />
größten Teil der Fläche entstand ein öffentlicher<br />
Park. Das neue, gemischte Quartier sollte die übrigen<br />
1,2 Hektar mit neuem Leben füllen. Nizza liegt<br />
idyllisch inmitten von üppig bewachsenen Hügeln,<br />
die der Stadt ihren mediterranen Charme verleihen.<br />
Von der südfranzösischen Landschaft ließen sich<br />
die Architekten bei der Planung inspirieren. Sie wollten<br />
eine „Insel der Frische“ schaffen, die trotz ihrer<br />
Großmaßstäblichkeit nicht repetitiv, sondern individuell<br />
wirkt. Um den begehrten Stadtraum an der<br />
Côte d’Azur bestmöglich zu nutzen, entwickelten<br />
sie ein Konzept, das auf vier Punkten basiert, die ihrer<br />
Meinung nach essenziell für urbane Dichte sind:<br />
Mobilität, Mischung, Materialität und Ökologie. Eine<br />
gute Infrastruktur war dabei von Anfang an gegeben:<br />
Der einstige Standort der Sportstätte begeistert mit<br />
Ausblicken bis zur Altstadt und dem Meer hin und<br />
verfügt zudem über eine direkte Straßenbahnverbindung,<br />
die innerhalb von zehn Minuten direkt ins<br />
Zentrum führt.<br />
u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
56<br />
Intelligente Fassade<br />
Le Ray besteht aus einer gemeinsamen Sockelzone<br />
und zehn Baukörpern, die darüber in die Höhe wachsen.<br />
Auf diese Weise brachte das Planerteam rund um<br />
Edouard François auf fast 25.000 m 2 ein gemischtes<br />
Programm aus Gewerbe- und Wohnflächen sowie 650<br />
Autostellplätze unter. Das Parkhaus erstreckt sich<br />
über zwei unterirdische Ebenen. Darüber befinden sich<br />
im durchgängigen Erdgeschoss ein Dōjō – ein Zentrum<br />
für japanischen Kampfsport – und ein 6.000 m 2<br />
großer Supermarkt, der zu drei Viertel in die Landschaft<br />
eingegraben ist. An der südwestlichen Ecke<br />
des Blocks öffnet sich das Kaufhaus zum Boulevard<br />
Gorbella und einem städtischen Platz hin in Form von<br />
ungleichen Schaufenstern. Sie erwecken den Eindruck<br />
einzelner Geschäfte, anstatt einer zusammenhängenden<br />
Ladenfläche. An diesem Punkt dockt das<br />
neue Wohnquartier an die Umgebung an: Die farbigen<br />
Stein- und Putzfassaden der Gebäude orientieren<br />
sich in ihrer Gestaltung an den traditionellen Ansichten<br />
Nizzas. Sie sind unterschiedlich hoch und sogar<br />
mit den typischen Fensterläden ausgestattet. Oberhalb<br />
der öffentlichen, kommerziellen Bereiche verteilen<br />
sich 250 Eigentumswohnungen und 100 geförderte<br />
Appartements auf die einzelnen Bauten.<br />
Wo sich bis dato relativ kahle Holzstangen<br />
vor die Fassaden legen, wird<br />
schon bald ein grünes Pflanzenkleid<br />
die Ansichten umspielen und sich<br />
sowohl auf das Raum- als auch auf das<br />
Stadtklima positiv auswirken.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
57<br />
Maison Edouard François<br />
Die Wohnhäuser betteten die Architekten in Kooperation<br />
mit Jean-Frédéric Gay, der als Landschaftsarchitekt<br />
mit seinem Büro La Compagnie du Paysage auch<br />
den angrenzenden Park plante, in einen vielfältigen<br />
Garten ein. Dieser legt sich zwischen die einzelnen<br />
Volumen. Er beschränkt sich nicht nur auf die Horizontale,<br />
sondern wächst an den Außenwänden der<br />
Bauten weiter in die Höhe und unterstützt Edouard<br />
François‘ Idee der „durch Begrünung unterstützten“<br />
Fassade. Bewachsene Dächer und Gemüsegärten<br />
komplettieren das neue, grüne Stadtquartier. Aufgrund<br />
der seismischen Aktivität in der Region sind<br />
die Gebäude in Sichtbeton gefertigt. Davor legt sich<br />
eine leichte Konstruktion aus Kastanienholzstäben,<br />
die Fassaden und Loggien einfasst und als Rankgitter<br />
für das grüne Blätterkleid dient. Zwischen den<br />
Holzstangen verlaufen Edelstahlkabel, an denen die<br />
Pflanzen künftig ebenfalls empor klettern können.<br />
Die Kletterpflanzen wurden unten direkt in die Grünstreifen<br />
entlang der Wohnbauten eingesetzt, weiter<br />
oben wachsen sie in Kübeln. Ein sichtbares Rohrnetz<br />
für Be- und Entwässerung versorgt das junge Grün.<br />
Es rundet die zweischichtigen Ansichten ab und verleiht<br />
ihnen ein nahezu grafisches Design. Notausgänge,<br />
Lüftungsgitter und andere sicherheitstechnische<br />
Einrichtungen verstecken sich an unauffälligen Stellen<br />
hinter dem grünen Vorhang und sorgen für ein<br />
naturnahes Erlebnis. Die Vegetation wurde so ausgewählt,<br />
dass sie ein in sich geschlossenes Ökosystem<br />
ergibt, das Ressourcen wie Wasser, Luft und Sonne<br />
sowie Nährstoffe miteinander teilt. Bereits nach drei<br />
Jahren versorgen sich die Pflanzen völlig autonom<br />
und müssen nicht mehr gegossen werden. u
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
58<br />
Intelligente Fassade<br />
Die Fassaden der Gebäude<br />
am Boulevard Gorbella<br />
stellen Bezüge zur Umgebung<br />
her. Lediglich zwei<br />
auf die bunten Putzfassaden<br />
gesetzte Staffelgeschosse<br />
lassen die<br />
Gestaltung des übrigen<br />
Viertels erahnen.<br />
Zwischen grüner und gebauter Hülle ist jeder der<br />
Wohneinheiten ein Balkon oder eine Terrasse zugeordnet.<br />
Von dem Gestänge und Geländern aus<br />
hölzernen Lamellen eingefasst, sollen sie Raum zur<br />
persönlichen Entfaltung der Bewohner bieten. Diese<br />
können selbst entscheiden, ob sie die Loggia als<br />
privaten Außenraum nutzen, oder ihn schließen und<br />
ihre Wohnfläche vergrößern. Laut Hausordnung dürfen<br />
die Erweiterungen ausschließlich aus unverrottbarem<br />
Holz wie Kastanie oder Robinie umgesetzt<br />
werden. In Zukunft erscheinen die Fassaden von Le<br />
Ray dadurch wohl noch individueller und unregelmäßiger.<br />
Der alternative Ansatz mit Durchmischung und<br />
Begrünung stieß anfänglich auf wenig Begeisterung.<br />
Gegenstimmen aus der Bevölkerung begegneten<br />
die Planer aus Paris daraufhin mit Transparenz und<br />
Dialog. In einem partizipativen Prozess bezogen sie<br />
die Nachbarschaft und deren Wünsche in den Entwurf<br />
mit ein und erlangten so die Akzeptanz der Anrainer.<br />
Selbst dem OGC Nizza, dem Fußballclub, der<br />
einst auf dem Areal seine Heimspiele austrug, wurde<br />
Tribut gezollt: In der in Marmor ausgeführten Haupteingangshalle<br />
erinnern Ausstellungsstücke und Stadionsitze<br />
an die sportliche Vergangenheit und lassen<br />
das Herz von Fußballfans höher schlagen.<br />
Getreu dem Motto „mehr ist mehr“ dachten Maison<br />
Edouard François Architekten mit dem Le Ray-Quartier<br />
auf vielen Ebenen einen Schritt weiter. Anstatt<br />
sich auf minimale Anforderungen zu beschränken,<br />
zeigen sie Chancen für moderne, urbane Projekte<br />
auf – Versickerung anstelle von Versiegelung, Grün<br />
statt Grau und Individualität als Ersatz für Monotonie.<br />
Die Fassade der neuen Siedlung in Nizza ist eine<br />
der größten begrünten Fassaden Europas und kühlt<br />
nicht nur den Wohn-, sondern auch den Stadtraum.<br />
So wirkt sie sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die<br />
Lebensqualität des Viertels aus.<br />
•
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
59<br />
Maison Edouard François<br />
Le Ray<br />
Nizza, Frankreich<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Team:<br />
Statik:<br />
Landschaftsplanung:<br />
TGA:<br />
VINCI Immobilier<br />
Maison Edouard François<br />
Mathieu Chatenet, Jérémie Dalin, Pauline Lécrivain<br />
Verdier Ingénierie<br />
La Compagnie du Paysage<br />
Ingerop<br />
Grundstücksfläche: 1,2 Hektar<br />
Nutzfläche: 24.500 m 2<br />
Planungsbeginn: 2016<br />
Bauzeit:<br />
36 Monate<br />
Fertigstellung: 2021<br />
Baukosten:<br />
48,8 Mio. Euro (exkl. MwSt.)<br />
www.edouardfrancois.com<br />
„Ökologie heißt, heute an morgen zu<br />
denken, um Wärmeinseln zu bekämpfen.<br />
Potenzielle Lösungen dafür sind Hyperbegrünung<br />
und Hyperdurchlässigkeit der<br />
Böden. Wir müssen am Fuße der Fassaden<br />
Grünstreifen freilassen, damit Pflanzen<br />
von dort aus die Bauten bewachsen und<br />
so die Städte erfrischen können.“<br />
Maison Edouard François
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
60<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Feuer, Wasser,<br />
Erde, Luft<br />
Online-Shopping war gestern. Das Einkaufserlebnis von morgen ist physischer<br />
Natur. Und es soll alle Sinne ansprechen, wenn es nach Ruud Belmans,<br />
dem Kreativdirektor für Raumgestaltung bei WeWantMore geht. Das interdisziplinär<br />
aufgestellte Studio für Raumkonzepte und Markendesign zeichnet<br />
für das neue 400 m 2 große Ladenlokal des belgischen Traditionshauses<br />
Timmermans in Sint-Niklaas verantwortlich. Das Gesamtkonzept umfasst<br />
neben der Innenraumgestaltung auch das Grafik- und Verpackungsdesign.<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: WeWantMore<br />
Auch heute noch, 145 Jahre nach der Gründung des<br />
Unternehmens, sind für Geschäftsführerin Carole<br />
Timmermans das Fühlen der Materialien von Schuhen<br />
und Kleidern, das erste Hineinschlüpfen in ein Kleidungsstück<br />
und sogar der Duft vor Ort essenzielle<br />
Bestandteile eines sinnlichen und intuitiven Einkaufserlebnisses.<br />
Dazu gehört für Belmans eine flexible<br />
Verkaufsfläche, die sich im Laufe der Jahreszeiten mit<br />
den Kollektionen wandeln lässt: „Der Shop soll bei jedem<br />
Besuch der Stammkundschaft ein wenig anders<br />
aussehen, ohne dabei seinen Wiedererkennungswert<br />
zu verlieren.“ Die Lösung: ein flexibles Raster, das die<br />
Fläche in vier verschiedene Zonen unterteilt, die wiederum<br />
jeweils eines der vier Elemente repräsentieren.<br />
Dazu ein Vorhangsystem, das sich im Zickzack über<br />
die gesamte Länge des Raumes erstreckt und die Bereiche<br />
je nach Anforderung voneinander trennt oder<br />
sie ineinanderfließen lässt.<br />
Wie die Modebranche selbst, kommt auch der physische<br />
Einzelhandel nicht umhin, sich wieder einmal<br />
neu zu erfinden. WeWantMore haben für ihr Konzept<br />
die Umkleidekabinen und die Kassenzone in der Mitte<br />
des Ladens positioniert. Der Flachs, der die Anprobe<br />
optisch und räumlich fasst, ist gleichermaßen neutral<br />
wie taktil – eine Textur, die geradezu dazu einlädt,<br />
berührt zu werden. Dazu befindet sich in jedem Einkaufsbereich<br />
ein auffälliges Einrichtungsobjekt, das<br />
sich auf eines der vier Elemente bezieht. „Die Kollektionen<br />
geben dem Geschäft bereits seine helle<br />
Farbpalette vor. Deshalb haben wir uns entschieden,<br />
Farbe nur in Form von Materialien hinzuzufügen: Präsentationsflächen<br />
und -volumen aus rotem Travertin,<br />
rohen Betonsteinen, geschwärztem Holz und Baumstämmen<br />
verweisen auf Erde und Feuer, während Kathedralglas<br />
und halbtransparente Vorhänge Wasser<br />
und Luft in das Innere bringen“, erklärt Belmans.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
61<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Da das neue Timmermans-Geschäft außerhalb des<br />
Einkaufsviertels der Stadt liegt, war ein traditionelles<br />
großes Schaufenster nicht notwendig, die Sichtbarkeit<br />
dafür umso entscheidender. WeWantMore<br />
setzten auf eine zweiteilige Fassade mit einem robusten<br />
Teil aus Kork und einer weiteren Wand aus<br />
Aluminium, die mit einer subtilen wellenartigen<br />
Textur das Element Wasser symbolisiert und einen<br />
starken Kontrastpunkt zum erdig anmutenden Naturmaterial<br />
Kork setzt. Ein rundes Fenster verbindet<br />
den Innenraum mit der Außenwelt. „Beim Einsatz von<br />
Kunst- und Tageslicht sind Rhythmus und Schichtung<br />
wichtig. Die Kombination von Oberlichtern, die<br />
für natürliches Licht sorgen, mit eher technischem<br />
und direktem Licht, das die Produkte optimal zur<br />
Geltung bringt, ist bei der Gestaltung von Einzelhandelsflächen<br />
von entscheidender Bedeutung“, sagt<br />
Belmans und verweist auf die Bedeutung der Kombination<br />
von Materialien, Oberflächen und Farben für<br />
ein Einkaufs erlebnis, das alle Sinne ansprechen soll.<br />
Anfassen unbedingt erlaubt!
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
62<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
stil bewusst sehen<br />
Aschaffenburg, Heinsestraße 8. In der Mitte des offenen, weitläufigen Raumes<br />
eine knuffige Couch in rotem Samt, daneben ein lässiger Retrosessel, dazwischen<br />
ein luftiger Beistelltisch. Gleich gegenüber des Counters ein ausgesucht<br />
bestückter Barwagen. Dazu stilvoll ausgewählte Leuchten und grüne<br />
Pflanzen in naturbetonten Töpfen. Gerahmt wird dieses Gesamtkunstwerk<br />
von einer perfekt abgestimmten Komposition aus kräftigen Farbtönen. Was<br />
auf den ersten Blick wie ein eleganter Concept Store erscheint, ist „nur“ ein<br />
Optikgeschäft. Dabei spiegelt sich der Name „Bartels – stil bewusst sehen“<br />
eins zu eins in der Innenraumgestaltung von Stephanie Thatenhorst wider.<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: Stefan Grau<br />
„Das richtige Farbkonzept gibt eindeutig den Ton<br />
vor. Ich liebe starke Farben und den selbstbewussten<br />
Einsatz verschiedenster Materialien – gerade, wenn<br />
es um die Gestaltung von Verkaufsflächen geht“,<br />
erklärt die Innenarchitektin. Während Thatenhorst<br />
die direkte Beleuchtung gezielt einsetzt, um die Verkaufsobjekte<br />
in Szene zu setzen, kommt die indirekte<br />
Beleuchtung zum Tragen, wenn es darum geht, einen<br />
Shop nahbar und wohnlich zu gestalten. Funktionalität<br />
und den gewünschten Look unter einen Hut zu<br />
bekommen – darin besteht die größte Herausforderung<br />
für die Architektin: „Oft wird beim Verkaufsdesign<br />
auf wohnliche Aspekte wie Textilien, Teppiche<br />
oder Akzentleuchten verzichtet – was ich absolut<br />
falsch finde. Bei dem Projekt Bartels Optik konnten<br />
wir beides vereinen: eine angenehme Atmosphäre mit<br />
stilvoller Produktpräsentation.“
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
63<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Die farbenfrohe, kontrastreiche Raumwelt setzt auf<br />
eine Kombination von grafischen Mustern für Stoffe<br />
und Fliesen sowie gezielt positionierte Vorhänge und<br />
Teppiche, um den Raum zu zonieren. Der Boden aus<br />
Sichtbeton schafft den balancierten Ausgleich zur<br />
eher warmen Wohnzimmeratmosphäre und vermittelt<br />
eine gewisse Coolness und Eleganz, die ganz der<br />
effektvollen Inszenierung der Brillen dient.<br />
Der Grundriss ist konzeptionell an eine Wohnung<br />
angelehnt und dementsprechend in verschiedene<br />
„Wohnbereiche“ – wie Lounge-Ecke, Kaffeetresen<br />
oder Separee – aufgeteilt, wobei verschiedene Zonen<br />
ineinanderfließen dürfen. Große Auflageteppiche<br />
und gemütliche Polstermöbel sorgen nicht nur für ein<br />
Gefühl der Privatsphäre und Geborgenheit, sondern<br />
schaffen auch eine angenehme Akustik. Auf diese<br />
Weise ergeben sich ganz natürlich intime Bereiche zur<br />
individuellen Beratung der Kunden. Als besonderes<br />
Highlight ist der Werkstattbereich so angelegt, dass<br />
er für den Kunden gut einsehbar ist und das filigrane<br />
Handwerk nebenbei mitverfolgt werden kann.<br />
Die Brillen selbst werden auf farbigen, simplen Metallregalen<br />
präsentiert. Einfache, geometrische Boards<br />
dienen zusätzlich dem Verstauen der Brillen, die in<br />
großen Schubladen gelagert werden. Beim Testen<br />
der Brillen können sich die Kunden in von der Decke<br />
abgehängten Spiegeln in geometrischen Formen betrachten.<br />
Gerade bei der Möblierung von Verkaufsflächen<br />
liegt für Thatenhorst eine individuell gestaltete<br />
Einbaulösung nahe: „Die sollte aber unbedingt durch<br />
weitere Produkte ergänzt werden – der Mix macht es!“
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
64<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Aspirin statt<br />
Abendmenü<br />
Im Zuge der Covid-Pandemie sah sich ein Restaurant-Besitzer in Puerto<br />
Vallarta an der Pazifikküste im Westen Mexikos gezwungen, neue Wege<br />
zu gehen. Der Inhaber entschied sich dazu, eine Apotheke aus dem Lokal<br />
zu machen. Nach 35 Jahren heißt es nun: Rezept statt Abendkarte. Für die<br />
Farmacia del Río entwickelten die mexikanischen Architekten güey studio<br />
ein unkonventionelles, buntes Design.<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Eduardo Mendoza<br />
Während vergleichbare Projekte oft eintönig und wenig<br />
aufregend gestaltet sind, entschied sich das Planertrio<br />
dazu, den Besuch in der Apotheke zum Erlebnis<br />
zu machen. Sie kreierten ein Konzept mit hohem<br />
Wiedererkennungswert für diese und alle zukünftigen<br />
Filialen der neuen Franchise-Kette. Ihre Arbeit beschränkte<br />
sich dabei nicht nur auf den Umbau der Innenräume,<br />
sondern setzte sich bis zum Logo fort. Neben<br />
dem Verkaufsraum für Arzneimittel gehört auch<br />
eine kleine Praxis zur Farmacia del Río. Beide sind<br />
über ein gemeinsames Foyer miteinander verbunden,<br />
verfügen aber gemäß den Vorschriften über separate<br />
Eingänge. So können sich Patienten im Anschluss an<br />
den Arztbesuch bequem die verschriebenen Medikamente<br />
besorgen.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
65<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
we<br />
ove<br />
livefor<br />
light<br />
Die Präsentation von Highend-Produkten erfordert<br />
ein qualitatives, funktionales Beleuchtungsdesign<br />
sowie ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl<br />
bei der Planung. Abgestimmt auf Brand und<br />
Shop-Architektur liefert Molto Luce ein harmonisches<br />
Konzept für designorientiertes, effizientes<br />
und maßgeschneidertes Shop-Licht.<br />
Von außen fügt sich der in lokalen Materialien gefertigte<br />
Bau mit seiner natürlichen Textur harmonisch<br />
in den Urlaubsort ein. Blickt man durch das große<br />
Schaufenster in die Apotheke, erwartet man zunächst<br />
eher, dass hier Süßigkeiten und keine Arzneien über<br />
den Tresen wandern. Im Gegensatz zur schlichten<br />
Fassade ist das Innere in freundlichen Tönen gestaltet.<br />
Sie ziehen die Blicke der Passanten auf sich und<br />
sorgen außerdem für eine angenehme Atmosphäre.<br />
Farbige Wände zonieren die Ladenfläche optisch. Der<br />
Bereich der Angestellten ist ganz in Blau gestrichen.<br />
Eine Theke in kräftigem Orange trennt den öffentlichen<br />
und privaten Teil der Apotheke endgültig voneinander<br />
ab. An ihrer Vorderseite leuchten türkise<br />
Regalböden aus den Vitrinen. Knalliges Dottergelb an<br />
einer Hintertür und in der Küchenzeile der Mitarbeiter<br />
komplettiert die bunte Farbpalette. Dazu kombinierten<br />
die mexikanischen Architekten Regalböden<br />
aus Holz, die der Farmacia del Río mit ihrer Maserung<br />
einen natürlichen Touch verleihen. Im Kundenbereich<br />
fügen sich die Bretter an die Wand und dienen als Präsentationsfläche.<br />
Hinter dem Verkaufstisch stehen<br />
sie, von Metall gerahmt, als Regale mit mehreren Etagen<br />
mitten im Raum und bieten Platz für die Organisation<br />
der Medikamente. Auch den Wartebereich der<br />
Arztpraxis prägt das farbenfrohe Konzept. Selbst im<br />
dezenten, weißen Behandlungsraum halten in Form<br />
von bunten Möbeln einzelne Farbakzente Einzug.<br />
COLOURFUL LIGHT. COLOURFUL LIFE.<br />
Ab sofort schreibt Molto Luce<br />
seine Stories auch in Farbe.<br />
Kuratierte Creative Colours bedeuten<br />
noch mehr Gestaltungsfreiheit,<br />
auch im Ladenbau.<br />
Wels / Wien / Graz / Innsbruck<br />
München / Köln / Hamburg<br />
Brescia / Lenzburg<br />
www.moltoluce.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
66<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Wo Schuhkauf<br />
zum Erlebnis wird<br />
Traditionelle Qualität trifft im neuen Flagship-Store des High-End-Schuhlabels<br />
Notabene auf industrielles Design. Mitten in der Altstadt von Kopenhagen<br />
entwickelten Norm Architects ein völlig neues Ladenkonzept und<br />
setzten dabei auf Beton, Eichenholz und Metall. Kunden können hier nicht<br />
nur einkaufen, sondern in dem holistischen Shop vom Entwurfsprozess bis<br />
hin zu Produktion und Pflege in die Welt der Schuhe eintauchen.<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Jonas Bjerre-Poulsen<br />
Das Planerteam ließ sich bei der Gestaltung des<br />
Shops von der Philosophie der traditionellen Marke<br />
inspirieren und wählte Kontraste: Klassisch trifft auf<br />
innovativ, zart auf kraftvoll. Während rohe Oberflächen<br />
die Geschichte der Räumlichkeiten erzählen,<br />
spiegeln exklusive Schreinerarbeiten das präzise<br />
Schusterhandwerk wider. Das Ergebnis ist ein 250 m 2<br />
großer Laden, der Verkaufsfläche und Atelier vereint<br />
und die hochwertigen Produkte in den Fokus rückt.<br />
Beim Betreten des Stores gelangt man direkt in den<br />
Hauptraum, der mit hohen Decken, unverkleideten<br />
Sichtbetonwänden und -säulen empfängt. Leichte<br />
Vorhänge legen sich vor die großen Fenster und<br />
sorgen für Privatsphäre, lassen aber gleichzeitig jede<br />
Menge Licht in den Raum. Auf dem hellen Terrazzoboden<br />
stehen Sockel aus Ton und Holz, auf denen<br />
die Schuhe ausgestellt werden. Entlang der Wände<br />
fungieren zart-schimmernde Metallregale als weitere<br />
Präsentationsflächen. Sämtliche Holzeinbauten<br />
wurden von lokalen Handwerkern maßgefertigt. Die<br />
Möbel entwarfen die japanischen Designer Karimoku<br />
Case Study speziell für den Laden. Zum prägenden<br />
Element des Raums wird eine skulpturale Treppe: Sie<br />
verbindet die drei Ebenen des Shops miteinander.<br />
Nach unten gelangt man in die Schuhputz-Bar, hinauf<br />
in eine offene Galerie. Diese ist in den Verkaufsraum<br />
eingehängt und beinhaltet das Designlabor des<br />
Schuhlabels. Die Stiege fassen vertikale, dicke Holzlamellen<br />
ein, die sich in regelmäßigen Abständen aneinanderfügen.<br />
Als Geländer begleiten sie die einzelnen<br />
Stufen und fungieren gleichzeitig als Brüstung des<br />
Zwischengeschosses.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
67<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Im Gegensatz zum grauen Beton im Eingangsbereich<br />
erwarten Kunden in der unteren Etage mit Eichenholz<br />
verkleidete Wände. Sie sollen Wärme ausstrahlen und<br />
ein heimeliges Gefühl vermitteln. Anstatt der neuesten<br />
Schuhtrends dreht sich hier alles um die professionelle<br />
Pflege. Bis das eigene Lieblingspaar wieder<br />
in neuem Glanz erstrahlt, schlüpft man in weiche<br />
Pantoffeln und kann in der gemütlichen Lounge-Ecke<br />
entspannt in Magazinen blättern. Ein zentraler Tresen,<br />
an dem wahlweise Kaffee oder Drinks serviert werden,<br />
komplettiert den Notabene Flagship-Store und rundet<br />
das etwas andere Shopping-Erlebnis stimmig ab.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
68<br />
RETAIL<strong>architektur</strong>
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
| BA12-22G |<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Futuristisches<br />
Retrodesign<br />
Im Herzen von SoHo in New York hat Kanuk, kanadischer<br />
Hersteller von handgefertigten Wintermänteln<br />
aus Montreal, seine erste internationale Boutique<br />
eröffnet. Gestaltet wurde der Shop, der in einem historischen,<br />
6-stöckigen Gebäude situiert ist, vom Architekturstudio<br />
Atelier Barda aus Montreal.<br />
Fotos: Eric Petschek<br />
Ihr Grundkonzept basiert auf drei unterschiedlichen Räumen,<br />
darunter eine Empfangshalle, ein Produktausstellungsraum<br />
und ein Umkleidebereich. Die Designer mischten bei der Gestaltung<br />
historische Referenzen des Mantelherstellers mit<br />
Elementen, die die New Yorker Umgebung des Geschäfts<br />
widerspiegeln. Das gewünschte, galerieähnliche Ambiente<br />
unterstützen Plakate und Videobildschirme, welche die Werbekampagnen<br />
von Kanuk zeigen – in Anlehnung an die zweisprachige<br />
Kultur in Montreal sowohl auf Französisch als auch<br />
auf Englisch.<br />
Beim Betreten des Stores lenkt der weit geöffnete Raum sofort<br />
von den Erwartungen an eine klassische Verkaufsfläche<br />
ab. Die minimalistischen Gestaltungsmerkmale lassen hier die<br />
Grenzen zwischen Einzelhandel und Galerie verschwimmen.<br />
Ein transluzenter, monolithischer Schreibtisch steht als einer<br />
der wenigen Einrichtungsgegenstände im Raum und verkörpert<br />
eine Art rituellen „Altar“. Helle Teppiche mit Retro-Akzenten<br />
in Grau und Braun bilden einen subtilen Kontrast zu dem<br />
ansonsten zeitgenössischen Erscheinungsbild des Raums.<br />
Designelemente aus dem Montreal der 1960er- und 1970er-<br />
Jahre machen Anspielungen auf die Geschichte der Marke.<br />
Die Beleuchtung fungiert als wesentliches Element, um die<br />
unterschiedlichen Atmosphären der verschiedenen Räume<br />
zu gestalten. Atelier Barda setzte das Konzept dafür in Zusammenarbeit<br />
mit Derek Porter Studio und James Clotfelter<br />
Lighting Design um. Versteckte Vouten-Beleuchtung<br />
strahlt nach oben und wird von der gewölbten, weißen Decke<br />
des Ausstellungsraums reflektiert, wodurch reichlich<br />
diffuses Licht in den scheinbar unendlichen, schattenlosen<br />
Raum zurückgeworfen wird. Diese Helligkeit und Unendlichkeit<br />
rufen ein Gefühl von Winterweiß und Schwerelosigkeit<br />
hervor, das die physischen Grenzen des Raums<br />
verwischt und den Blick auf den Boden und seine scheinbar<br />
schwebenden Produkte und feinen Details lenkt.<br />
„Unsere Absicht bei diesem Projekt war es, einen atmosphärischen<br />
und erlebbaren Raum für Besucher zu schaffen, um uns<br />
von der traditionellen Einzelhandelsumgebung abzuheben.<br />
Wir haben uns auch auf die Einzigartigkeit von Kanuk konzentriert<br />
und sind der Essenz der Vision und Kultur der Marke<br />
treu geblieben,“ erläutern die Designer.<br />
Licht unlimited:<br />
TwinCAT 3 Lighting Solution<br />
für DALI-2<br />
Die TwinCAT 3 Lighting Solution:<br />
über Excel konfigurierbar, voll HTML- und webfähig,<br />
dezentral skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar<br />
vereinfacht alle Arbeitsschritte von Engineering bis Wartung<br />
integriert alle typischen Lichtregelungen<br />
unbegrenzte Anzahl der DALI-2-Linien<br />
schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und<br />
Erweiterungen direkt im Betrieb<br />
DALI-2-Linien unabhängige Gruppierungen<br />
ermöglicht tagesverlaufsbezogene Human-Centric-Lighting-<br />
Konzepte<br />
Scannen und<br />
alles über die<br />
Vorteile der<br />
Lighting Solution<br />
erfahren
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
70<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Funktionaler Allrounder<br />
Als Spezialist für innovative Beleuchtungslösungen hat sich Molto Luce auch<br />
international einen Namen gemacht. Großes Know-how hat der Leuchtenhersteller<br />
aus Oberösterreich im Bereich Retail vorzuweisen. Namhafte Marken setzen bei<br />
der Beleuchtung ihrer Shops auf die funktionalen Lichtlösungen und das Fingerspitzengefühl<br />
der erfahrenen Planer, die an den zehn Unternehmensstandorten in<br />
Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien aktiv sind.<br />
Gerade im Shop kommt es auf die richtige Stimmung,<br />
aber ebenso auf die richtige Inszenierung der Produkte<br />
an: Mit dem innovativen Lichtbandsystem TRAIL<br />
bietet Molto Luce ein zukunftssicheres Lichtsystem,<br />
das alle Wege mitgeht. Selbst eine Anpassung an sich<br />
ändernde Erfordernisse ist mit TRAIL eine Kleinigkeit.<br />
Standardmäßig 7- oder 11-polig durchgangsverdrahtet,<br />
bietet TRAIL deutlich mehr Gestaltungsfreiraum<br />
als eine klassische 3-Phasenschiene. Strahler oder<br />
lineare Lichteinsätze in diversen Abstrahlcharakteristiken,<br />
Notlicht oder Lautsprecher – TRAIL nimmt<br />
alles auf und ermöglicht ein nachträgliches Adaptieren!<br />
Darum ist TRAIL wunderbar als Shoplicht-Lösung<br />
geeignet. Das schlichte Design des Systems<br />
lässt die Beleuchtung in den Hintergrund treten. Was<br />
bleibt, sind die gezielt gesetzten Lichteffekte, die das<br />
Produkt in den Fokus des Betrachters rücken, eine<br />
Zonierung des Shops ermöglichen und beste Einkaufsatmosphäre<br />
sicherstellen.<br />
Das Lichtbandsystem kann aber auch für die dazu<br />
gehörenden Lagerbereiche optimal konfiguriert<br />
werden. Gerade bei größeren Flächen besteht die<br />
Möglichkeit, Sensoren zu integrieren, die in direkter<br />
Interaktion mit den Leuchten stehen. Auf diese Weise<br />
kann sowohl Energie als auch CO 2 deutlich eingespart<br />
werden.<br />
Molto Luce GmbH<br />
T +43 (0)7242 698-0<br />
office@moltoluce.com<br />
www.moltoluce.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
71<br />
RETAIL<strong>architektur</strong><br />
Lösungen zwischen<br />
Tür und Zarge<br />
Fotos: Bründl Sports / Joachim Grothus<br />
Kautschuk für Flagship-Store<br />
Mit 31 Niederlassungen an neun Standorten<br />
ist Bründl Sports das größte Wintersporthaus<br />
im Alpenraum. Dieser Leitgedanke<br />
war auch bei der Erweiterung des<br />
Flagship-Stores im Salzburger Kaprun<br />
prägend. Das mehrfach für seine visionäre<br />
Architektur ausgezeichnete, vierstöckige<br />
Gebäude wurde 2021 auf 2.500<br />
Quadratmeter Verkaufsfläche verdoppelt.<br />
Beim Umbau spielte die Nachhaltigkeit<br />
eine zentrale Rolle. Deshalb entschied<br />
man sich für den Kautschukboden noraplan<br />
unita, der in verschiedenen Farben<br />
auf mehr als der Hälfte der Gesamtfläche<br />
im Verkaufsbereich sowie auf den<br />
Treppen verlegt wurde. Auf dem Großteil<br />
der Verkaufsfläche nimmt sich der Belag<br />
dabei in Naturfarbtönen optisch dezent<br />
zurück, nur auf einigen Pop-up-Flächen<br />
wurde er in Akzentfarben verlegt und<br />
ergibt mit der gleichfarbigen Wandgestaltung<br />
ein Raum-in-Raum-Konzept.<br />
Neben der attraktiven Optik waren vor<br />
allem die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit<br />
entscheidende Auswahlkriterien<br />
für diesen Boden. noraplan unita ist<br />
CO 2 -neutral – verbleibende Emissionen<br />
gleicht das Unternehmen freiwillig aus.<br />
Er ist mit dem „Blauen Engel“ sowie dem<br />
Indoor Air Comfort Gold-Siegel ausgezeichnet,<br />
enthält keine Phthalat-Weichmacher<br />
und bietet damit optimale Bedingungen<br />
für eine gute Qualität der<br />
Innenraumluft. Zudem vermindern Kautschukböden<br />
durch ihre Dauerelastizität<br />
den Gehschall und sorgen auf diese Weise<br />
für eine gute Raumakustik.<br />
nora flooring systems GesmbH<br />
+43 (0)7242 74 001-0<br />
info-at@nora.com<br />
www.nora.com<br />
Ihr Kontakt<br />
Alexander Moser<br />
+43 664 / 167 2514<br />
www.simonswerk.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
72<br />
Licht<br />
Wohnlich Erleuchtet<br />
Mit ihrem Projekt „Das Bootshaus“ beschritt die Gastronomen-Familie Querfeld<br />
einen „neuen Weg am Wasser“ und verbindet damit zwei ihrer Leidenschaften<br />
miteinander: das Rudern und die Gastronomie.<br />
Fotos: Alexander Magyar<br />
Der Ursprung des Lokals an der Alten Donau liegt<br />
rund um das Jahr 1900, als dort die Kleingartenkolonie<br />
„Neu Brasilien“ gegründet wurde. Aus dem<br />
damaligen kleinen Ausschank für die Kleingärtner,<br />
bestehend aus einer kleinen Hütte und zwei Bänken,<br />
entwickelte sich auch im Sog des aufkommenden<br />
Rudersports das Traditionslokal „Neu Brasilien“, das<br />
2017 von Querfeld übernommen wurde. Es folgte<br />
die behutsame Renovierung des historischen Hauses<br />
und die Schaffung eines Lokals im Stil eines britisch-wienerischen<br />
Ruderclubs.<br />
Stilistisch haben sich die Eigentümer gemeinsam mit<br />
dem Lichtspezialisten Alexander Magyar und den<br />
Innenarchitekten von Derenko an Beispielen des traditionell<br />
britischen Rudersports orientiert und diese<br />
Stimmung nach Wien geholt. Zur Inszenierung bediente<br />
man sich hochwertiger Materialien, wie dunkelbraunem<br />
Leder, Kupfer und Eiche, sowie originaler<br />
Dekor-Elemente. Holzvertäfelungen, alte Spinde
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
sowie Sprossenwände und Sportgeräte sorgen für<br />
ein authentisches „Gym-Feeling“. Historische Fotos<br />
und alte Pokale erinnern an die Rudervergangenheit<br />
an der Alten Donau. Das Finish für das perfekte Ruderclub-Flair<br />
bildet ein heller, offener Dachstuhl in<br />
gedecktem Weiß, an dem neben Kristall-Lustern aus<br />
England auch zwei alte Ruderboote abgehängt wurden.<br />
Draußen bietet der idyllische Steg eine unversperrte<br />
Aussicht auf die Skyline der Stadt.<br />
In Szene gesetzt wird all das durch ein durchdachtes<br />
Lichtkonzept. Lichtplaner Magyar fasst seine<br />
Herangehensweise an die Beleuchtung für das nicht<br />
alltägliche Gastronomieprojekt folgendermaßen zusammen:<br />
„Meine Aufgabe bestand darin, die Lichtstimmung<br />
zu inszenieren. Ich entschied mich dazu,<br />
nur von der Seite aus mit speziell gefertigten Auslegern,<br />
die Tische direkt zu beleuchten. Damit wir<br />
eine gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre erzeugen,<br />
wurden auf den Auslegern Strahler mit engem<br />
Reflektor, warmem Licht und zusätzlichem Blendschutz<br />
montiert. Dieselben Strahler mit stärkerer<br />
Leuchtkraft und breit strahlendem Reflektor und zusätzlichem<br />
Staubschutz wurden auch für die indirekt<br />
Beleuchtung des offenen Dachstuhls eingesetzt. Die<br />
Dimmbarkeit der Leuchten ermöglicht eine durchgehend<br />
perfekte Lichtstimmung – vor allem von Beginn<br />
der Abenddämmerung, bis in die Nacht.“<br />
73<br />
HIER HAGELT‘S<br />
SICHERHEIT!<br />
Die unschlagbare Fassadendämmung<br />
mit Carbonschutz.<br />
Licht<br />
Jetzt auch mit<br />
der Hanffaser<br />
als Dämmstoff!<br />
www.capatect.at
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
74<br />
Produkt News<br />
Kreativer Freiraum<br />
Im Office von heute steht nicht mehr nur das klassische Einzelbüro im Fokus, sondern<br />
flexibel nutzbare Zonen gewinnen immer häufiger an Bedeutung. Die herkömmlichen<br />
Arbeitsstrukturen verschwinden nach und nach – das Open Office rückt in<br />
den Vordergrund.<br />
Bei einer guten Büroplanung ist die Mischung zwischen<br />
Funktion und Design dabei enorm wichtig: In<br />
vielen Betrieben und Berufen wird zwar immer noch<br />
auf die altbewerten Büroformen gesetzt, jedoch legen<br />
die ArbeitnehmerInnen immer mehr Wert auf<br />
sozialen Austausch und eine flexible Arbeitswelt. Für<br />
den Spagat zwischen offenen Kommunikationszonen<br />
und Rückzugsorten bietet die Produktpalette von<br />
Selmer in einzelnen Produktfamilien stimmige Weiterentwicklungen.<br />
pads | Loungesystem für<br />
individuelle Raumgestaltung<br />
Ganz neu in der Produktfamilie ist ein Würfel, der sich<br />
ganz beliebig kombinieren lässt. Mit den Polsterelementen<br />
von pads sind moderne Mittelzonen, Warteund<br />
Loungebereiche nicht mehr weg zu denken. In<br />
diesen Bereichen fühlen sich nicht nur Kunden wohl,<br />
auch die MitarbeiterInnen können diese Zonen als<br />
kreativen Freiraum nutzen – entweder in der Gruppe<br />
oder allein.<br />
cellular | Rückzugsort für mehr Konzentration<br />
Das Produkt cellular gibt es jetzt auch als Einzelkabine<br />
mit Polstersessel, Schreibtablar und weiteren Features.<br />
Das ist eine Arbeitsplatzlösung, die besonders<br />
geeignet ist für Großraum und Wartezonen. Mitten<br />
im Trubel entstehen so Nischen für ruhiges Arbeiten.<br />
Die Module können beliebig angeordnet werden, egal<br />
ob im Kreis oder in wechselnder Aufstellung.<br />
Selmer GmbH<br />
T +43 (0)6216 20210<br />
info@selmer.at<br />
www.selmer.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
75<br />
Produkt News<br />
Grill Erlebniswelt<br />
Der neue Weber Original Store in Graz-Seiersberg begeistert mit Restaurant,<br />
Weber Grill Academy und Eventlocation nicht nur Grillfans. Damit das multi-funktionale<br />
Konzept aus Grill Store, Academy, Eventlocation und Hotel in einem Gebäude<br />
funktioniert, erforderte speziell der im ersten Obergeschoss befindliche Seminarund<br />
Eventbereich akustische Maßnahmen.<br />
An der Decke sorgen RIGIPS Rigiton-Lochplatten mit<br />
einer durchlaufenden 8/18 Rundlochung für ein optisch<br />
fugenloses Deckenbild. Die hochwertigen und<br />
akustisch wirksamen Lochplatten sind aus dem umweltfreundlichen<br />
Rohstoff Gips hergestellt und sorgen<br />
mit einer fugenlosen Verlegung für ein einheitliches<br />
architektonisches Deckenbild. Um dem Weber<br />
Design- und Farbkonzept zu entsprechen, wurde<br />
die Akustikdecke abschließend schwarz gestrichen.<br />
Damit ein möglichst einheitliches Deckenbild erzielt<br />
werden konnte, wurde beim Akustikvlies auf<br />
die schwarze Variante zurückgegriffen. Im Hotelbereich<br />
sorgt zudem die Auskleidung mit dem ISOVER<br />
Trennwand-Klemmfilz für ausgezeichneten Schalldämmung,<br />
bietet optimale Wärmedämmung und als<br />
unbrennbares Material ebenso Brandschutz.<br />
Saint-Gobain Austria GmbH<br />
RIGIPS Austria<br />
T +43 (0)3622 505-0<br />
rigips.austria@saint-gobain.com<br />
www.rigips.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
76<br />
Produkt News<br />
Urbane Fassadenbegrünung<br />
Durch dichte Bebauung und wärmespeichernde Beton- und Asphaltflächen kann<br />
die Luft in vielen Großstädten kaum noch zirkulieren und die Temperaturen<br />
steigen. Autoabgase und die Abwärme von Klimaanlagen tragen ebenfalls zur<br />
Aufheizung und Luftverschmutzung bei und Grünflächen und Pflanzen, die diesen<br />
Effekten entgegenwirken, sind Mangelware.<br />
Deshalb geht der Trend weltweit zu grünen Gebäuden<br />
mit Pflanzen an Fassaden, auf Terrassen, Balkonen und<br />
Dächern. Vor allem bepflanzte Fassaden bieten viele<br />
Vorteile: Sie verbessern das Stadtklima durch die Aufnahme<br />
von CO 2 und säubern die Luft von Feinstaubpartikeln<br />
und Schadstoffen. Gleichzeitig produzieren<br />
grüne Fassaden Sauerstoff, gleichen Grünflächenverluste<br />
aus und beleben und verschönern das Stadtbild<br />
für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität.<br />
Dieser Entwicklung begegnet AluKönigStahl mit der<br />
neuen begrünten Fassade Schüco AF UDC 80 Green<br />
Façade. Die Cradle-to-Cradle zertifizierte Elementfassade<br />
bietet hohe Gestaltungsvielfalt mit zahlreichen<br />
Pflanzen und Systembauarten und ermöglicht ein Begrünungssystem<br />
mit besonders großer Blattmasse am<br />
Gebäude. Anders als bei der bodengebundenen Fassadenbegrünung<br />
wachsen Pflanzen in dieser Fassade<br />
selbst, sie benötigt keinen Bodenanschluss und eignet<br />
sich daher besonders für innerstädtische Bereiche. Die<br />
Be- und Entwässerung der Pflanzen erfolgt über ein<br />
integriertes, von außen unsichtbares System.<br />
Gefertigt wird die begrünte Fassade aus nicht brennbaren<br />
Baustoffen der Klasse A, sie überzeugt durch<br />
einen hohen Vorfertigungsgrad für eine einfache und<br />
schnelle Montage: Mit Hilfe einer Unterkonstruktion<br />
werden die bepflanzten Vliesmodule unkompliziert<br />
mit dem Schüco UDC 80 Fassadenelement verbunden<br />
und vor Ort in die Fassade eingehängt. Somit ist<br />
die Fassade direkt nach der Montage bereits vorbegrünt,<br />
sodass lange und pflegeintensive Wuchszeiten<br />
am Gebäude entfallen.<br />
ALUKÖNIGSTAHL GmbH<br />
T +43 (0)1 98130-0<br />
office@alukoenigstahl.com<br />
www.alukoenigstahl.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Neue Farben<br />
im Jubiläumsjahr<br />
Seit 1972 fertigt markilux hochwertige Markisen „Made<br />
in Germany“. In diesem Jahr feiert das Unternehmen<br />
sein 50-jähriges Bestehen und hat sich dafür eine besondere<br />
Aktion ausgedacht: Unter dem Motto „High<br />
Five“ bietet der Markisenexperte fünf neue Gestellfarben<br />
ohne Aufpreis an: Schillernde Namen wie Concept<br />
Black, Space Blue metallic, Fine Green, New Champagne<br />
metallic und Real Silver metallic verkörpern den wertigen<br />
Stil der markilux Produktpalette und betonen das<br />
moderne Markisendesign. Im Jubiläumsjahr <strong>2022</strong> sind<br />
sie für alle Markisen des Herstellers (ausgenommen<br />
markilux 1300) erhältlich.<br />
Zu den fünf Gestellfarben gibt es eine separate Broschüre<br />
und einen kleinen Farbfächer. Außerdem jeweils zwei passende<br />
Tuchempfehlungen aus der „visutex-Kollektion“ in<br />
den Qualitäten „sunsilk“ und „sunvas“.<br />
markilux Vertriebs- und Servicezentrum<br />
T +43 (0)662 852 206<br />
austria@markilux.com<br />
www.salzburg.markilux.at<br />
77<br />
Produkt News
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
78<br />
Produkt News<br />
Höchste Windstabilität<br />
Außenliegende Sonnenschutz-Systeme sind die effektivste Lösung, wenn es um<br />
ein wirtschaftliches Energiemanagement und thermischen Komfort geht. Der<br />
Wärmeeintrag der Sonne wird vor der Verglasung abgewehrt und Innenräume<br />
wirkungsvoll vor Überhitzung geschützt.<br />
Raffstoren bieten darüber hinaus eine flexible Tageslichtnutzung<br />
bei gleichzeitigem Blendschutz, denn<br />
der Einfall des Sonnenlichts kann durch die verstellbaren<br />
Lamellenwinkel individuell gesteuert werden.<br />
In der Architektur haben sich Flachlamellen wegen<br />
ihrer filigranen und zurückhaltenden Optik bewährt.<br />
Dank ihrer vielfältigen Systemvarianten lassen sich<br />
die schlanken Flachlamellen-Anlagen unkompliziert<br />
in jede Konstruktion integrieren und sind daher sowohl<br />
bei Planern wie Bauherren sehr beliebt.<br />
Für hohe Gebäude oder allgemein bei Fassaden in<br />
windexponierten Lagen standen zwar bisher schon<br />
windstabile Lösungen bereit, doch hinsichtlich Tageslichtlenkung<br />
und Ästhetik setzt die neue Windra<br />
Flachlamelle 80 WF von Warema neue Maßstäbe:<br />
Sie verbindet die filigrane Eleganz der Flachlamelle<br />
mit außergewöhnlicher Stabilität und ist die derzeit<br />
windstabilste Flachlamelle am Markt. Das Sonnenschutzsystem<br />
mit Schienen- oder Seilführung wurde<br />
speziell für anspruchsvolle, windexponierte Fassaden<br />
entwickelt und hält Windgeschwindigkeiten bis<br />
zu 25 m/s stand. Mit ihrer filigranen Geometrie und<br />
vier Trendfarben im Standard (RAL 9006, 9007, 7016<br />
und DB 703) sowie einer Vielzahl an Sonderlamellenfarben<br />
bietet die neue Flachlamelle zahlreiche Gestaltungsvarianten<br />
für eine individuelle und ästhetische<br />
Fassadengestaltung.<br />
WAREMA Austria GmbH<br />
T +43 (0)662 853015-0<br />
info@warema.at<br />
www.warema.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Funktionale Einheit<br />
Als eine der ältesten Portland-Zement-Fabriken<br />
in Deutschland und Europa, ist die<br />
1858 erbaute Rohmühle in Bonn ein historisches<br />
und denkmalgeschütztes Gebäude.<br />
Bereits 2006 wurde sie von dem Architekt<br />
Karl-Heinz Schommer umgebaut, um einen<br />
gläsernen Riegel ergänzt und somit etwas<br />
moderner gestaltet. Heute beherbergt der<br />
Komplex Büros sowie eine Gastronomie im<br />
Erdgeschoss, die nun um einen wettergeschützten<br />
Außenbereich auf der ehemaligen<br />
Terrasse erweitert werden sollte. Die<br />
Möglichkeit, den Wintergarten durch eine<br />
Glas-Faltwand zum Gebäude hin komplett<br />
abzutrennen und zum Außenbereich zu<br />
öffnen, wurde dabei mit den Glas-Faltwand-Systemen<br />
Highline und Ecoline von<br />
Solarlux realisiert, die mit einer schlanken<br />
Ansichtsbreite von 99 mm im Flügelstoß<br />
maximale Glasflächen und eine nahezu<br />
transparente Durchsicht bieten. Im Ziehharmonika-Prinzip<br />
lassen sich die Glaselemente<br />
auf einer Gesamtbreite von circa 12<br />
Metern auffalten und als schmales Paket an<br />
der Seite parken.<br />
79<br />
SOLARLUX AUSTRIA GmbH<br />
T +43 (0)512 209 023<br />
info@solarlux.at<br />
www.solarlux.at<br />
Produkt News
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
80<br />
Produkt News<br />
Intelligentes Regenwassermanagement<br />
Mit zunehmenden Niederschlagsstärken steigt auch die Belastung der Entwässerungssysteme,<br />
die für geringere Regenwasserintensitäten dimensioniert sind. Um<br />
ein sicheres Ableiten bzw. Speichern gewährleisten zu können, müssen zusätzliche<br />
Regenwasserrückhalteräume geschaffen werden.<br />
Einfach verfügbar sind hierbei vor allem die Dachflächen:<br />
Sie stellen einen nennenswerten Flächenanteil<br />
im Stadtbereich dar und sind zudem oft durch ihre<br />
bauliche Beschaffenheit zur Nutzung als Retentionsfläche<br />
prädestiniert. So kann beispielsweise auf<br />
0°-Dächern im Tiefgaragenbereich ohne größere<br />
Aufwendungen ein 100-jähriges Regenereignis inklusive<br />
möglicher umliegender Dachflächen zurückgehalten<br />
werden. In die Praxis übertragen bedeutet das,<br />
Wasser-Retentionsboxen, z. B. die WRB von Optigrün,<br />
auf den Dachflächen einzusetzen. Die Retentionsboxen<br />
speichern das Regenwasser und befördern es<br />
über Kapillarsäulen nach oben. Ein kapillarwirksames<br />
Vlies darüber verteilt das Wasser auf der gesamten<br />
WRB-Oberfläche. So hält es auch die darauf ausgebrachte<br />
Substratschicht feucht, die den Pflanzen<br />
als Wurzelbereich dient. Auf diesem Weg steht den<br />
Pflanzen das ursprünglich in den Wasser-Retentionsboxen<br />
gesammelte Regenwasser wieder zur<br />
Verfügung. Bemerkenswert ist, je mehr Regenwasser<br />
den Pflanzen zur Verfügung steht, desto höher<br />
ist ihr Stoffwechsel, der wiederum mehr CO 2 bindet<br />
und das Pflanzenwachstum üppiger ausfallen lässt.<br />
Die Art und Weise, wie das Transpirieren von Pflanzen<br />
mit deren Stoffwechsel verknüpft ist, bringt einen<br />
weiteren positiven Effekt mit sich: die Kühlung<br />
der Städte durch die Verdunstung des gespeicherten<br />
Regenwassers. Für den Verdunstungsvorgang wird<br />
eine hohe Energiemenge benötigt: circa 2.650 Joule<br />
pro Gramm Wasser bei 20 °C. Diese Energie wird<br />
der Umgebung während des Verdunstungsprozesses<br />
entzogen, wodurch sie sich abkühlt.<br />
Optigrün international AG<br />
T +43 (0)1 71728-417<br />
info@optigruen.at<br />
www.optigruen.at<br />
© Optigrün
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Doppelt geschützt<br />
Wer auf der Suche nach der idealen außenliegenden<br />
Beschattung großer Flächen ist, ist mit einer Fenstermarkise<br />
gut aufgehoben. Sie hält die Sonnenstrahlen<br />
bereits außen vom Glas ab und lässt die Hitze erst gar<br />
nicht ans Fenster. So wird der Hitzestau vermieden<br />
und keine Wärme in den Raum hineintransportiert.<br />
Besonders empfiehlt sich hier der ZIP-SOLIDSCREEN<br />
von VALETTA, den es auch als Doppellösung gibt:<br />
Hier wird die senkrechte Fenstermarkise mit einem<br />
separat bedienbaren Insektenschutz kombiniert! So<br />
sind die Bewohner*innen untertags vor der Sonneneinstrahlung<br />
und abends vor unerwünschten Plagegeistern<br />
gut geschützt.<br />
Ob als Auf- oder Unterputz-Variante, mit oder ohne<br />
Dämmung, für große Abmessungen oder mit der<br />
Möglichkeit auf eine distanzierte Ausführung – die<br />
ZIP-FENSTERMARKISE ist ganz nach den individuellen<br />
Anforderungen und Wünschen gestaltbar.<br />
Standardmäßig ist eine Vorbereitung für den Insektenschutz<br />
integriert, sodass jederzeit auch später<br />
nachgerüstet werden kann. Das System ist besonders<br />
regen- und windbeständig: Der Behang ist nicht<br />
nur im Bereich der Welle und des Fallstabs fixiert,<br />
sondern über die gesamte Führungsschienenlänge.<br />
Zusätzlich wird es zur möglichst komfortablen Nut-<br />
81<br />
zung mit einem Funkmotor ausgestattet. Der ZIP und<br />
die Kunststofflaufnut gewährleisten eine sichere Führung<br />
und optimale Spannung des Tuchs. Eine Spezial-Tuchwelle<br />
mit versenktem Tuchschlitz für Schnellwechselkeder<br />
sorgt für eine saubere Tuchwickelung<br />
ohne Druckstellen und einen einfachen Wechsel des<br />
Behangs. Dieser ist zudem durch eine Kassette vor<br />
Nässe und Verschmutzung sicher geschützt.<br />
VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH<br />
T +43 (0)732 38 80-0<br />
office@valetta.at<br />
www.valetta.at<br />
Produkt News<br />
++<br />
BUILD<br />
BEYOND<br />
TOMORROW<br />
Den CO 2<br />
-Fußabdruck eines Gebäudes zu reduzieren, bedeutet für uns,<br />
alle Emissionen zu berücksichtigen, die während des Lebenszyklus<br />
eines Gebäudes entstehen. Um die Emissionen im Vorfeld als auch in<br />
der Nutzungsphase zu reduzieren, bieten wir leistungsstarke, zirkuläre<br />
Lösungen für Fenster, Türen und Fassaden für Gebäude in Städten und<br />
urbanen Gebieten. Wir übernehmen Verantwortung für eine nachhaltigere<br />
Zukunft.<br />
Erfahren Sie mehr auf www.wicona.at<br />
BUILD BEYOND TOMORROW.<br />
Erfahren Sie mehr:
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
82<br />
Produkt News<br />
Eine Fassadenmarkise für alle Fälle<br />
Mit dem Soloscreen IV bringt Griesser eine Fassadenmarkise auf den Markt,<br />
welche dank ihrer Vielseitigkeit und zahlreicher Konfigurationen zu jeder Gegebenheit<br />
und Umgebung passt. Dafür sorgt unter anderem die Farbenvielfalt, denn<br />
nicht nur der Stoff, sondern auch die Box und die Führungen sind in allen erdenklichen<br />
Farben erhältlich.<br />
Die Vielseitigkeit macht den Soloscreen IV zudem<br />
zum idealen Sonnenschutz für verschiedenste Anwendungsbereiche.<br />
Das Design passt zu modernen<br />
Gebäuden mit großen Fenstern ebenso wie auch für<br />
Sanierungen älterer und klassischer Häuser, da die<br />
Montage in der Fensterlaibung erfolgen kann. Weitere<br />
Highlights sind, dass keine Schrauben am Produkt<br />
sichtbar sind und die ClipLine Technologie, mit welcher<br />
der Stoff an der Walze befestigt ist. Sie sorgt für<br />
einen perfekt gespannten Stoff ohne Abdrücke. Dank<br />
verbesserter Windfestigkeit (Windwiderstandsklasse<br />
3) ist für die neue Fassadenmarkise leicht windiges<br />
Wetter kein Problem.<br />
Wie üblich legte Griesser bei der Produktentwicklung<br />
großen Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb ist der<br />
Fallstab nicht mit metallischem Material, sondern mit<br />
Sand gefüllt. Nachhaltig ist auch der Einsatz des Soloscreens<br />
IV. Er steigert thermischen Komfort im Gebäude<br />
und filtert das Tageslicht den Bedürfnissen der<br />
Nutzer entsprechend. Das spart Energie bei der Kühlung,<br />
der Heizung und der Beleuchtung.<br />
Griesser AST GmbH<br />
T +43 (0)5525 64222-0<br />
info@griesser.at<br />
www.griesser.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
83<br />
Produkt News<br />
Mehr Grün<br />
in der Stadt mit der<br />
Elementfassade<br />
Schüco AF UDC 80<br />
Green Façade<br />
Schneller und sicherer<br />
Das stetige Wachstum der städtischen<br />
Bevölkerung bedeutet, dass die Städte<br />
und Gebäude größer, höher und komplexer<br />
werden. Folglich steigt der Druck auf<br />
die Bauindustrie, mit dieser Entwicklung<br />
Schritt zu halten. Beim Bau von Hochhäusern<br />
hängt die Produktivität in hohem<br />
Maße davon ab, dass die ArbeiterInnen<br />
und ihr Material effizient und mit minimalen<br />
Verzögerungen auf den mehrstöckigen<br />
Baustellen eingesetzt werden. Dafür<br />
ist KONE JumpLift, ein selbstkletternder,<br />
zeitsparender Aufzug für den Bau, eine<br />
bewährte Lösung für schnelleres, reibungsloseres,<br />
sichereres und kosteneffizienteres<br />
Bauen.<br />
Herkömmliche Bauaufzüge können nicht<br />
mehr mit der JumpLift-Technologie konkurrieren,<br />
denn die durchschnittliche Geschwindigkeit<br />
eines Bauaufzugs beträgt<br />
nur 1,5 Meter pro Sekunde gegenüber bis<br />
zu 4 Metern pro Sekunde beim JumpLift.<br />
Außerdem ist ein typischer Aufzug oft<br />
außen angebracht, was die Produktion<br />
verlangsamt, da die Außenfassade des<br />
Gebäudes bis zur Fertigstellung nicht<br />
geschlossen werden kann. Der KONE<br />
JumpLift hingegen „springt“ im permanenten<br />
Aufzugsschacht des Gebäudes<br />
hinauf, wenn das Gebäude höher wird. Er<br />
bringt auch Aufzüge in der Bauphase früher<br />
nach oben, bevor der Aufzugsschacht<br />
auf seine endgültige Höhe gebaut ist.<br />
Der CITIC Tower in Peking, bekannt als<br />
China Zun, ist 528 Meter hoch und war<br />
bei seiner Fertigstellung im Jahr 2018 das<br />
höchste Gebäude der Stadt. Nach Angaben<br />
des Eigentümers sparte der Einsatz<br />
der KONE JumpLift-Technologie für den<br />
Transport der 4.000 Arbeitskräfte und ihrer<br />
Werkzeuge auf der Baustelle gewaltige<br />
320.000 Arbeitsstunden.<br />
KONE AG<br />
T +43 (0)592 47000<br />
office.at@kone.com<br />
www.kone.at<br />
alukoenigstahl.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
84<br />
Produkt News<br />
Spannungsreicher Dialog<br />
Wärmedämm-Verbundsysteme sorgen für umweltschonenden Wärmeschutz, verbessern<br />
den energetischen Standard und bieten Langzeitschutz für die Fassade.<br />
Doch nicht nur in puncto Energieeffizienz können sich wärmegedämmte Fassaden<br />
sehen lassen: Wie sich Gebäude durch eine individuell gestaltete Fassade aufwerten<br />
lassen, zeigen unzählige Beispiele – wie etwa die revitalisierte Stadthalle in<br />
Ybbs an der Donau.<br />
Klare Linien und eine reduzierte Architektur prägen<br />
den Bau. Das Gebäude mit seinem großzügigen Balkon<br />
im Obergeschoß entwickelt einen spannungsreichen<br />
Dialog mit dem Fluss. Nichts mehr erinnert an den<br />
biederen Altbau. Im Innern zeichnet sich die Stadthalle<br />
ebenfalls durch die Hinwendung zum Gewässer und<br />
durch ein hohes Maß an Multifunktionalität aus.<br />
Einen besonderen Beitrag zu diesem Projekt leisten<br />
ein hochwertiger Capatect Vollwärmeschutz und<br />
eine umweltfreundliche Synthesa Innenfarbe. Bei der<br />
Wandbeschichtung sämtlicher Innenräume – von der<br />
großen Vortragshalle bis zu den Büros – wurde auf das<br />
Synthesa Produkt Innendispersion extra gesetzt, eine<br />
umweltschonende und lösemittelfreie, mineralmatte<br />
Innenfarbe mit sehr guten Eigenschaften: Die Farbe<br />
ist wasserverdünnbar mit besonders hoher Deckkraft<br />
und weitgehend geruchsfrei. Sie verleiht dem Inneren<br />
der Stadthalle eine unaufdringliche Eleganz, Frische<br />
und das Gefühl von Weite.<br />
Um den nachhaltigen Umgang mit Energie auf Jahre<br />
hinaus zu ermöglichen und die Kosten dafür so niedrig<br />
wie möglich zu halten, erhielten die bestehenden und<br />
neu hinzugekommenen Betonteile der Fassade einen<br />
Rundum-Vollwärmeschutz. Zum Einsatz kam ein<br />
hochwertiges WDVS System mit Capatect D almatiner<br />
Premium Fassadendämmplatten. Die Deckbeschichtung<br />
erfolgte mit Capatect SH-Reibputz 20.<br />
Synthesa Chemie<br />
Gesellschaft m. b. H.<br />
T +43 (0)7262 560-0<br />
office@synthesa.at<br />
www.synthesa.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
85<br />
Produkt News<br />
KOMFORT<br />
& TAGESLICHT<br />
App Farbdesigner<br />
Mit der neuen Smartphone-App Farbdesigner AR bringt Brillux<br />
die Digitalisierung auf der Baustelle noch ein Stück weiter voran.<br />
Konnte man bereits seit Langem mit dem Farbdesigner<br />
verschiedene Gestaltungsoptionen für Räume und Wände<br />
mithilfe von vorgespeicherten Fotos veranschaulichen, bietet<br />
der Farbdesigner AR nun die Möglichkeit, direkt auf der Baustelle<br />
zu visualisieren und zu beraten. Für die Farbberatung<br />
wird mithilfe der Smartphone-Kamera ein Raum oder eine einzelne<br />
Wand gescannt und in der App die gewünschte Wandgestaltung<br />
einfach per Klick ausgewählt. Dafür bietet die App<br />
eine umfangreiche Auswahl an Farbtönen aus dem Farbsystem<br />
Brillux Scala. Um verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten<br />
aufzuzeigen, besteht die Möglichkeit, mehrere Flächen bei<br />
der digitalen Beratung einzubeziehen. Darüber hinaus können<br />
Nutzer/-innen Farbtöne auch direkt miteinander vergleichen.<br />
Brillux Farben GmbH<br />
T +43 (0)732 370740-0<br />
info@brillux.at<br />
www.brillux.at<br />
www.brillux.at/service/software/farbdesigner-ar-app/<br />
Inspired by the Sun.<br />
Gestalten Sie Ihre Fassaden<br />
mit den eleganten und<br />
intelligenten Sonnenschutzprodukten<br />
von Griesser.<br />
Für jedes Projekt die<br />
richtige Lösung<br />
Lassen Sie sich<br />
von uns beraten.<br />
www.griesser.at
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
86<br />
Produkt News<br />
Solar-Kraftwerk am Dach<br />
Auf 1.000 Quadratmeter Dachfläche der neuen Trockenproduktion von Sto in<br />
Villach wird nachhaltiger Photovoltaik-Strom erzeugt, der einen Großteil des<br />
Energiebedarfs des Betriebs deckt. Da diese Form der Energiegewinnung exzellent<br />
in die Sto-Nachhaltigkeitsstrategie „StoClimate“ passt, bekam das neue<br />
Werk in Villach 530 hochmoderne, monokristalline Solarmodule mit einer Leistung<br />
von insgesamt 200 kWp auf das Dach montiert und spart so über 100 Tonnen<br />
CO 2 -Emissionen jährlich ein.<br />
Damit deckt die leistungsstarke Sonnenstromanlage<br />
den Großteil des Energiebedarfs der insgesamt<br />
10.000 Quadratmeter großen Trockenproduktionsanlage,<br />
in der pulverförmige Klebe- und Armierungsmörtel<br />
für die Region Südeuropa vom Band rollen.<br />
Die Photovoltaikanlage in Villach ist bereits die dritte<br />
ihrer Art, die Sto in Österreich auf seinen Gebäuden<br />
installierte. „Als Unternehmen setzen wir seit<br />
Jahrzehnten auf klare ökologische Statements, die<br />
auch ökonomisch Sinn ergeben“, erklärt DI Walter<br />
Wiedenbauer, Geschäftsführer der Sto Ges.m.b.H.<br />
„StoClimate“ heißt die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie<br />
bei Sto, die nicht nur Maßnahmen wie Photovoltaik<br />
am Dach umfasst, sondern sich durch die<br />
gesamte Unternehmensphilosophie zieht.<br />
Mit der neuen Trockenproduktionsanlage stammen<br />
nun 80% des gesamten Sto-Produktsortiments aus<br />
Österreich. „Die kurzen Transportwege sparen rund<br />
2.800 LKW-Ladungen ein, das sind 500 Tonnen CO 2<br />
jährlich“, so Wiedenbauer. 100.000 Tonnen Trockenprodukte<br />
werden jährlich im Werk erzeugt, 20 Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter finden am Produktionsstandort<br />
Villach Beschäftigung. Lieferengpässe – oft<br />
ein Problem in Krisenzeiten – werden durch die lokale<br />
Produktion vermieden. Das gilt auch für die Stromversorgung:<br />
„Photovoltaik am Dach ist nicht nur<br />
nachhaltig, sondern sie macht auch unabhängiger“,<br />
sagt Wiedenbauer.<br />
Sto Ges.m.b.H.<br />
T +43 (0)4242 33 133-0<br />
info.at@sto.com<br />
www.sto.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Ideen mit Zukunft<br />
87<br />
Baumit präsentiert mit der „ALL IN“-Technologie eine<br />
revolutionäre Idee mit Zukunft, bei der die Verpackung<br />
Teil des Endproduktes wird: Der dafür eingesetzte<br />
Sack besteht aus einem speziell hergestellten,<br />
patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung<br />
bei mechanischer Einwirkung und zweitens<br />
einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht. Das<br />
Öffnen des Sacks ist nicht mehr erforderlich und somit<br />
ist die Verarbeitung bequem, sauber, schnell und<br />
ohne Abfall möglich.<br />
Bei der Verarbeitung wird der Sack einfach in den<br />
Betonmischer oder Mörteltrog gegeben, die vorgegebene<br />
Menge Wasser zugefügt, der Papiersack dabei<br />
befeuchtet und dann der Mischvorgang mit Betonmischer<br />
oder elektrischem Rührgerät gestartet. Nach einer<br />
durchschnittlichen Mischdauer von 4 Minuten hat<br />
sich der Papiersack komplett aufgelöst, mit dem Mörtel<br />
vermischt und steht für die Verarbeitung bereit.<br />
Baumit startet in diesem Bereich mit ALL IN TrockenBeton<br />
20 und Baumit ALL IN Garten- und LandschaftsbauBeton.<br />
Die Baumit ALL IN Trockenbetone<br />
sind für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne<br />
statische Anforderungen geeignet; sie sind frostsicher<br />
und widerstandsfähig gegen mechanische<br />
Einwirkungen. Baumit ALL IN Trockenbetone sind<br />
werksgemischte, naturfaserverstärkte Trockenbetone<br />
der Festigkeitsklasse C16/20 i.A.<br />
Produkt News<br />
Baumit GmbH<br />
T +43 (0)501 888-0<br />
www.baumit.com<br />
Andreas Jäger<br />
Klimaexperte<br />
Wann, wenn<br />
nicht jetzt:<br />
Reste verwerten<br />
statt wegwerfen.<br />
Ob Lebensmittel oder Dämmstoffe: Rohstoffe sind zu<br />
schade, um verschwendet zu werden. Deshalb sorgen<br />
wir mit langlebigen, recycelbaren Austrotherm XPS ®<br />
Dämmstoffen für Klimaschutz made in Austria. Das<br />
Prinzip: Was nicht verbaut wird, wird gesammelt und<br />
wandert zurück in die Produktion! Und wenn Sie wollen,<br />
holen wir den Verschnitt sogar direkt bei Ihnen ab.<br />
austrotherm.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
88<br />
Produkt News<br />
Fotos: Meilenstein Kreativagentur<br />
Neuer Stadtbaustein<br />
Den Stadtteil Pasing mit seiner historischen Gründerzeitbebauung im äußeren<br />
Westen Münchens bereichert nun ein Hotel- und Geschäftsneubau nach Plänen<br />
von Auer Weber Architekten. Aus einem geladenen Wettbewerb 2015 gingen das<br />
namhafte Münchner Architekturbüro gemeinsam mit Latz+Partner Landschafts-<br />
Architektur Stadtplanung als Gewinner hervor. Der Entwurf sah einen Neubau in<br />
eindeutig zeitgenössischer Architektursprache und dennoch mit formalem Bezug<br />
zum hier vertretenen gründerzeitlichen Ensemble vor.<br />
Darauf basierend zieht sich der realisierte Baukörper<br />
auf polygonalem Grundriss entlang des Grundstücks<br />
und bildet dabei unterschiedliche Höhen aus, die Bezug<br />
zu den ortstypischen Giebel- und Walmdächern<br />
herstellen. Er umschließt einen begrünten, öffentlichen<br />
Innenhof und erlaubt aufgrund geschickter<br />
Setzung und Durchwegung eine Verbindung zum<br />
Pasinger Stadtpark, den die Würm durchfließt. Die<br />
markante Kubatur und eine monolithisch gestaltete<br />
Gebäudehülle aus hellen GIMA-Klinkerziegeln tragen<br />
deutlich zum veränderten Erscheinungsbild der neuen<br />
urbanen Mitte Pasings bei.<br />
Die monolithische Gebäudehülle aus GIMA Klinkerziegeln<br />
zieht sich über die gesamte straßenzugewandte<br />
Fassade sowie die skulptural ausgebildeten Dachflächen.<br />
Hierfür wurde die gedämmte Massivbaukonstruktion<br />
aus Beton im Bereich der Fassade mit einem<br />
Verblendmauerwerk aus Klinkersteinen umhüllt. Die<br />
24 x 11,5 x 5,2 cm großen Steine sind in der Farbigkeit<br />
Edolo FKS und mit einer authentischen Oberflächenstruktur<br />
ausgeführt. Im Dachbereich bekleiden Klin-<br />
ker derselben Serie und Größe das Gebäude, jedoch<br />
in einer abgetreppten Form. Ausgeführt wurde die<br />
komplexe Dachhülle mithilfe von über 150 Klinkerfertigelementen<br />
in einer Größe von bis zu 3 x 4 Metern<br />
und einer Dicke von 21 cm.<br />
GIMA Girnghuber GmbH<br />
T +49 (0)8732 24-0<br />
info@gima-ziegel.de<br />
www.gima-ziegel.de
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
89<br />
Energie aus<br />
der Fassade<br />
Produkt News<br />
StoVentec Photovoltaics Inlay:<br />
das ästhetisch anspruchsvolle<br />
System für regenerative<br />
Fassadenlösungen.<br />
Schützende Umarmung<br />
Fotos: PREFA | Croce & Wir<br />
Aus Liebe zum Bauen.<br />
Bewusst bauen.<br />
In Catania auf Sizilien wurde ein zeitgemäßer architektonischer<br />
Blickfang mit Prefalz in P.10 Prefaweiß realisiert, dessen<br />
Struktur die Idee einer schützenden Umarmung verkörpert<br />
und als formale Anlehnung an ein sizilianisches Bauernhaus<br />
mit großem Innenhof verstanden werden kann. Bei diesem<br />
Projekt, das vom Architekturbüro FRONTINITERRANA aus<br />
Florenz gestaltet wurde, handelt es sich um WonderLAD – ein<br />
Heim für die psychologische Begleitung und die Betreuung<br />
krebskranker Kinder. Das knappe Budget zwang die Bauherren,<br />
Sachspenden bei Baustoffproduzenten, zum Beispiel von<br />
PREFA Italien, zu organisieren.<br />
Vittorio Frontini und Antonino Terrana von FRONTINITERRANA<br />
stellten sich der Aufgabe, einen einladenden Ort für die Betreuung<br />
schwerkranker Kinder auf nachhaltige Weise und<br />
ohne einen antiseptischen Krankenhauscharakter zu schaffen.<br />
Entstanden ist dabei ein ebenerdiger Holzbau, der eine einprägsame<br />
Aluminiumhülle trägt und mit einem eleganten Einlass<br />
in die schützende Umarmung versehen ist. Der Baukörper<br />
mit vorgezogenem, weißem Dach verfügt über eine Oberfläche<br />
von 8.400 Quadratmetern, öffnet sich zum Innenhof hin<br />
mit langen Fensterbändern und bildet einen Laubengang mit<br />
Stützen, welche an Baumstämme erinnern. Die bis zum Boden<br />
mit Prefa verkleideten Fassaden verfügen über wenige Öffnungen<br />
und geben sich freundlich, aber hermetisch. Darüber<br />
hinaus gibt der begrünte Hof als eine Erweiterung des Innenraums<br />
den Kindern die Möglichkeit, sich das ganze Jahr über<br />
im Freien aufzuhalten.<br />
NEU!<br />
ab 04/<strong>2022</strong><br />
PREFA Aluminiumprodukte GmbH<br />
T +43 (0)2762 502 0<br />
office.at@prefa.com<br />
www.prefa.at<br />
Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade<br />
mit gerahmten Photovoltaikmodulen.<br />
Vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme verbinden<br />
anspruchsvolle Architektur mit den Anforderungen der<br />
Bauphysik. Mit der Integration von Photovoltaik ist es<br />
Sto gelungen, eine funktionale Fassade zu entwickeln.<br />
Sto unterstützt mit diesem System, im Sinne des Europäischen<br />
Green Deals, den Übergang zu modernen,<br />
ressourcenschonenden und wirtschaftlichen Gebäuden.
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
90<br />
Produkt News<br />
Anlehnung an Original-Optik<br />
Ein tristes Bild bot das Gründerzeithaus in der Wiener Nymphengasse an der Ecke<br />
zum kleinen Park, der ans Areal des Theresienbades anschließt. Eine Revitalisierung<br />
im großen Stil wurde unternommen, um hier sowohl angemessene Wohnqualität<br />
als auch eine optische Trendumkehr zu erreichen. Nun verbindet der Bau vom<br />
Keller bis hinauf zum neu ausgebauten Dachgeschoß den Charme der Gründerzeit<br />
mit Facetten der Moderne.<br />
Um das Erscheinungsbild wieder stimmig zu machen,<br />
mussten dafür im Sinne des Gründerzeitstils viele<br />
Anpassungen vorgenommen werden: Frühere Sanierungen<br />
hatten die Fassade unausgewogen und mit<br />
Fehlstellen hinterlassen – nun mussten Profile und<br />
Zierelemente wieder vereinheitlicht werden.<br />
Bei der Realisierung dieses Projekts wurde auf Produkte<br />
von Austrotherm gesetzt: Die Außenmauern<br />
erhielten eine thermische Sanierung mit dem grauen<br />
Austrotherm EPS® F-PLUS, eine Fassadendämmung<br />
mit verbesserter Dämmwirkung. Und für die historische<br />
Optik wurde die Fassade mit Austrotherm Fassadenprofilen<br />
ausgestattet – von der Fensterrahmung<br />
über die Bossenfassade bis hin zu speziell angefertigten<br />
schmückenden Elementen. Besondere Sorgfalt<br />
ließ man bei den auskragenden Erkern walten. Ihre<br />
Untersichten, die im Original aufwändig verziert gewesen<br />
waren, wurden entsprechend nachgebildet.<br />
Die Ornamente dafür entstanden im Austrotherm<br />
Werk Pinkafeld im Gussverfahren. Vor Ort fügte man<br />
dann die einzelnen Teile zusammen. Auch die Sockelprofile<br />
wurden speziell angefertigt: Ähnlich einer Kirche<br />
verfügt das Gebäude über eine hervorspringende<br />
Basis – bei Gründerzeitbauten eine Besonderheit. In<br />
den Kellern wurden durch Absenken des Hofniveaus<br />
auf Kellerebene und mit Trockenlegungs- und Dämmmaßnahmen<br />
zusätzliche Garten-Maisonettewohnungen<br />
geschaffen.<br />
Austrotherm GmbH<br />
T +43 (0)2633 401-0<br />
fassadenprofile@austrotherm.at<br />
www.austrotherm.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
91<br />
Produkt News<br />
Tradition trifft auf Moderne<br />
Im Zuge der Erweiterung des Weinguts des Wachauer Winzers<br />
Franz-Josef Gritsch entstand nach dem Entwurf von Architekt<br />
Hannes Ritzinger ein neues Gebäude für Weinverkostung<br />
und -verkauf samt Tiefgarage. Bei der Herstellung des Unterbaus<br />
des unmittelbar an den Bestand anschließenden neuen<br />
Gebäudes trat unterhalb des Flaschenlagers eine Quelle zum<br />
Vorschein, wofür die Experten des ausführenden Bauunternehmens<br />
Franz Schütz eine optimale Problemlösung fanden.<br />
Nachdem die Unterfangungen bzw. das bestehende Steinfundament<br />
gründlich gereinigt waren, wurde als Dichtungs- und<br />
Putzträger gegen die Feuchtigkeit bzw. eindringendes Wasser<br />
webertec Sperrputz 934 zweilagig aufgetragen. Dieses Produkt<br />
wurde speziell zur Abdichtung bei Bodenfeuchte bzw.<br />
bei nicht drückendem Wasser entwickelt und ist zudem sehr<br />
vielseitig einsetzbar z.B. als Dichtungsträger für Abdichtungen<br />
mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen,<br />
bei flexiblen und starren Dichtungsschlämmen sowie als<br />
Egalisierungsmörtel und Sockelputz. Abschließend wurde mit<br />
webertec Superfläche D24 die umlaufende vertikale Abdichtung<br />
der Tiefgarage hergestellt. Die bitumenfreie Reaktivabdichtung<br />
ist hochflexibel, reaktiv- und schnell abbindend.<br />
Saint-Gobain Austria GmbH<br />
WEBER Terranova Austria<br />
T +43 (0)1 661500<br />
www.weber-terranova.at<br />
Fotos: Franz Schütz GmbH<br />
grenzen<br />
los<br />
planen.<br />
Individuelle Steine nach Ihren Ideen.<br />
PARTNER FÜR OBJEKTGESTALTER<br />
Mit dem umfassenden Standardsortiment und individuellen<br />
Sonderproduktionen bei Farben und Formaten eröffnen Friedl<br />
Steinwerke neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Dachterrassen,<br />
Balkonen und Plätzen. Wir stehen für Beratung und Bemusterung<br />
gerne bereit: anfrage@steinwerke.at<br />
www.steinwerke.at<br />
Projekt Liv an der Alten Donau<br />
© liv.at / Fotograf: nunofoto.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
92<br />
Produkt News<br />
© Katja Bidovec<br />
Ein Teil<br />
ausgezeichneter<br />
Architektur<br />
Im Nordosten der slowenischen Stadt Šentjernej wurde das Gewerbegebiet<br />
„Eltas“ um 6.000 m 2 erweitert. Das neu errichtete Objekt – ausgezeichnet mit dem<br />
BigSEE-Award 2020 – folgt sowohl in der optischen Erscheinung als auch in der<br />
Funktionalität im Innenbereich einem strengen Designkonzept.<br />
Eine funktionelle Produktionsstätte für elektronische<br />
Bauteile schließt an ein zweistöckiges Betriebsgebäude<br />
an, in dem Büros und Gemeinschaftsräume untergebracht<br />
sind. Ziel der Architekten war es, im Inneren<br />
dieses Objekts ein Wohlfühlambiente zu schaffen.<br />
Warme Farbtöne und natürliches Holz in edler Verarbeitung<br />
sollten für die Mitarbeiter und Besucher ein<br />
wohliges Raumklima schaffen.<br />
Der Fokus auf Wärme spiegelt sich auch außen wider.<br />
Um dies zu erreichen, wurden für das zweistöckige<br />
Hauptgebäude für die Fassadengestaltung die Metallelemente<br />
von DOMICO im Farbton Sand-Gold gewählt,<br />
was das Gebäude und die Silhouette des Neubaus<br />
noch mehr erstrahlen lässt. Im Gegensatz zu<br />
diesem Gebäudeteil ist das Produktionsareal sowohl<br />
innen als auch außen kühl und streng strukturiert. Die<br />
Architekten wählten dafür einen Mix aus unterschiedlichen<br />
Breiten, mit dem Dynamik zum Ausdruck gebracht<br />
werden soll. Die Metallelemente in Sand-Gold<br />
wurden senkrecht montiert, die dunklen, vertikal verlaufenden<br />
Fugen nehmen die Farbe der Fenster auf<br />
und bilden ein optisch auffallendes Design, das das<br />
Gebäude umklammert.<br />
DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG<br />
T +43 (0)7682 2671-0<br />
office@domico.at<br />
www.domico.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
93<br />
Produkt News<br />
Safety first<br />
Jeden Tag nimmt der Informationsfluss<br />
mehr an Fahrt auf und die neuen digitalen<br />
Möglichkeiten bringen dementsprechenden<br />
Traffic mit sich. Die Tage von<br />
Excel-Listen sind längst gezählt, Ordner<br />
werden hauptsächlich digital befüllt. 5000<br />
Postein- und Postausgänge für ein mittelgroßes<br />
Bauvorhaben sind die Regel. Den<br />
Überblick zu behalten, ist da gar nicht so<br />
leicht. Außer man hat die passenden technischen<br />
Hilfsmittel.<br />
„Architekten und Ingenieure leben vor allem<br />
vom Planen, nicht vom Büromanagement.<br />
Und doch ist es für den wirtschaftli-<br />
chen Erfolg eines Büros essenziell“, betont<br />
untermStrich-Geschäftsführer Guido R.<br />
Strohecker. Die Digitalisierung der Baustelle,<br />
Zeiterfassung, Projektkalkulation, Kommunikationsprozesse<br />
mit Auftraggebern,<br />
E-Rechnung & Co – alles das stellt Architekten<br />
und Ingenieure vor neue Herausforderungen.<br />
Lösungen bietet Software, die<br />
genau diese Prozesse bis auf einen simplen<br />
Mausklick vereinfachen.<br />
Eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit<br />
man seine technischen Tools zu 100<br />
Prozent effizient einsetzen kann, ist die<br />
Sicherheit beim Datenaustausch. Wie entscheidend<br />
ist die IT, wie wichtig der richtige<br />
Umgang mit seiner Managementsoftware?<br />
Und was sind die wichtigsten Punkte beim<br />
Safety-Check für ein Planungsbüro? Bei<br />
der mittenDrin LIVE – der digitalen Messe<br />
von untermStrich, die sich aus der MESSE@<br />
home entwickelt hat und nun der digitale<br />
Hotspot für alle Managementthemen von<br />
Planungsbüros wird – gibt es die Antworten.<br />
untermStrich software GmbH<br />
T +43 (0)3862 58106-0<br />
office@untermstrich.com<br />
www.untermstrich.com<br />
EINE SOFTWARE -<br />
FÜR IHRE<br />
BAUVORHABEN<br />
GESCHNEIDERT!<br />
FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE<br />
PASSENDE SOFTWARELÖSUNG!<br />
Modular. Anpassbar. Perfekt kombiniert.<br />
PROJEKTMANAGEMENT<br />
OpenBIM | Kostenmanagement<br />
Besprechungswesen | Dokumente<br />
BauKG | SiGe-Plan<br />
BÜROORGANISATION<br />
Rechnungswesen | Bürokosten<br />
Honorare | (Mobile) Zeiterfassung<br />
Ressourcenplanung<br />
AVA-AUFTRAGGEBER<br />
Ausschreibung | Preisspiegel<br />
Bestbieterermittlung | Vergabe<br />
Abrechnungskontrolle<br />
BAUDATEN<br />
Ausschreibungstexte | Preisdateien<br />
(BIM-)Elementkataloge<br />
Kalkulationsdaten | Konvertierungen<br />
Seit über 40 Jahren Ihr verlässlicher Partner! | www.abk.at | www.baudaten.info
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
94<br />
edv<br />
KI am Bau:<br />
Maschinell planen und bauen<br />
Neben der Digitalisierung und der BIM-Planungsmethode bestimmt<br />
zunehmend die KI das Planen, Bauen und Nutzen von Bauwerken. Welche<br />
Lösungen und Entwicklungen gibt es derzeit?<br />
Text: Marian Behaneck<br />
Neben der Digitalisierung und BIM beeinflusst<br />
zunehmend auch die Künstliche<br />
Intelligenz (KI) den Bausektor. Das ist ein<br />
Teilgebiet der Informatik, das sich mit der<br />
Erforschung intelligenten Verhaltens und<br />
maschinellen Lernens, aber auch der praktischen<br />
Anwendung von Systemen befasst,<br />
die menschliche Fähigkeiten wie logisches<br />
Denken, Lernen, Planen und Kreativität<br />
nachahmen können. Welche aktuellen Anwendungen<br />
und Entwicklungen gibt es bereits,<br />
welche Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen<br />
entstehen dadurch?<br />
KI fürs Planen<br />
Bestandserfassung: Bei der Bestandserfassung<br />
per 3D-Laserscanner müssen Millionen<br />
von Messpunktdaten ausgewertet<br />
und so strukturiert werden, dass sie für die<br />
CAD- und BIM-Planung verwertbar sind.<br />
KI-basierende Analysemethoden liefern dabei<br />
Informationen über die Art des Bauteils,<br />
z.B. Wand, Stütze, Decke, Fenster, Rohrleitung,<br />
verknüpfen sie mit weiteren Daten –<br />
etwa zu Materialien oder Bauschäden – und<br />
generieren aus diesen Informationen ein<br />
BIM-Modell. Andere KI-Projekte befassen<br />
sich mit der Vermessung von Räumen und<br />
Objekten mithilfe von Apps, die auf die besonderen<br />
Fähigkeiten aktueller Smartphone-Kameras<br />
zurückgreifen und aus den<br />
erfassten Messwerten selbstständig ein<br />
3D-Modell berechnen. (Beispiele: www.actimage.de,<br />
www.aurivus.com, www.bimkit.eu)<br />
Generative Gestaltung: (auch „Generatives<br />
Design“) Regelbasierte Prozesse,<br />
anwenderdefinierte Parameter und Verknüpfungen<br />
bestimmen bei der generativen<br />
Gestaltung das Entwurfsergebnis.<br />
Das ermöglicht eine mit konventionellen<br />
CAD-Planungsmethoden bisher nicht erzielbare<br />
Form- und Gestaltungsfreiheit.<br />
Die Künstliche Intelligenz (KI) gehört auch im Baubereich<br />
zu den Schlüsseltechnologien der nächsten Jahre. © Bosch<br />
So können beispielsweise von der Natur<br />
inspirierte, bionische Formen einfacher<br />
geplant und über CNC-Maschinen oder<br />
3D-Drucker auch direkt gefertigt werden.<br />
Verknüpft man die generative Gestaltung<br />
mit KI- Algorithmen, können auch komplexe<br />
Entwurfsvorgaben berücksichtigt und etwa<br />
Grundrisskonzepte unter Berücksichtigung<br />
von Raumfunktionen, Raumbeziehungen,<br />
Raumqualitäten etc. entwickelt werden<br />
(Beispiele: https://redshift.autodesk.de/generatives-design-ki)<br />
Stadtplanung: Insbesondere in der Stadtplanung<br />
fließt eine Vielzahl von Entwurfskriterien<br />
und -parameter in die Entwurfsüberlegungen<br />
mit ein – wie etwa<br />
das städtebauliche Umfeld, Klima-, Wind-,<br />
Lärm- oder Belichtungsverhältnisse, soziologische<br />
Rahmendaten etc. Auch KI-Algorithmen<br />
basierende Software-Lösungen<br />
wie beispielsweise Spacemaker versprechen<br />
eine schnellere Generierung von Entwurfsalternativen,<br />
unter Berücksichtigung<br />
aller relevanten Einflussfaktoren. So kann<br />
das individuelle Potenzial eines Standortes<br />
optimal ausgereizt und die bestmögliche<br />
Lösung gefunden werden, etwa die optimale<br />
Bebauung eines Grundstücks unter<br />
Beachtung baurechtlicher Vorgaben und<br />
qualitativer Parameter, wie Besonnung,<br />
Lärm etc. (Beispiele: www.spacemakerai.<br />
com, www.propertymax.de)
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
95<br />
edv<br />
BIM-Modellkontrolle: Während der BIM-<br />
Planung müssen Fachmodelle überprüft<br />
werden, ob sie mit Entwurfsvorgaben,<br />
baurechtlichen Vorgaben oder Richtlinien<br />
übereinstimmen. Werden sie zu einem Koordinationsmodell<br />
zusammengeführt, müssen<br />
sie gewerkübergreifend auf Kollisionen<br />
überprüft werden. Das geschieht entweder<br />
manuell oder (halb-)automatisch. Automatisierte<br />
Modellprüfungen, die auf einer großen<br />
Wissensdatenbank und lernfähigen Algorithmen<br />
basieren, sind in der Lage, auch<br />
komplexe Zusammenhänge zu überprüfen,<br />
beschleunigen dadurch Abläufe und entlasten<br />
Planer oder Behörden. KI unterstützt<br />
auch digitale Bauanträge, indem diese beispielsweise<br />
auf die Einhaltung wesentlicher<br />
gesetzlicher Vorschriften, wie Mindestabstände<br />
etc. überprüft werden. (Beispiele:<br />
www.tuvsued.com, www.contilio.com)<br />
KI fürs Bauen<br />
Baustellenerfassung: Will man den Ist-<br />
Stand, Abläufe oder Ausführungsqualitäten<br />
auf der Baustelle effizient kontrollieren,<br />
müssen Baustellendaten digital erfasst<br />
werden – beispielsweise indem Fotos oder<br />
Videos von Baustellen-Kameras, Mobilge-<br />
Die auf KI-gestützte generative Gestaltung kann Entwurfsalternativen generieren<br />
und diese auch bewerten. © Autodesk<br />
räten, 3D-Scannern, Drohnen, Robotern<br />
oder Helmkameras über KI-Algorithmen<br />
interpretiert und analysiert werden. Dabei<br />
werden Bauobjekte und deren Eigenschaften<br />
automatisiert erkannt und die<br />
Ergebnisse mit dem BIM-Ausführungsmodell<br />
abgeglichen. So entsteht ein digitales<br />
Abbild des aktuellen Bauzustands, das die<br />
Abrechnung vereinfacht oder den Baufortschritt,<br />
potenzielle Planungsabweichungen,<br />
Fehler oder Schäden dokumentiert.<br />
Mit den dabei gewonnenen Informationen<br />
lassen sich auch künftige Bauprojekte<br />
optimieren. (Beispiele: www.buildots.com,<br />
www.eskimo-projekt.de, www.tuvsued.com,<br />
www.contilio.com)<br />
das Organisations- und Führungstool<br />
der Architekten und Ingenieure<br />
untermStrich® X3 – wir.wissen.warum.<br />
„Die unternehmerische Komponente hat man als Architekt nicht von Beginn an.<br />
Das ist auch nicht so schlimm, solange man nur rechtzeitig erkennt, das einem hier die<br />
Fähigkeiten fehlen und man sich Hilfe holt. untermStrich bietet genau das.“<br />
Zitat von Arch. Dipl.-Ing. Christian Story<br />
untermStrich® software GmbH,<br />
Mittergasse 11 - 15, A-8600 Bruck/Mur<br />
Unter den Linden 10, D-10117 Berlin<br />
Königsallee 27, D-40212 Düsseldorf<br />
Riegler Riewe<br />
Architekten ZT Ges.m.b.H<br />
T. +43 3862 58106<br />
untermstrich.com
<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />
96<br />
edv<br />
Bauablaufsimulation: Simulationen der<br />
Bau- und Montageablaufplanung können<br />
– unter Berücksichtigung von Erfahrungen<br />
aus vorangegangenen Projekten, Mängelund<br />
Bautagesberichten oder Logistikdaten<br />
– dabei helfen, Bau- und Montageprozesse<br />
zu optimieren. KI-gestützte Risikovorhersagen<br />
ermöglichen darüber hinaus reibungslosere<br />
Baustellenabläufe. Diese bedienen<br />
sich smarter Techniken zur Datenanalyse,<br />
der datenbasierenden Ergebnisvorhersage<br />
oder maschinellen Lernsystemen. Dabei<br />
werden aktuelle und historische Fakten<br />
analysiert, um Vorhersagen über zukünftige<br />
Ereignisse treffen zu können. Wird die<br />
zunehmende Anzahl digital geplanter und<br />
kontrollierter Bauprojekte miteinander vernetzt,<br />
lässt sich die Verlässlichkeit von Risikovorhersagen<br />
steigern (Beispiele: www.<br />
autodesk.com/bim-360, https://pasc.ai).<br />
Baurobotik: Ob bei der Produktion von Baustoffen,<br />
der Bewehrung von Betonbauteilen,<br />
der Montage von Schalelementen, Holzständer-<br />
oder Fachwerkkonstruktionen –<br />
Roboter sind in der Bauindustrie längst im<br />
Einsatz. Auch auf die Baustelle drängen<br />
sie inzwischen – in Form von Mauer- und<br />
Bohrrobotern oder 3D-Druckern, die auf<br />
der Grundlage von 3D-CAD- oder BIM-Daten<br />
Arbeiten ausführen, entweder autonom<br />
oder per Fernbedienung unterstützt.<br />
Bohrroboter beispielsweise orientieren sich<br />
selbständig im Raum und bohren Löcher<br />
für Montage- und Installationsarbeiten,<br />
was körperlich schwere Überkopf-Arbeiten<br />
erübrigt. Um noch komplexere Tätigkeiten<br />
autark ausführen und unvorhergesehene<br />
Situationen auf der Baustelle meistern zu<br />
können, müssen Roboter lernfähig sein und<br />
über viele Sensoren verfügen, deren Daten<br />
vernetzt und KI-gestützt in Echtzeit ausgewertet<br />
werden. (Beispiele: www.baubot.<br />
com, www.bostondynamics.com, www.hilti.<br />
de, www.peri.de, www.trimble.com)<br />
Bauprozessoptimierung: Planungs- und<br />
Bauprozesse hinken technologisch industriellen<br />
Prozessen hinterher. Das Planen<br />
und Bauen mithilfe aktueller Technologien<br />
wie BIM, IoT, KI oder Big Data moderner<br />
und wettbewerbsfähiger zu machen, haben<br />
sich mehrere Forschungsprojekte zum Ziel<br />
gesetzt. Smart Design and Construction<br />
(SDaC) zum Beispiel soll die Grundlage für<br />
die Transformation der Bauindustrie schaffen,<br />
die ein transparenteres, proaktiveres<br />
und kooperativeres Bauen ermöglicht.<br />
Dazu werden Metadaten aus Bauprojekten<br />
unternehmensübergreifend verknüpft und<br />
miteinander verglichen, was verlässliche<br />
Prognosen ermöglichen soll. Auch das Projekt<br />
ESKIMO soll die Überwachung der Bauausführung<br />
mit einer intelligenten Interpretation<br />
der Ist-Situation auf der Baustelle<br />
optimieren. Dabei werden Fotos mobiler<br />
Kameras analysiert und für das Baumanagement<br />
genutzt. (Beispiele: www.sdac.<br />
tech, www.eskimo-projekt.de)<br />
KI fürs Nutzen<br />
Smart Home: KI macht das smarte Heim<br />
noch smarter: Neben der Kommunikation<br />
per Spracheingabe kann das KI-gestützte<br />
Smart Home über Machine-Learning-Algorithmen<br />
aus den Gewohnheiten der Bewohner<br />
Rückschlüsse ziehen und dadurch<br />
Auch komplexe Entwurfsvorgaben, etwa in der Stadtplanung, können<br />
berücksichtigt und Lösungen selbständig entwickelt werden.<br />
© Spacemaker, Autodesk<br />
KI und Big Data können auch die Projekt- und Qualitätskontrolle oder<br />
das Projektmanagement effizient unterstützen. © Autodesk
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
97<br />
edv<br />
Bauroboter können beispielsweise Überkopfarbeiten weitgehend<br />
autark ausführen. © Hilti<br />
KI-basierende Video-Branddetektionssysteme melden Flammen oder<br />
Rauch schnell und zuverlässig und verbessern die Gebäudesicherheit.<br />
© Bosch<br />
den Wohnkomfort erhöhen oder den Energieverbrauch<br />
optimieren. Für mehr Sicherheit<br />
sorgt die maschinelle Gebäudeüberwachung.<br />
Werden Video- oder Infrarotkameras<br />
miteinander vernetzt und über KI-gestützte<br />
Systeme ausgewertet, lassen sich Zutrittskontrollen,<br />
der Brandschutz oder die<br />
Gebäudeüberwachung verbessern. Mit KI<br />
gestützten Sprachassistenten wie Amazon<br />
Echo, Apple Siri oder Google Assistant können<br />
vom Fernseher über die Lichtsteuerung<br />
bis zur Heizung alle technischen Systeme<br />
im Haus gesteuert werden. (www.amazon.<br />
com, www.apple.com, www.google.com)<br />
Vorausschauende Wartung: Im Gegensatz<br />
zur herkömmlichen reaktiven Wartung,<br />
die erst nach Störungen eingreift, bietet<br />
die vorausschauende Wartung (Predictive<br />
Maintenance) gebäudetechnischer Komponenten<br />
Vorteile: Ungeplante Ausfälle<br />
technischer Bauteile werden vermieden,<br />
Servicetermine und die Anlagen-Wirtschaftlichkeit<br />
werden optimiert, Wartungstermine<br />
und die Ersatzteil-Vorhaltung sind<br />
besser planbar. Dazu erfassen IoT-Bauteilsensoren<br />
(Internet der Dinge) Betriebs- und<br />
Zustandsdaten, die zentral mit Hilfe intelligenter<br />
Algorithmen ausgewertet werden.<br />
Anhand der Nutzungsmuster und anderer<br />
Parameter lässt sich automatisch der optimale<br />
Zeitpunkt für Wartungsmaßnahmen<br />
ableiten. (Beispiele: www.techem.com, www.<br />
tuvsud.com)<br />
Gebäudeüberwachung: Die maschinelle<br />
Bildauswertung erweitert die Möglichkeiten<br />
visueller Überwachung. Werden mehrere<br />
Video- oder Infrarotkameras miteinander<br />
vernetzt und über KI-gestützte Systeme<br />
ausgewertet, ist eine effiziente Rund-umdie-Uhr-Überwachung<br />
von Gebäuden, Anlagen<br />
oder Baustellen möglich. Als Basis dienen<br />
Daten aus Überwachungskameras und<br />
ein IP-basiertes Videomanagement-System,<br />
das auch sehr viele und hochauflösende<br />
Videodaten in digital verwertbare Informationen<br />
umwandelt und eine maschinelle<br />
Auswertung ermöglicht. Über eine Gesichtserkennung<br />
können Zugänge kontrolliert und<br />
die Sicherheit verbessert werden. Visuelle<br />
Kameras und Infrarotkameras ermöglichen<br />
einen wirksamen Brandschutz. (Beispiele:<br />
www.boschbuildingsolutions.com)<br />
Chancen und Risiken<br />
KI & Co. ist längst Teil des Planens, Bauens<br />
und Nutzens – oder wird es gerade. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
sind vielfältig und in ihren<br />
Potenzialen noch kaum zu überblicken.<br />
Viele KI-Systeme setzen als Datenbasis<br />
allerdings große Datenmengen (Big Data)<br />
voraus, anhand derer sie ihre Algorithmen,<br />
etwa zur Mustererkennung, trainieren und<br />
optimieren können. Das können Planungsund<br />
Ausschreibungsdaten, Stücklisten, Aufmaßdaten,<br />
Baustellendaten, Fotos, Mängellisten<br />
oder Sensordaten sein. Werden diese<br />
Daten kombiniert und ausgewertet, können<br />
sie neben der Planung und Bauausführung<br />
auch den Gebäudebetrieb optimieren. Je<br />
größer die Datenbasis ist, umso zuverlässiger<br />
arbeiten KI-Systeme. Welche Quantität<br />
und Qualität diese Daten haben, wie diese<br />
verknüpft und welche Bewertungs- und<br />
Entscheidungskriterien herangezogen werden<br />
– etwa bei der maschinellen Bewertung<br />
und Auswahl von Entwurfsvarianten – ist<br />
aber meist nicht nachvollziebar. Kritiker<br />
warnen deshalb vor blindem Vertrauen in<br />
KI, Big Data und den häufig intransparenten<br />
Prozessen, die dahinterstecken.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
98<br />
edv<br />
Archicad Webinare<br />
Der BIM-Planungssoftware-Hersteller GRAPHISOFT vermittelt in seinen hochinformativen<br />
Archicad-Webinaren „Mengen und Kosten“ sowie „Architektur und<br />
Haustechnik“ umfassendes Fachwissen leicht und verständlich.<br />
In aktuell vierzehn Webinaren zum Thema<br />
„Mengen und Kosten“ werden die wichtigsten<br />
Fragen im Bereich Ausschreibung, Vergabe<br />
und Abrechnung bei der Zusammenarbeit<br />
mit Archicad beleuchtet. Vor dem<br />
Hintergrund, dass viele Architekturbüros im<br />
Rahmen der BIM-Planung umfassend und<br />
detailliert im Projekt Massen und Mengen<br />
selbst ermitteln, zeigen die Webinare optimale<br />
Prozess-Schritte und geben wertvolle<br />
Tipps für eine verlässliche wie exakte Kostenschätzung<br />
oder Kostenermittlung. Anhand<br />
eines BIM-Beispielprojekts werden die<br />
Schnittstellen zwischen den Softwarelösungen<br />
erläutert und potenzielle Fehlerpunkte<br />
angesprochen. Da Archicad 25 dank eines<br />
neuen Features ermöglicht, Einzelschichten<br />
aus den Bauteilen korrekt auszulesen, wird<br />
die Massen- und Mengenermittlung damit<br />
noch exakter. Für die mehrschichtigen Bauteile<br />
Wände, Decken und Dächer berechnet<br />
die Software jede Schicht im Bauteil separat<br />
und mit drei Werten: Brutto, Netto sowie<br />
Konditional. So lassen sich für jede Schicht<br />
die benötigten Werte in den verschiedenen<br />
Leistungsphasen normgerecht nach der<br />
VOB (Deutschland) bzw. nach Werkvertragsnorm<br />
(Österreich) ermitteln.<br />
In vier weiteren Webinaren steht die integrale<br />
Zusammenarbeit von Architektur- und<br />
Haustechnikplanung im Fokus. Die frühe<br />
Abstimmung der zwei Planungsdisziplinen<br />
am Gebäudemodell ist enorm wichtig. Wie<br />
der ideale Workflow zwischen der Architekturplanung<br />
und Hautechnikplanung aussieht,<br />
zeigen die Webinare eindrucksvoll.<br />
Die Webinare stehen unter folgendem Link<br />
kostenlos zum Anschauen zur Verfügung:<br />
https://openbim.graphisoft.de/bim-webinare<br />
GRAPHISOFT Deutschland GmbH<br />
Vertrieb Österreich<br />
mail@graphisoft.at<br />
www.archicad.at
Versalzen Ihnen Streuverluste<br />
den Erfolg Ihrer Werbeplanung?<br />
Bei uns erreichen Sie die, auf die es ankommt: 91 % aller<br />
Entscheider informieren sich in Fachmedien über Innovationen<br />
und Branchen-Trends. Die Mitglieder des ÖZV bieten damit<br />
Entscheidern wertvolle Informationen und Ihrer Marke ein<br />
effizientes Werbeumfeld.<br />
dubistwasduliest.at/oezv<br />
DU BIST,<br />
WAS DU<br />
LIEST.
PADS<br />
Hier passt alles<br />
zusammen.<br />
selmer.at<br />
Exklusiver Partner der Brunner Group