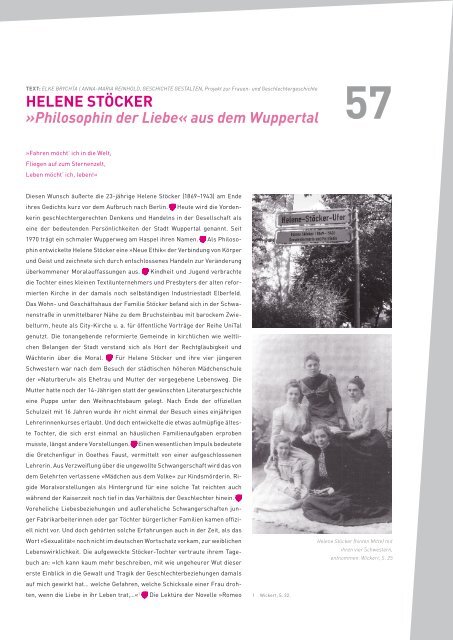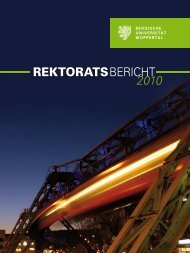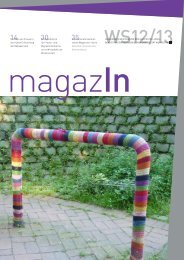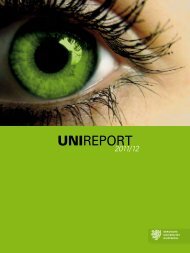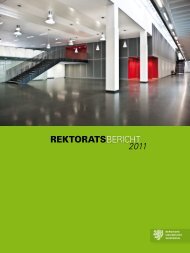FAMILIENBANDE TEIL 2 UNI MIT ... KIND(ER)LEICHT GEMACHT ...
FAMILIENBANDE TEIL 2 UNI MIT ... KIND(ER)LEICHT GEMACHT ...
FAMILIENBANDE TEIL 2 UNI MIT ... KIND(ER)LEICHT GEMACHT ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TEXT: ELKE BryChTa | aNNa-marIa rEINhOLD, GESChIChTE GESTaLTEN, Projekt zur Frauen- und Geschlechtergeschichte<br />
HELENE STöCK<strong>ER</strong><br />
»Philosophin der Liebe« aus dem Wuppertal<br />
»Fahren möcht’ ich in die Welt,<br />
Fliegen auf zum Sternenzelt,<br />
Leben möcht’ ich, leben!«<br />
Diesen Wunsch äußerte die 23-jährige Helene Stöcker (1869–1943) am Ende<br />
ihres Gedichts kurz vor dem Aufbruch nach Berlin. L Heute wird die Vordenkerin<br />
geschlechtergerechten Denkens und Handelns in der Gesellschaft als<br />
eine der bedeutenden Persönlichkeiten der Stadt Wuppertal genannt. Seit<br />
1970 trägt ein schmaler Wupperweg am Haspel ihren Namen. L Als Philosophin<br />
entwickelte Helene Stöcker eine »Neue Ethik« der Verbindung von Körper<br />
und Geist und zeichnete sich durch entschlossenes Handeln zur Veränderung<br />
überkommener Moralauffassungen aus. L Kindheit und Jugend verbrachte<br />
die Tochter eines kleinen Textilunternehmers und Presbyters der alten reformierten<br />
Kirche in der damals noch selbständigen Industriestadt Elberfeld.<br />
Das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Stöcker befand sich in der Schwanenstraße<br />
in unmittelbarer Nähe zu dem Bruchsteinbau mit barockem Zwiebelturm,<br />
heute als City-Kirche u. a. für öffentliche Vorträge der Reihe UniTal<br />
genutzt. Die tonangebende reformierte Gemeinde in kirchlichen wie weltlichen<br />
Belangen der Stadt verstand sich als Hort der Rechtgläubigkeit und<br />
Wächterin über die Moral. L Für Helene Stöcker und ihre vier jüngeren<br />
Schwestern war nach dem Besuch der städtischen höheren Mädchenschule<br />
der »Naturberuf« als Ehefrau und Mutter der vorgegebene Lebensweg. Die<br />
Mutter hatte noch der 14-Jährigen statt der gewünschten Literaturgeschichte<br />
eine Puppe unter den Weihnachtsbaum gelegt. Nach Ende der offiziellen<br />
Schulzeit mit 16 Jahren wurde ihr nicht einmal der Besuch eines einjährigen<br />
Lehrerinnenkurses erlaubt. Und doch entwickelte die etwas aufmüpfige älteste<br />
Tochter, die sich erst einmal an häuslichen Familienaufgaben erproben<br />
musste, längst andere Vorstellungen. L Einen wesentlichen Impuls bedeutete<br />
die Gretchenfigur in Goethes Faust, vermittelt von einer aufgeschlossenen<br />
Lehrerin. Aus Verzweiflung über die ungewollte Schwangerschaft wird das von<br />
dem Gelehrten verlassene »Mädchen aus dem Volke« zur Kindsmörderin. Rigide<br />
Moralvorstellungen als Hintergrund für eine solche Tat reichten auch<br />
während der Kaiserzeit noch tief in das Verhältnis der Geschlechter hinein. L<br />
Voreheliche Liebesbeziehungen und außereheliche Schwangerschaften junger<br />
Fabrikarbeiterinnen oder gar Töchter bürgerlicher Familien kamen offiziell<br />
nicht vor. Und doch gehörten solche Erfahrungen auch in der Zeit, als das<br />
Wort »Sexualität« noch nicht im deutschen Wortschatz vorkam, zur weiblichen<br />
Lebenswirklichkeit. Die aufgeweckte Stöcker-Tochter vertraute ihrem Tagebuch<br />
an: »Ich kann kaum mehr beschreiben, mit wie ungeheurer Wut dieser<br />
erste Einblick in die Gewalt und Tragik der Geschlechterbeziehungen damals<br />
auf mich gewirkt hat… welche Gefahren, welche Schicksale einer Frau drohten,<br />
wenn die Liebe in ihr Leben trat,…« 1 L Die Lektüre der Novelle »Romeo<br />
1 Wickert, S. 22.<br />
57<br />
Helene Stöcker (hinten Mitte) mit<br />
ihren vier Schwestern,<br />
entnommen: Wickert, S. 25